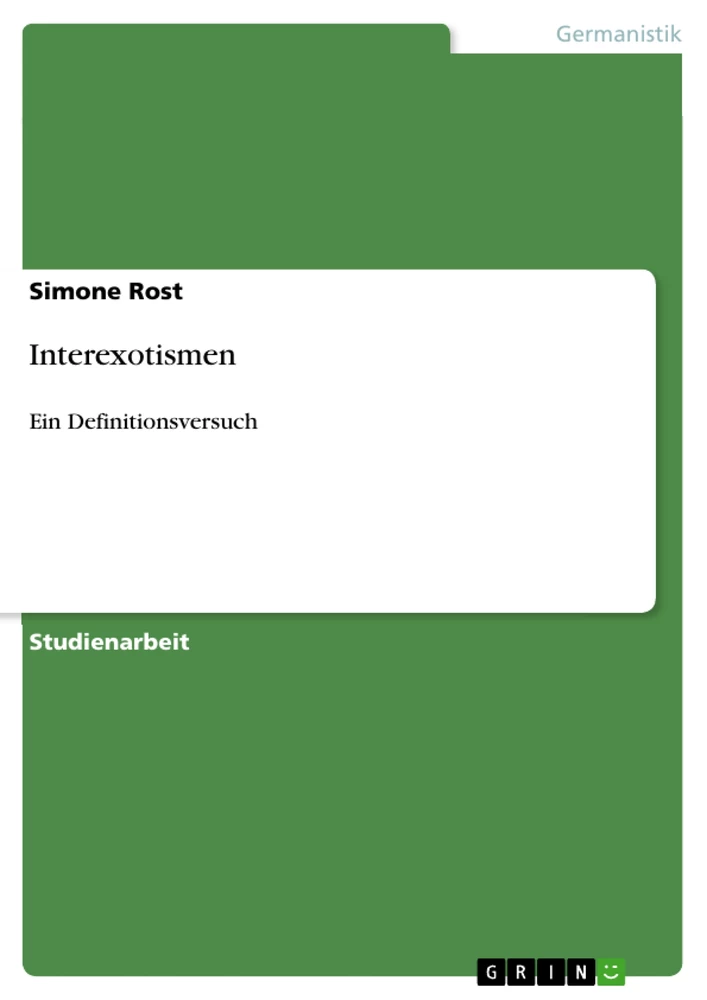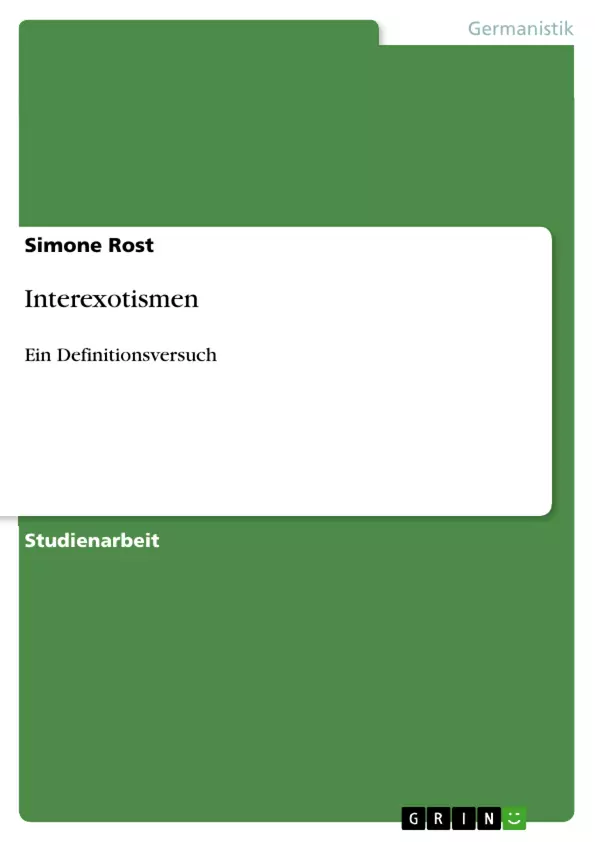Im Rahmen dieser Hausarbeit sollen diese Phänomene der „Exotismen“ in der deutschen Gegenwartssprache auf lexikalischer und morphologischer Ebene untersucht und der Versuch einer Systematisierung und gegebenenfalls Neudefinition unternommen werden.
Dafür wurden diverse Lexeme aufgrund ihrer Herkunftssprachen, die laut Aufgabenstellung nicht zu den romanischen, griechisch-lateinischen, englischen oder slawischen Sprachfamilien gehören sollten, selektiert. Die gefundenen Beispielwörter stellen die Basis des Wortkörpers dar, der sich auf die lexikographische Basis des Schülerduden-Fremdwörterbuches stützt .
Es stellt sich hier nicht die Frage, inwiefern diese Wörter als „fremd“ in der deutschen Standardsprache empfunden werden oder ob sie partiell oder vollkommen in das deutsche Kernsystem integriert sind, da sich der Prozess der Integration als fließender Vorgang mit problematischen Grenzen ausweist und die hier behandelten Lexeme ohnehin nicht als „heimisch“ empfunden werden . Die meisten werden sogar bewusst „zitierend“ verwendet, um eine aktuelle Weltgewandtheit und exotische Modernität zu vermitteln. Allerdings werden im Rahmen dieser Arbeit ausgewählte, lexikalisierte Wörter auf ihre „internationalen“ und „exotischen“ Charakteristika untersucht, die implizit eine fremde Herkunft konditionieren und so die Problematik um die Integration nicht vollkommen ausschließen.
Die Arbeit umfasst drei Haupteile. Im ersten Teil werden einige Arabismen vorgestellt, deren lexikalischer Einfluss der semitischen Sprachfamilie (z.B. arabisch, türkisch, persisch, hebräisch ) auf das Deutsche in kulturgeschichtlicher Hinsicht, exemplarisch betrachtet wird. Daran schließt sich ein kleiner Forschungsüberblick über Internationalismen an, in den sich die Definitionsproblematik und der Systematisierungsversuch der untersuchten Lexeme einbetten. Im letzten Teil wird anhand des Wortkörpers praktisch gearbeitet, wobei sich im Rahmen der Wortschatzerweiterung einigen ausgewählten Fragestellungen der Fremdwortbildung zugewandt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- Einleitung
- Arbeitsmethode
- Der Wortkörper
- Arabismen im Deutschen
- Einführung
- direkte arabisch-deutsche Transferenzen
- Literatur und Reisebeschreibungen
- lexikographisch-internationaler Teil
- Internationalismen und Exotismen
- Forschungsüberblick
- Internationalismen und Exotismen
- Definitionsansätze
- Internationalismen und Exotismen
- eine Problemsammlung
- Interexotismen - ein Definitionsversuch
- Betrachtungen am Wortkörper
- Interexotismen als Fremdwortbildungselemente
- flexionsmorphologische Probleme: Genus und Plural
- Interexotismen nach thematisch-idiomatischen Wortgruppen
- Japanisch
- Arabisch/Türkisch/Persisch
- Sanskrit/Hindi
- Norwegisch/Schwedisch/Finnisch/Isländisch/Inuit
- Malaiisch/ Polynesisch/Tamilisch/Indonesisch/Maorisch
- Chinesisch/Koreanisch/Tibetanisch/Mongolisch/Nepalesisch
- Afrikanisch
- Indianische Sprachen
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der „Exotismen“ in der deutschen Gegenwartssprache. Ziel ist es, diese lexikalischen und morphologischen Besonderheiten zu untersuchen und eine Systematisierung und gegebenenfalls eine Neudefinition vorzunehmen. Dabei liegt der Fokus auf Wörtern, die nicht zu den romanischen, griechisch-lateinischen, englischen oder slawischen Sprachfamilien gehören.
- Arabismen im Deutschen und ihre Einflüsse
- Internationalismen und Exotismen: Definitionsansätze und Problemfelder
- Interexotismen: Ein Definitionsversuch
- Fremdwortbildungselemente und flexionsmorphologische Besonderheiten von Interexotismen
- Thematische Gruppierung von Interexotismen nach Herkunftsregionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem sprachlichen Wandel und der Bedeutung von Sprachkontakt im Zeitalter der Globalisierung. Es wird erläutert, wie lexikalische Bereicherung durch Entlehnung und Fremdwortbildung entsteht, die durch die moderne Globalisierung verstärkt wird.
In Kapitel 2 wird die Arbeitsmethode vorgestellt, die auf der Auswahl von Wörtern basiert, die nicht zu den etablierten europäischen Sprachfamilien gehören. Die Arbeit untersucht die lexikalischen und morphologischen Aspekte dieser „Exotismen“ und betrachtet ihre Integration in das deutsche Kernsystem.
Kapitel 3 beschreibt den Wortkörper, der als Grundlage der Untersuchung dient. Es werden die Kriterien für die Auswahl der Lexeme erläutert, die hauptsächlich aus asiatischen, indianischen und semitischen Sprachfamilien stammen.
Kapitel 4 widmet sich den Arabismen im Deutschen und untersucht die direkte Übertragung von Arabismen ins Deutsche. Es werden die historische Entwicklung des Sprachkontakts und die Rolle von Literatur und Reisebeschreibungen beleuchtet.
Kapitel 5 behandelt die Problematik der Definition von Internationalismen und Exotismen und versucht, eine eigene Definition für Interexotismen zu entwickeln. Es werden verschiedene Ansätze zur Klassifizierung und Systematisierung dieser Wörter diskutiert.
Kapitel 6 befasst sich mit der morphologischen Analyse von Interexotismen und untersucht die Besonderheiten der Fremdwortbildung und der flexionsmorphologischen Integration dieser Wörter in die deutsche Sprache.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der „Exotismen“ in der deutschen Gegenwartssprache. Im Fokus stehen dabei die lexikalischen und morphologischen Besonderheiten von Wörtern, die nicht zu den etablierten europäischen Sprachfamilien gehören.
Schlüsselwörter sind: Interexotismen, Fremdwortbildung, Lexikalisierung, Internationalismen, Sprachwandel, Globalisierung, Arabismen, Morphologie, Genus, Plural, Wortkörper, lexikographische Analyse, Sprachkontakt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Interexotismen"?
Es handelt sich um einen Definitionsversuch für Wörter, die aus nicht-europäischen Sprachen (z. B. Japanisch, Sanskrit, Indianersprachen) ins Deutsche übernommen wurden und oft einen exotischen Charakter bewahren.
Welche Rolle spielen Arabismen in der deutschen Sprache?
Arabismen zeigen den historischen kulturellen Einfluss der semitischen Sprachfamilie auf das Deutsche, oft vermittelt durch Literatur oder Reisebeschreibungen.
Welche morphologischen Probleme treten bei Exotismen auf?
Häufige Probleme sind die Zuweisung eines Genus (Geschlecht) und die Bildung der Pluralform, da diese Wörter oft schwer in das deutsche Kernsystem zu integrieren sind.
Warum werden exotische Wörter im Deutschen oft "zitierend" verwendet?
Viele Sprecher nutzen diese Lexeme bewusst, um Weltgewandtheit, Modernität oder ein besonderes Flair zu vermitteln, ohne dass die Wörter voll integriert sind.
Aus welchen Sprachfamilien stammen die untersuchten Wörter?
Die Untersuchung fokussiert auf Sprachen außerhalb der romanischen, slawischen oder germanischen Familien, wie etwa Chinesisch, Malaiisch, Afrikanische Sprachen oder Sanskrit.
- Quote paper
- Simone Rost (Author), 2007, Interexotismen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166174