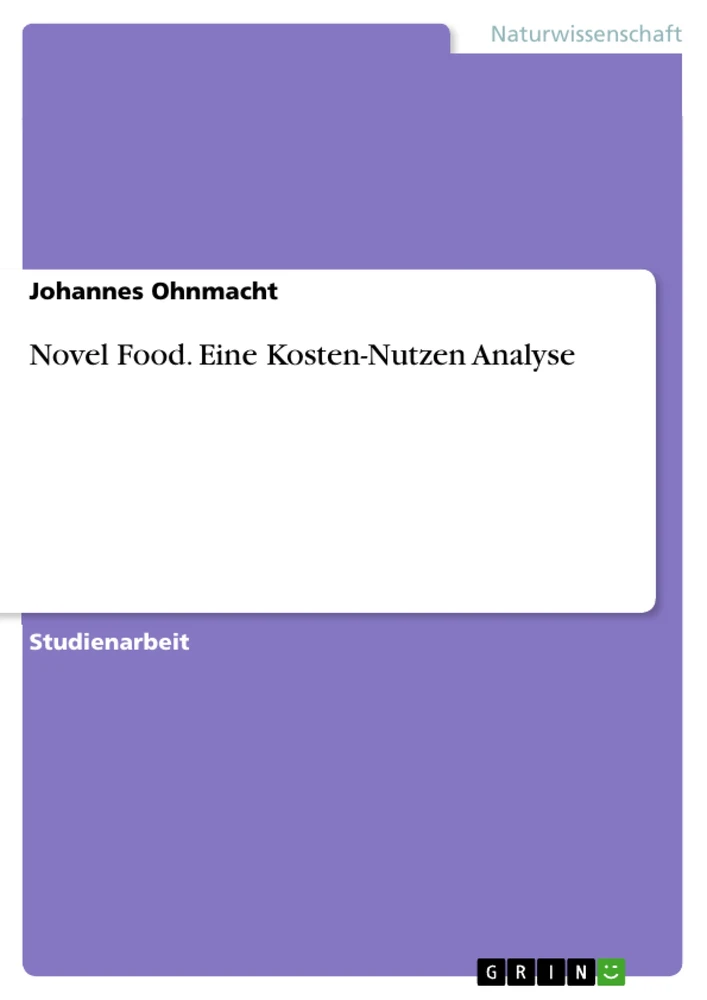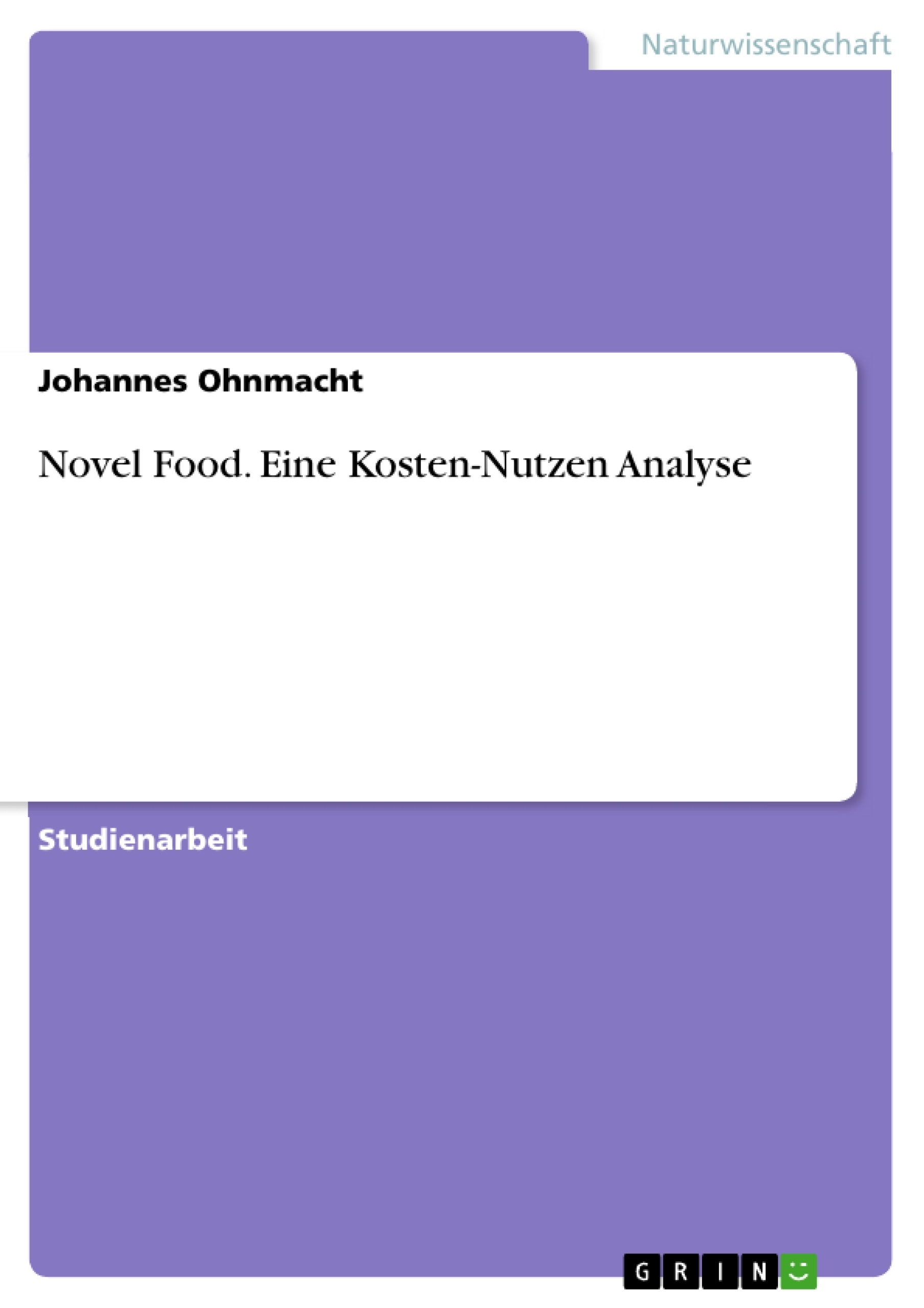„Genfood“ oder rechtlich „Novel Food“ ist eines der am häufigsten diskutierten Themen im Bereich der Technikfolgenabschätzung der letzten Jahre. In vorliegender Arbeit wird anhand einer klassischen Kosten- Nutzen Analyse untersucht, welche Vorteile beziehungsweise Gefahren das Vertreiben von gentechnisch veränderten Lebensmitteln birgt.
Nach einer Begriffsklärung (Kapitel II) werden hierzu zuerst die unterschiedlichen Vorteile von Novel Foods herausgestellt, welche am Ende des Kapitels auf ihre zugrunde liegenden ethischen Werte durchleuchtet werden (Kapitel III). Anschließend werden die Argumente gegen eine Einführung solcher Lebensmittel dargestellt und ebenso hinsichtlich ihrer ethischen Verortung analysiert (Kapitel IV). Im Schlussteil werden die Erkenntnisse nochmals gebündelt dargestellt und eine Gewichtung der Argumente und damit ein Fazit aus der Diskussion gezogen (Kapitel V).
Leitfrage der Arbeit ist, wie, beziehungsweise ob überhaupt, ein ethisch verantwortbarer Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsklärung
- III. Nutzenanalyse
- 1. Agrartechnische Verbesserungen durch Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen
- 2. Agrartechnische und verarbeitungstechnische Verbesserungen der Pflanzen selbst
- 3. Verbesserung der Lebensmittelqualität
- 4. Zugrunde liegende ethische Werte der Nutzenanalyse
- IV. Risikoanalyse
- 1. Ökologische Risiken
- 2. „Direkte“ Risiken
- 3. Sozio-ökonomische Risiken
- 4. Zugrunde liegende ethische Werte der Risikoanalyse
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile gentechnisch veränderter Lebensmittel (Novel Food) mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse. Die Leitfrage ist, ob ein ethisch verantwortbarer Umgang mit solchen Lebensmitteln möglich ist.
- Begriffliche Klärung von "Novel Food" und seinen verschiedenen Ausprägungen.
- Analyse der Vorteile gentechnisch veränderter Lebensmittel in der Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.
- Bewertung der ökologischen, direkten und sozioökonomischen Risiken.
- Ethische Betrachtung der Nutzen- und Risikoanalyse.
- Abschließende Bewertung der Argumente und Fazit.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema "Novel Food" ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: eine Kosten-Nutzen-Analyse, die die Vorteile und Gefahren gentechnisch veränderter Lebensmittel untersucht. Die Arbeit gliedert sich in eine Begriffsklärung, die Analyse der Nutzen, die Analyse der Risiken und ein abschließendes Fazit, welches die ethische Verantwortung im Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln beleuchtet.
II. Begriffsklärung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs "Novel Food". Es werden drei Typen von "Genfood" unterschieden, wobei die Abgrenzung aufgrund der Debatte um die Novel-Food-Verordnung der EU von 1997 schwierig ist. Die Arbeit verzichtet auf eine juristisch präzise Abgrenzung und konzentriert sich auf die ethischen Aspekte.
III. Nutzenanalyse: Dieses Kapitel präsentiert die Vorteile der Gentechnik in der Lebensmittelproduktion, gegliedert nach der Typologie aus Kapitel II. Es werden agrartechnische Verbesserungen durch den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen (z.B. verbesserte Stickstoff-Fixierung, Biopestizide) und verarbeitungstechnische Verbesserungen der Pflanzen selbst (höhere Erträge, geringerer Ausfall) beschrieben. Die ethischen Werte, die die Anwendung der Gentechnik rechtfertigen sollen, werden ebenfalls erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf dem erhöhten Ertrag und der reduzierten Umweltbelastung durch weniger chemische Pestizide.
Schlüsselwörter
Novel Food, Gentechnik, Kosten-Nutzen-Analyse, Risikoanalyse, ethische Verantwortung, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Agrartechnik, Lebensmittelqualität, ökologische Risiken, sozioökonomische Risiken.
Häufig gestellte Fragen zu: Kosten-Nutzen-Analyse gentechnisch veränderter Lebensmittel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile gentechnisch veränderter Lebensmittel (Novel Food) mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse. Die zentrale Fragestellung ist, ob ein ethisch verantwortbarer Umgang mit solchen Lebensmitteln möglich ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Begriffsklärung von "Novel Food", eine Analyse der Vorteile gentechnisch veränderter Lebensmittel in Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, eine Bewertung der ökologischen, direkten und sozioökonomischen Risiken, eine ethische Betrachtung der Nutzen- und Risikoanalyse und ein abschließendes Fazit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsklärung, Nutzenanalyse, Risikoanalyse und Fazit. Die Nutzenanalyse betrachtet agrartechnische Verbesserungen, verarbeitungstechnische Verbesserungen und Verbesserungen der Lebensmittelqualität. Die Risikoanalyse untersucht ökologische, direkte und sozioökonomische Risiken. Jedes Kapitel berücksichtigt die zugrundeliegenden ethischen Werte.
Was versteht die Arbeit unter "Novel Food"?
Die Arbeit definiert und grenzt den Begriff "Novel Food" ab. Obwohl drei Typen von "Genfood" unterschieden werden, verzichtet die Arbeit auf eine juristisch präzise Abgrenzung aufgrund der Komplexität der EU-Novel-Food-Verordnung von 1997 und konzentriert sich auf die ethischen Aspekte.
Welche Nutzen gentechnisch veränderter Lebensmittel werden analysiert?
Die Nutzenanalyse konzentriert sich auf agrartechnische Verbesserungen (z.B. verbesserte Stickstoff-Fixierung, Biopestizide) und verarbeitungstechnische Verbesserungen (höhere Erträge, geringerer Ausfall). Es wird auch die Verbesserung der Lebensmittelqualität betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf erhöhten Erträgen und reduzierter Umweltbelastung durch weniger chemische Pestizide.
Welche Risiken werden in der Arbeit betrachtet?
Die Risikoanalyse untersucht ökologische Risiken, "direkte" Risiken (die nicht näher spezifiziert werden) und sozioökonomische Risiken. Auch hier werden die zugrundeliegenden ethischen Werte beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Novel Food, Gentechnik, Kosten-Nutzen-Analyse, Risikoanalyse, ethische Verantwortung, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Agrartechnik, Lebensmittelqualität, ökologische Risiken, sozioökonomische Risiken.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im fünften Kapitel präsentiert und fasst die Argumente zusammen und zieht eine Schlussfolgerung bezüglich der ethischen Verantwortung im Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Der genaue Inhalt des Fazits ist im bereitgestellten Auszug nicht enthalten.
- Quote paper
- Johannes Ohnmacht (Author), 2004, Novel Food. Eine Kosten-Nutzen Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167323