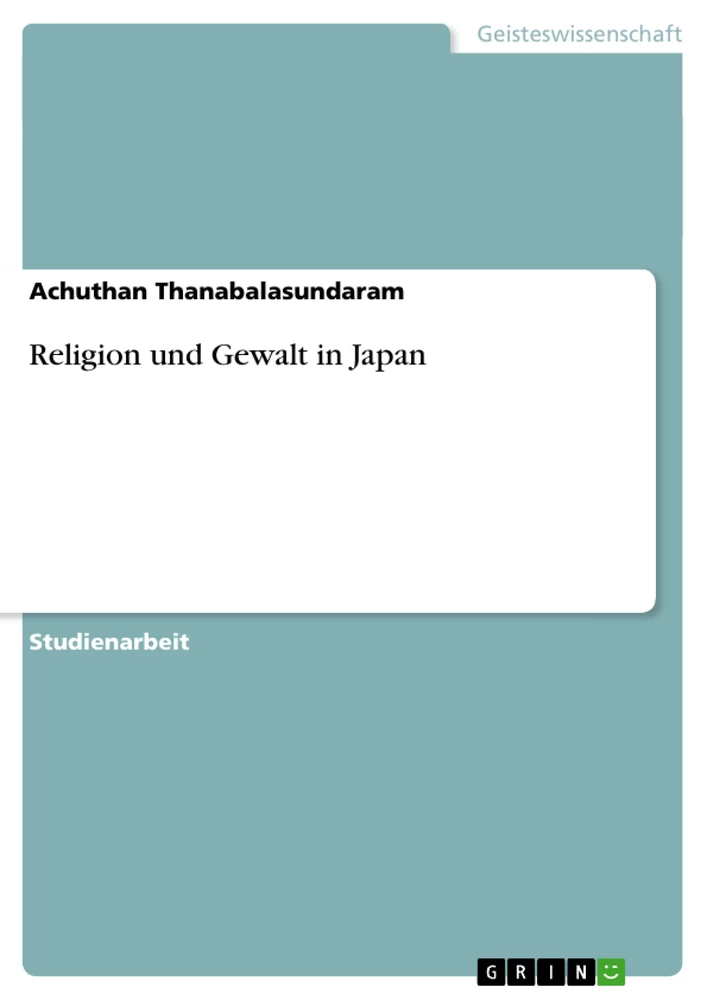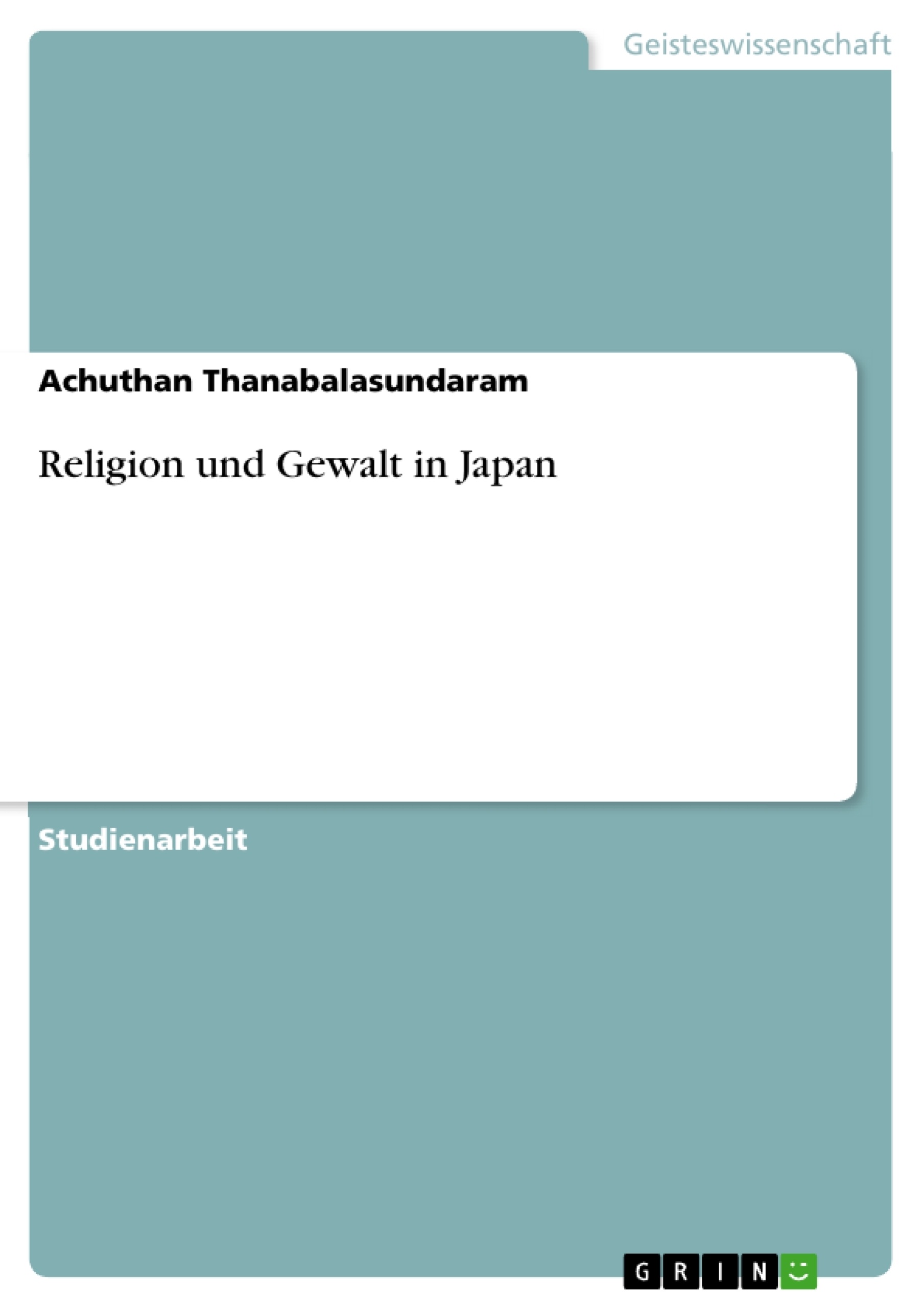Es gibt wohl kaum eine Religion, die solch extrem konträre
Meinungen in der Wissenschaft und Gesellschaft hervorgerufen hat,
wie der Buddhismus. Lange Zeit wurde der Buddhismus als eine
tolerante und gewaltfreie Religion angesehen, welche statt Dogmen
philosophische Lehren verbreite. Seit den 90er Jahren begann man,
kritischer mit dem Buddhismus umzugehen und zu versuchen, die
Gewalt Japans in der Showa-Ära mit der buddhistischen Tradition des
japanischen Volkes zu verbinden. Doch sollte die Wissenschaft sich
sowohl davor hüten, den Buddhismus zu romantisieren, als auch ihn
zu verteufeln. Dennoch ist es wichtig, den Buddhismus auf sein
Gewaltpotential hin zu untersuchen. Immerhin gibt es selbst in unserer
Zeit buddhistische Mönche, beispielsweise in Sri Lanka, die zum
Völkermord an den hinduistischen, muslimischen und christlichen
Tamilen aufrufen und dies mit der Religion begründen wollen.
Dieser Text wird versuchen, Gewalt in Zusammenhang mit der
Religion in historischer Perspektive zu untersuchen, um die Frage zu
beantworten, ob denn nicht auch ein politischer Faktor für die Gewalt
verantwortlich sein kann. Die Betrachtung Japans für diese
Fragestellung bietet sich an, da die Quellenlage in der westlichen Welt
für dieses Thema dichter ist als in den aktuellen Konflikten wie in Sri
Lanka. Drei historische Beispiele werden uns den Zusammenhang
zwischen Gewalt und Religion in Japan verdeutlichen. Das erste ist die
Bildung der Mönchssoldaten, das zweite die Christenverfolgung nach
dem Sengoku-Jidai und das dritte Beispiel ist die Integrationspolitik in
der Showa-Ära. Eine Betrachtung der Buddhismus-Kritiker folgt
anschließend. Bevor wir uns der konkreten Auseinandersetzung des Themas widmen, ist es jedoch erforderlich, dass wir uns einen groben
Überblick über die zwei bedeutendsten Religionen Japans verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Buddhismus und Shintoismus
- Mönchssoldaten
- Christenverfolgung im feudalen Japan
- Staatsshintoismus in der Meiji- und Showa-Ära
- Buddhismuskritik in der jüngeren Forschung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt am Beispiel Japans. Ziel ist es, die komplexe Interaktion zwischen buddhistischer Tradition und gewalttätigen Handlungen in der japanischen Geschichte zu beleuchten und zu analysieren, ob und inwiefern politische Faktoren eine Rolle spielten. Die Romantisierung oder Dämonisierung des Buddhismus soll vermieden werden.
- Die Koexistenz und Interaktion von Buddhismus und Shintoismus in Japan.
- Die Rolle buddhistischer Mönchssoldaten in der japanischen Geschichte.
- Die Christenverfolgung im feudalen Japan und ihre religiösen und politischen Hintergründe.
- Der Staatsshintoismus in der Meiji- und Showa-Ära und seine Verbindung zu nationalistischer Gewalt.
- Die jüngere Forschungskritik am Buddhismus und seine Interpretationen von Gewalt.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang von Religion und Gewalt in Japan in den Mittelpunkt. Sie betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung des Buddhismus, der sowohl als tolerant und gewaltfrei als auch als mit Gewalt verbunden angesehen wird. Japan wird als Fallbeispiel gewählt aufgrund der besseren Quellenlage im Vergleich zu aktuellen Konflikten. Die Arbeit fokussiert auf drei historische Beispiele: Mönchssoldaten, Christenverfolgung und den Staatsshintoismus der Showa-Ära, sowie eine Betrachtung der Buddhismuskritik.
Buddhismus und Shintoismus: Dieses Kapitel beschreibt die spezifische religiöse Landschaft Japans, die durch die Koexistenz und Interaktion von Buddhismus und Shintoismus gekennzeichnet ist. Viele Japaner praktizieren Elemente beider Religionen. Der Buddhismus wurde nicht durch Missionierung, sondern durch den Tenno, das Oberhaupt des Shintoismus, eingeführt. Der Buddhismus integrierte die Kami des Shintoismus in sein Weltbild. Die anfängliche Ausübung des Buddhismus beschränkte sich auf den Kaiserhof und den Adel, mit Verboten der Verbreitung außerhalb der Klöster. Die Instrumentalisierung der Religion durch die Politik wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben.
Mönchssoldaten: Ab dem 11. Jahrhundert entwickelten sich buddhistische Klöster zu politischen Akteuren mit eigenen Heeresverbänden. Mönchssoldaten wurden für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter interne Konflikte, Landgewinnung und Proteste gegen Regierungsentscheidungen. Trotz des buddhistischen Verbots des Tötens, begingen Mönchssoldaten über 400 registrierte Gewaltaktionen. Der Zustrom von ungeeigneten Rekruten in Klöster wird als Grund für die Entstehung dieser Armeen genannt.
Schlüsselwörter
Buddhismus, Shintoismus, Gewalt, Japan, Mönchssoldaten, Christenverfolgung, Staatsshintoismus, Meiji-Ära, Showa-Ära, Politik, Religion, historische Perspektive, Buddhismuskritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt in Japan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt in Japan. Sie analysiert die Interaktion zwischen buddhistischer Tradition und gewalttätigen Handlungen in der japanischen Geschichte und hinterfragt den Einfluss politischer Faktoren.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexe Interaktion zwischen buddhistischer Tradition und Gewalt in Japan zu beleuchten. Sie möchte die Rolle politischer Faktoren analysieren und dabei vermeiden, den Buddhismus zu romantisieren oder zu dämonisieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Koexistenz von Buddhismus und Shintoismus, die Rolle buddhistischer Mönchssoldaten, die Christenverfolgung im feudalen Japan, den Staatsshintoismus in der Meiji- und Showa-Ära und die jüngere Forschungskritik am Buddhismus im Hinblick auf Gewalt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Buddhismus und Shintoismus, Mönchssoldaten, Christenverfolgung im feudalen Japan, Staatsshintoismus in der Meiji- und Showa-Ära, Buddhismuskritik in der jüngeren Forschung und Fazit.
Wie wird der Buddhismus in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Buddhismus differenziert und vermeidet sowohl eine Romantisierung als auch eine Dämonisierung. Sie untersucht ihn im Kontext seiner komplexen Interaktion mit Gewalt in der japanischen Geschichte.
Welche Rolle spielen Mönchssoldaten in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rolle buddhistischer Mönchssoldaten ab dem 11. Jahrhundert als politische Akteure mit eigenen Armeen, die an internen Konflikten, Landgewinnung und Protesten beteiligt waren. Es wird auch der Widerspruch zwischen buddhistischer Lehre und dem Handeln der Mönchssoldaten beleuchtet.
Wie wird die Christenverfolgung im feudalen Japan behandelt?
Die Arbeit untersucht die Christenverfolgung im feudalen Japan unter Berücksichtigung der religiösen und politischen Hintergründe dieses Ereignisses.
Welche Bedeutung hat der Staatsshintoismus?
Die Arbeit analysiert den Staatsshintoismus in der Meiji- und Showa-Ära und seine Verbindung zu nationalistischer Gewalt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Buddhismus, Shintoismus, Gewalt, Japan, Mönchssoldaten, Christenverfolgung, Staatsshintoismus, Meiji-Ära, Showa-Ära, Politik, Religion, historische Perspektive, Buddhismuskritik.
Warum wird Japan als Fallbeispiel gewählt?
Japan wird aufgrund der besseren Quellenlage im Vergleich zu aktuellen Konflikten als Fallbeispiel gewählt, um den Zusammenhang von Religion und Gewalt zu untersuchen.
- Citar trabajo
- Achuthan Thanabalasundaram (Autor), 2009, Religion und Gewalt in Japan, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167432