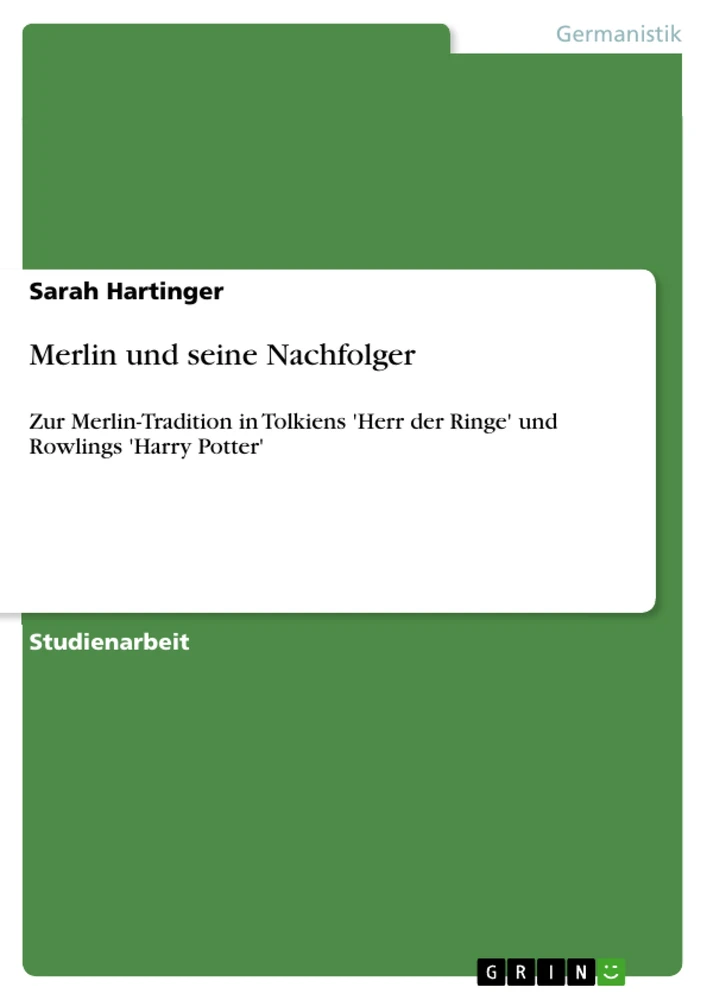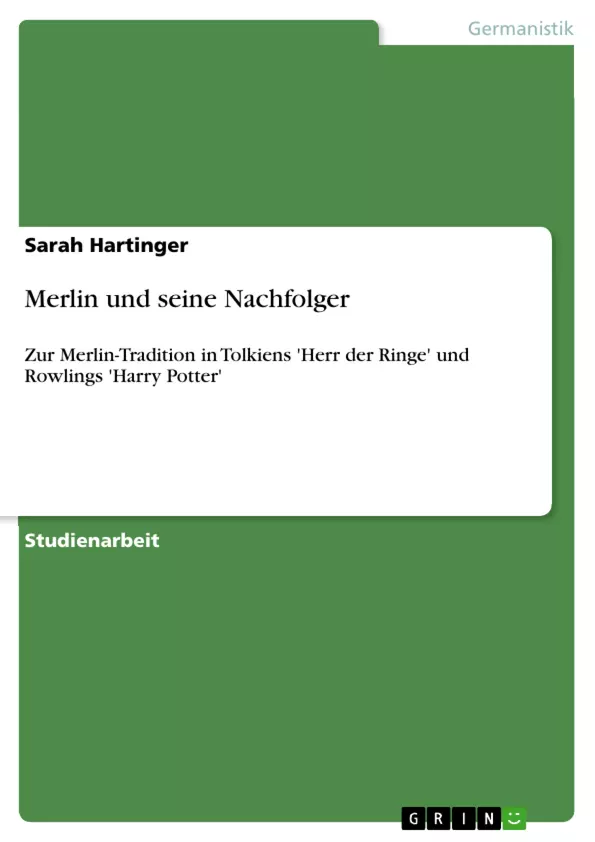Merlin – das ist ein Name, der nahezu niemandem mehr unbekannt ist, und eine Figur, die im literarischen Bewusstsein schon vor dem Mittelalter und bis in die heutige Zeit präsent ist.
Literarische (und alsbald auch filmische) Repräsentation sind – auch in Deutschland, trotz der im Mittelalter noch recht flauen Rezeption – heute zunehmend häufiger und vielfältiger. Viele Filme und Romane tragen den Titel 'Merlin' oder führen zumindest einen Charakter mit diesem Namen auf. Merlin und der stets damit verstrickte Artus-Stoff hat seinen Weg in Comic-Serien wie 'Prinz Eisenherz' und Zeichentrickfilme wie Disneys 'Die Hexe und der Zauberer' gefunden, aber auch die Theaterbühne erobert wie beispielsweise schon mit John Drydens 'King Arthur' und in Deutschland nicht zuletzt mit Tankred Dorsts 'Merlin oder Das wüste Land'. Dabei hat die Figur die verschiedensten Ausprägungen und Wandlungen erfahren.
Doch auch in Kontexten, die zunächst unabhängig von jeglicher Artus-Legende zu sein scheinen, begegnen uns Figuren, die entweder durch bestimmte äußerliche Merkmale oder bekannte Funktionsmuster unweigerlich eine Merlin-Assoziation hervorrufen. Zwei relativ bekannte Beispiele für eine solche Figur, mit denen ich mich hier näher beschäftigen werde, sind der Zauberer Gandalf in J.R.R. Tolkiens 'Der kleine Hobbit' und 'Der Herr der Ringe' sowie der Zaubermeister Dumbledore in Joanne K. Rowlings 'Harry Potter'-Serie.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zauberer und Zauberei
- 1. Magie im Mittelalter
- 2. Merlin
- 3. Langer Bart, spitzer Hut - Gandalf
- 4. Zauberer unter Zauberern - Dumbledore
- III. Verführer, Führer, Vater
- 1. Des Zauberers Aufgabe und seine Funktion
- a) Von Allwissenheit zu Weisheit
- b) Vom Allvater zum Vater
- 2. Glaube, Liebe, Hoffnung
- a) Heiden, Christen und die Sache mit der Theologie
- b) Gott und Teufel, Weiß und Schwarz
- 1. Des Zauberers Aufgabe und seine Funktion
- IV. Mensch oder Übermensch
- 1. Narren, die lieben
- 2. Irrtum und Allmacht
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Figur des Merlin und seinen Nachfolgern in der Fantasy-Literatur. Sie analysiert die Entwicklung des Merlin-Motivs in Tolkiens „Der Herr der Ringe“ und Rowlings „Harry Potter“ sowie die Rolle der Zauberer in diesen Werken im Vergleich zu ihrem mittelalterlichen Vorbild.
- Die Entwicklung des Merlin-Motivs in der Fantasy-Literatur
- Die Rolle von Zauberern in „Der Herr der Ringe“ und „Harry Potter“
- Vergleich zwischen den Zauberern in Fantasy-Literatur und ihrem mittelalterlichen Vorbild
- Die Bedeutung von Magie und Zauberei in der mittelalterlichen Literatur
- Die Bedeutung von Mythos und Legende in der Fantasy-Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird eine Einleitung in die Thematik gegeben und die Relevanz der Figur des Merlin in der Literatur erläutert.
Kapitel II beschäftigt sich mit der Figur des Zauberers und der Magie im Mittelalter. Es werden verschiedene Aspekte wie die Definition des Zauberers, die Magie im Mittelalter sowie die Entwicklung der Zaubererfiguren Gandalf und Dumbledore im Vergleich zu Merlin beleuchtet.
Kapitel III analysiert die Funktionen des Zauberers in der Literatur und in den ausgewählten Beispielen. Es geht um die Entwicklung vom Allwissenden zum Weisen sowie vom Allvater zum Vater und die Rolle des Glaubens in der Welt der Zauberer.
Kapitel IV beleuchtet die Frage, ob Zauberer als Menschen oder Übermenschen anzusehen sind und analysiert die Beziehung zwischen Liebe und Narretei sowie die Rolle von Irrtum und Allmacht in der Welt der Magie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Merlin, Fantasy-Literatur, Zauberer, Magie, Mittelalter, J.R.R. Tolkien, Joanne K. Rowling, „Der Herr der Ringe“, „Harry Potter“, Gandalf, Dumbledore, Mythos, Legende, Religion, Glaube.
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt als literarisches Vorbild für moderne Zauberfiguren?
Die mittelalterliche Figur des Merlin gilt als der Urtyp des Zauberers, auf dem moderne Charaktere basieren.
Welche modernen Zauberer werden in der Arbeit analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Gandalf aus J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ und Albus Dumbledore aus J.K. Rowlings „Harry Potter“.
Wie hat sich die Rolle des Zauberers gewandelt?
Die Figur entwickelte sich von einer allwissenden, oft ambivalenten Macht (Merlin) hin zu einer weisen, väterlichen Mentor-Figur (Dumbledore/Gandalf).
Was wird über Magie im Mittelalter ausgesagt?
Die Arbeit beleuchtet das mittelalterliche Verständnis von Magie zwischen Heidentum, christlicher Theologie und dem Kampf zwischen Gut und Böse.
Sind Gandalf und Dumbledore als Menschen oder Übermenschen zu sehen?
Das Dokument untersucht das Spannungsfeld zwischen ihrer scheinbaren Allmacht und ihren menschlichen Schwächen, Irrtümern und Emotionen.
- Arbeit zitieren
- Sarah Hartinger (Autor:in), 2010, Merlin und seine Nachfolger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167657