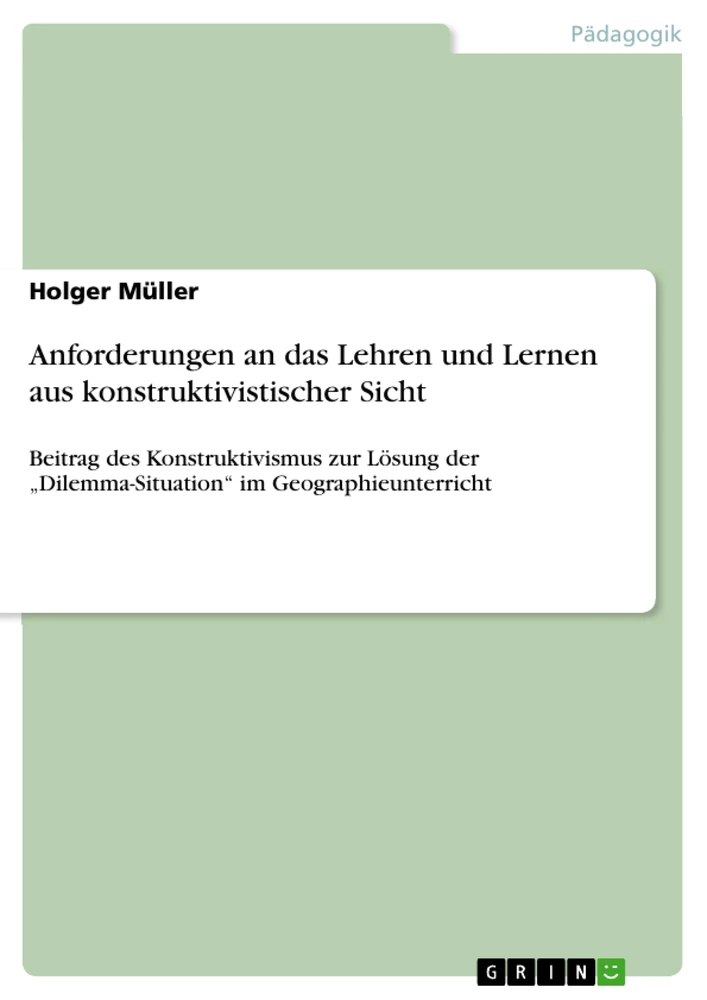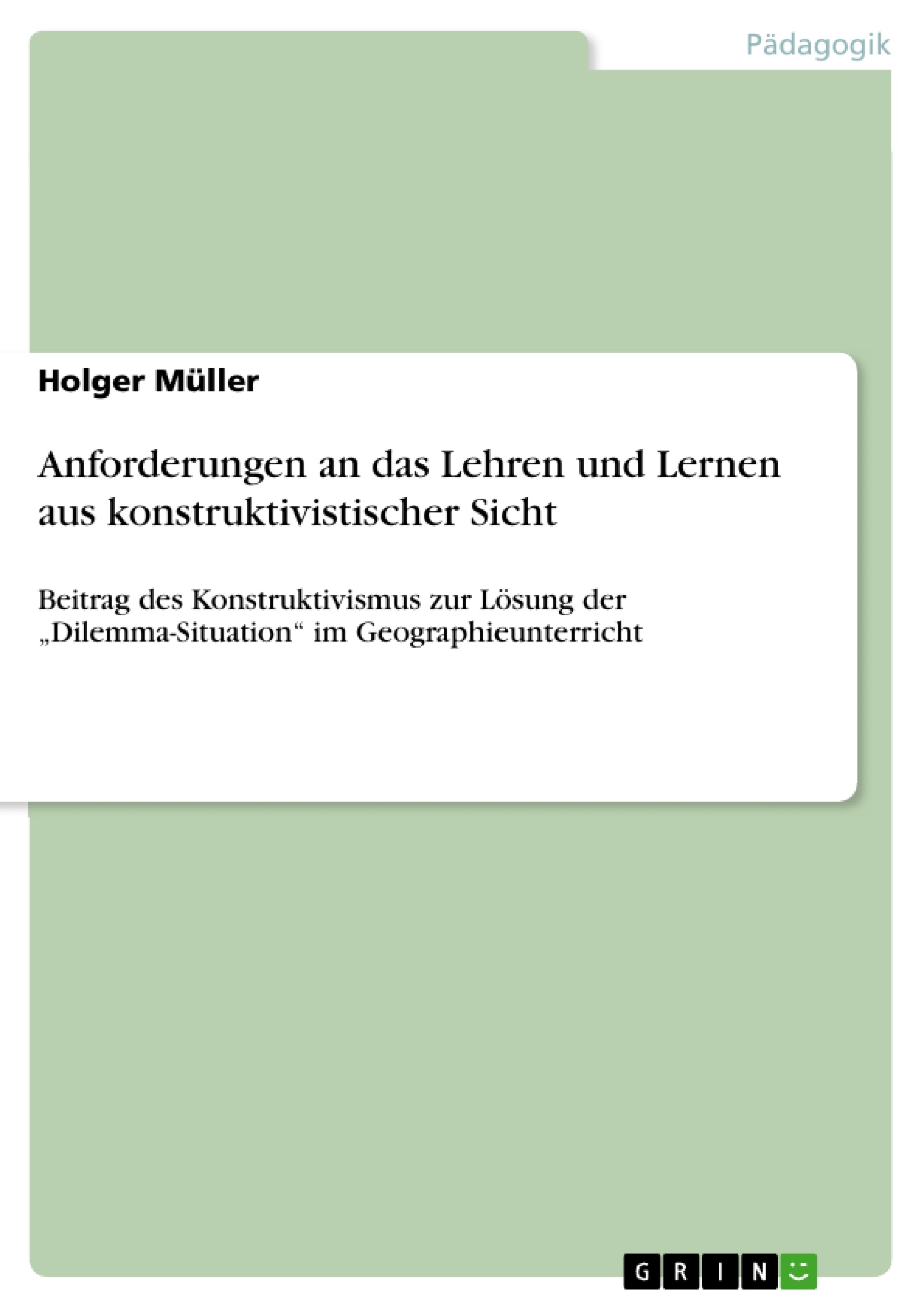Der folgenden Ausarbeitung lag folgende Aufgabenstellung zu Grunde:
<<Führen Sie kurz und anschaulich in die theoretischen Grundlagen
des Konstruktivismus ein. Stellen Sie anschließend den Beitrag des
Konstruktivismus zur Lösung der „Dilemma-Situation“ heraus und
formulieren Anforderungen an das Lehren und Lernen aus konstruktivistischer Sicht.>>
Es wird also zuerst die theoretischen Grundlagen des Konstruktivismus erläutert und die Frage nach der Umsetzbarkeit im Schulunterricht diskutiert. Anschließend wird der Beitrag des Konstruktivismus zur Lösung der „Dilemma-Situation“ herausgearbeitet sowie differentierte Anforderungen an das Lehren und Lernen aus konstruktivistischer Sicht formuliert. Alle Aspekte werden vor dem Hintergrund von BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung im
Geographieunterricht) thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konstruktivismus
- Theoretische Grundlagen
- Radikaler und gemäßigter Konstruktivismus
- Radikaler Konstruktivismus
- Gemäßigter Konstruktivismus
- Bedeutung für den Lehr- und Lernprozess
- Konstruktivismus und BNE
- Zusammenhang Wissen und Handeln
- Nachhaltigkeit des Lernens
- Beitrag des Konstruktivmus zur Lösung der „,Dilemma-Situation”
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Konstruktivismus und seinem Beitrag zur Lösung des Problems der Kluft zwischen Umweltbewusstsein und tatsächlichem Umwelthandeln. Sie untersucht, wie die konstruktivistische Theorie den Wissenserwerb beeinflusst und welche Rolle sie im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) spielt.
- Theoretische Grundlagen des Konstruktivismus
- Unterscheidung zwischen radikalem und gemäßigtem Konstruktivismus
- Bedeutung des Konstruktivismus für den Lehr- und Lernprozess
- Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln im Kontext von BNE
- Konstruktivistischer Ansatz zur Lösung der „Dilemma-Situation“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt das Thema der Ausarbeitung ein und beleuchtet die zentrale Rolle des Geographieunterrichts im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie definiert BNE und stellt das Problem der „Dilemma-Situation“ zwischen Umweltbewusstsein und Umwelthandeln dar.
1 Konstruktivismus
Das erste Kapitel befasst sich mit der konstruktivistischen Erkenntnistheorie und ihren verschiedenen Deutungen. Es erläutert die theoretischen Grundlagen des Konstruktivismus und die Unterscheidung zwischen dem radikalen und dem gemäßigten Konstruktivismus. Außerdem werden die Auswirkungen des Konstruktivismus auf den Lehr- und Lernprozess diskutiert.
2 Konstruktivismus und BNE
Das zweite Kapitel untersucht die Verbindung zwischen dem Konstruktivismus und der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es analysiert den Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln im Kontext von BNE und die Bedeutung eines „nachhaltigen“ Lernens.
3 Beitrag des Konstruktivmus zur Lösung der „Dilemma-Situation“
Dieses Kapitel fasst die zentralen Punkte der Ausarbeitung zusammen und zeigt den Beitrag des Konstruktivismus zur Lösung der „Dilemma-Situation“ zwischen Umweltbewusstsein und Umwelthandeln auf.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Ausarbeitung sind: Konstruktivismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Wissen, Handeln, „Dilemma-Situation“, Umweltbewusstsein, Umwelthandeln, Lernprozess, Unterricht, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konstruktivismus im Bildungskontext?
Konstruktivismus besagt, dass Wissen nicht passiv aufgenommen, sondern vom Lernenden aktiv auf Basis individueller Erfahrungen konstruiert wird.
Was unterscheidet radikalen von gemäßigtem Konstruktivismus?
Der radikale Konstruktivismus verneint den Zugriff auf eine objektive Realität, während der gemäßigte Konstruktivismus davon ausgeht, dass Lernen ein sozialer Prozess in einer geteilten Welt ist.
Wie hilft der Konstruktivismus bei der „Dilemma-Situation“ in der BNE?
Er bietet Ansätze, um die Kluft zwischen Umweltwissen und tatsächlichem Umwelthandeln zu überbrücken, indem Lernen stärker an die Lebenswelt geknüpft wird.
Was bedeutet BNE im Geographieunterricht?
BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung und zielt darauf ab, Schüler zu zukunftsfähigem Denken und verantwortungsvollem Handeln gegenüber der Umwelt zu befähigen.
Welche Anforderungen stellt der Konstruktivismus an Lehrer?
Lehrer agieren weniger als Wissensvermittler, sondern eher als Lernbegleiter, die Lernumgebungen schaffen, in denen Schüler selbstständig Erkenntnisse gewinnen können.
- Quote paper
- Holger Müller (Author), 2010, Anforderungen an das Lehren und Lernen aus konstruktivistischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167881