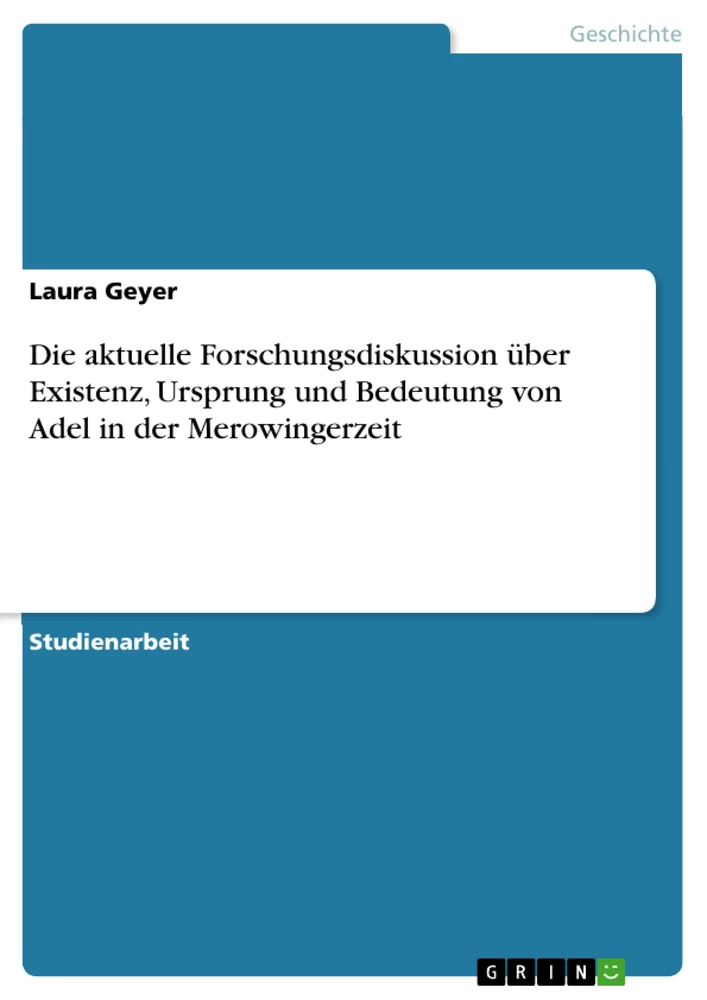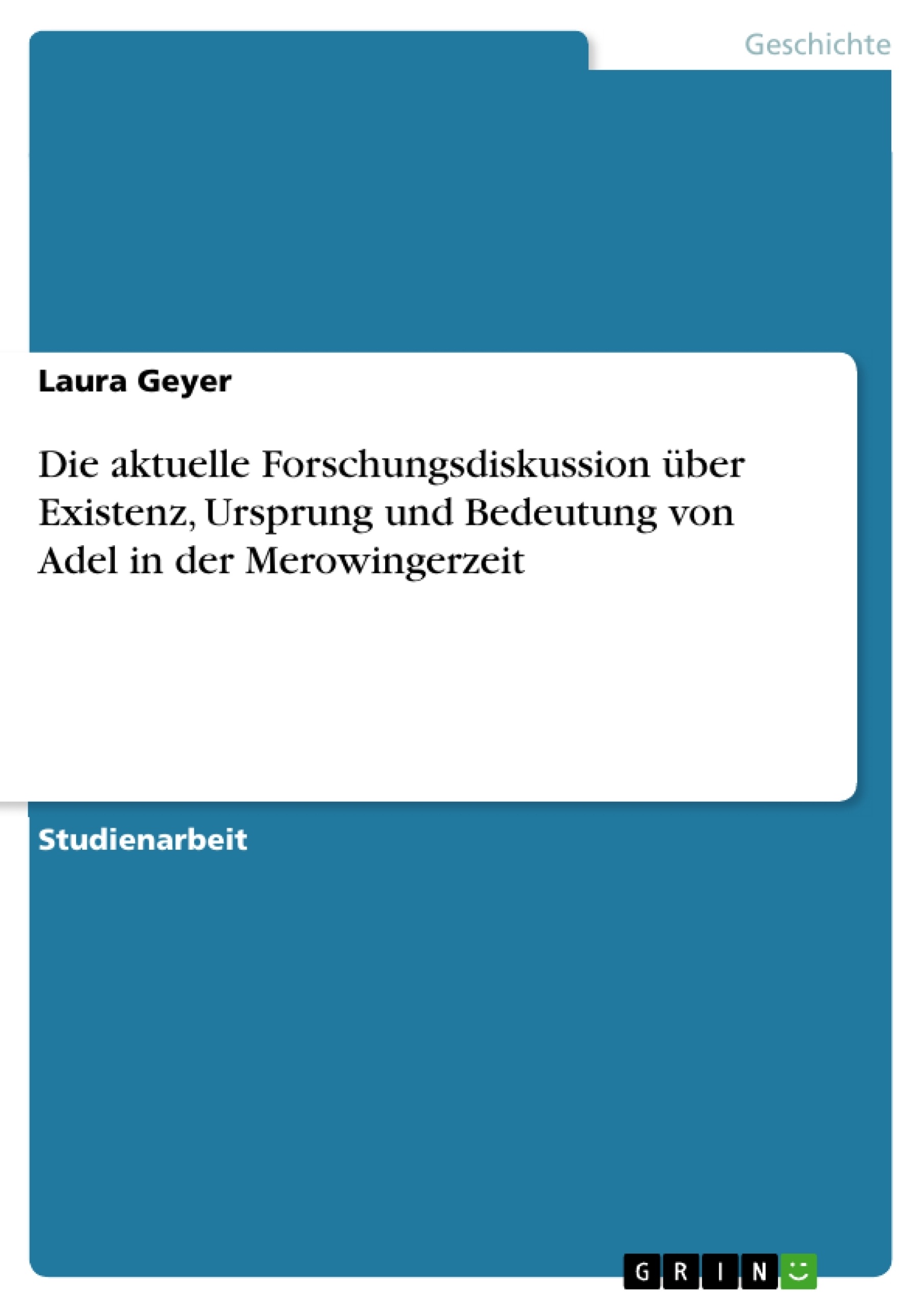Die Adelsforschung bildete schon früh einen essentiellen Bestandteil der Rechts- und Verfassungsgeschichte, wobei vor allem die Ursprünge des mittelalterlichen Adels das Interesse der Forscher weckten. Für das 19. und frühe 20. Jahrhundert lassen sich grob zwei theoretische Ansätze, die Entstehung und die politische, soziale und wirtschaftliche Rolle des Adels zu definieren, unterscheiden. Die „Gemeinfreienlehre“ beruht auf der Annahme einer „genossenschaftlichen Ordnung“ der Germanen, wie sie etwa von Tacitus beschrieben wurde. Als Ausgangspunkt dient eine Gesellschaft gleichberechtigter, freier Bauern, denen eine ähnliche materielle Grundlage zur Verfügung steht, als staatstragende Schicht. Unterschiedliche Betrachtungsweisen aus verschiedenen historischen Perspektiven führten zu dem gemeinsamen Schluss, dass durch den Adel das ideale, von Freiheit und Gleichberechtigung geprägte Gemeinwesen zugrunde gegangen sei. Auch der fränkische Königsstaat habe noch auf den Gemeinfreien basiert, bis unter schwachen Königen der Adel, der aus der Übernahme fränkischer Verwaltungsämter oder der Anhäufung von Grundbesitz entstanden war, königsähnliche Macht an sich gerissen und die freien Bauern unterdrückt habe.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts kam neben der „Gemeinfreienlehre“ die sogenannte „Adelsherrschaftstheorie“ auf. Vertreter dieser Theorie setzten die Existenz eines „Herrenstandes“ mit autogenen Herrschaftsrechten, die sich nicht vom König und der Ausübung der von diesem übertragener Ämter ableiteten, ab dem 9. Jahrhundert voraus . Die Akkumulation von Grundbesitz stellt hier nicht die Folge adliger Herrschaft dar, sondern deren Basis. Ab den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts betrachtete man Adel als essentiellen Bestandteil des mittelalterlichen Staats, dessen Entwicklung schon in germanischer Zeit ihren Anfang genommen hätte. Auch eine deutliche Abgrenzung vom Königtum wurde nicht mehr angenommen, Adelsherrschaft und Königtum stellten somit gleichartige Phänomene von unterschiedlicher Intensität dar. Strittig blieben allerdings stets einerseits die Frage nach der Kontinuität eines vorvölkerwanderungszeitlichen germanischen Adels, andererseits die Frage nach der rechtlichen Stellung des Adels im Allgemeinen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Forschungsdiskussion über Existenz, Ursprung und Bedeutung von Adel in der Merowingerzeit
- 1. „Adel oder Oberschicht?“ – Die Forschungskontroverse der sechziger und siebziger Jahre
- a) Franz Irsiglers „Untersuchungen zur Geschichte des frühfränkischen Adels“
- b) Heike Grahn-Hoeks „Die fränkische Oberschicht im 6. Jahrhundert“
- c) Kritik an beiden Ansätzen
- d) Zusammenfassung
- 2. Alternative methodische Ansätze
- a) Heiko Steuers Infragestellung der sozialgeschichtlichen Aussagekraft archäologischer Quellen
- b) Karl Ferdinand Werners Kontinuitätstheorie
- 1. „Adel oder Oberschicht?“ – Die Forschungskontroverse der sechziger und siebziger Jahre
- III. Zusammenfassung und Darstellung des aktuellen Forschungsstands
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Forschungsdiskussion um die Existenz, den Ursprung und die Bedeutung des Adels in der Merowingerzeit. Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand darzustellen und verschiedene methodische Ansätze zu beleuchten.
- Die Kontroverse um die Definition von „Adel“ versus „Oberschicht“ in der frühen fränkischen Gesellschaft.
- Die unterschiedlichen Interpretationen von Quellen (schriftliche und archäologische) zur Rekonstruktion der merowingischen Gesellschaft.
- Die Rolle von Franz Irsigler und Heike Grahn-Hoek in der Adelsforschung.
- Alternative methodische Ansätze zur Erforschung der frühmittelalterlichen Gesellschaft.
- Die Frage nach der Kontinuität eines vorvölkerwanderungszeitlichen germanischen Adels.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der Adelsforschung, insbesondere die gegensätzlichen Ansätze der „Gemeinfreienlehre“ und der „Adelsherrschaftstheorie“. Sie hebt die anhaltende Debatte um die Ursprünge des mittelalterlichen Adels und die Schwierigkeiten, einen Konsens über seine Entstehung und Rolle im Frühmittelalter zu erzielen, hervor. Die Einleitung führt in die zentralen Fragen ein, die im Hauptteil der Arbeit behandelt werden, nämlich die Kontroverse um die Existenz eines vorvölkerwanderungszeitlichen germanischen Adels, dessen Kontinuität und die Bedeutung des gallorömischen Senatorenadels und der Kontinuität des spätantiken Ämterwesens. Die Einleitung benennt die zentralen Akteure der Forschungskontroverse (Irsigler und Grahn-Hoek) und kündigt den Aufbau der Arbeit an.
II. Forschungsdiskussion über Existenz, Ursprung und Bedeutung von Adel in der Merowingerzeit: Dieses Kapitel analysiert die Hauptströmungen der Forschung zum Thema Adel in der Merowingerzeit. Es vergleicht und kontrastiert die Ansätze von Franz Irsigler und Heike Grahn-Hoek, die sich in ihren Interpretationen der Quellen und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen zur Existenz und Rolle des Adels in dieser Epoche deutlich unterscheiden. Irsigler argumentiert für die Existenz eines frühfränkischen Adels, gestützt auf eine breite Quellenbasis, einschließlich schriftlicher und archäologischer Quellen, während Grahn-Hoek eine andere Sichtweise vertritt. Das Kapitel untersucht detailliert die Argumentationslinien beider Autoren, beleuchtet ihre methodischen Ansätze und die Kritikpunkte an ihren jeweiligen Theorien. Es geht schließlich auf alternative methodische Ansätze ein, die die Kontroverse weiter beleuchten und neue Perspektiven eröffnen.
Schlüsselwörter
Merowingerzeit, Adel, Oberschicht, Forschungsdiskussion, Franz Irsigler, Heike Grahn-Hoek, Quellenkritik, Archäologie, Rechtsquellen, soziale Geschichte, Kontinuität, Germanen, gallorömischer Senatorenadel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Forschungsdiskussion über Existenz, Ursprung und Bedeutung von Adel in der Merowingerzeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die wissenschaftliche Debatte um die Existenz, den Ursprung und die Bedeutung des Adels in der Merowingerzeit. Sie untersucht verschiedene methodische Ansätze und den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema.
Welche Hauptströmungen der Forschung werden betrachtet?
Die Arbeit vergleicht und kontrastiert vor allem die Ansätze von Franz Irsigler und Heike Grahn-Hoek. Irsigler vertritt die These eines frühfränkischen Adels, während Grahn-Hoek eine andere Sichtweise einnimmt. Zusätzlich werden alternative methodische Ansätze diskutiert.
Welche Quellen werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf eine breite Quellenbasis, einschließlich schriftlicher und archäologischer Quellen. Die unterschiedliche Interpretation dieser Quellen durch die verschiedenen Forscher wird kritisch beleuchtet.
Welche methodischen Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene methodische Ansätze zur Erforschung der frühmittelalterlichen Gesellschaft. Sie diskutiert die sozialgeschichtliche Aussagekraft archäologischer Quellen und alternative Perspektiven zur Interpretation der vorhandenen Daten.
Welche zentrale Kontroverse wird behandelt?
Ein zentrales Thema ist die Kontroverse um die Definition von „Adel“ versus „Oberschicht“ in der frühen fränkischen Gesellschaft und die Frage nach der Kontinuität eines vorvölkerwanderungszeitlichen germanischen Adels.
Welche Rolle spielen Irsigler und Grahn-Hoek in dieser Forschungsdiskussion?
Franz Irsigler und Heike Grahn-Hoek sind zentrale Akteure in der Forschungsdebatte um den Adel in der Merowingerzeit. Ihre unterschiedlichen Interpretationen der Quellen und methodischen Ansätze stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Forschungsdiskussion über Adel in der Merowingerzeit und eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstands.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Merowingerzeit, Adel, Oberschicht, Forschungsdiskussion, Franz Irsigler, Heike Grahn-Hoek, Quellenkritik, Archäologie, Rechtsquellen, soziale Geschichte, Kontinuität, Germanen, gallorömischer Senatorenadel.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes zur Debatte um den Adel in der Merowingerzeit und die Beleuchtung der verschiedenen methodischen Ansätze in diesem Forschungsfeld.
Welche Fragen werden in der Einleitung aufgeworfen?
Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der Adelsforschung, die gegensätzlichen Ansätze der „Gemeinfreienlehre“ und der „Adelsherrschaftstheorie“, die Debatte um die Ursprünge des mittelalterlichen Adels und die Schwierigkeiten, einen Konsens zu erzielen. Sie benennt die zentralen Fragen, die im Hauptteil behandelt werden, darunter die Kontroverse um die Existenz eines vorvölkerwanderungszeitlichen germanischen Adels, dessen Kontinuität und die Bedeutung des gallorömischen Senatorenadels und der Kontinuität des spätantiken Ämterwesens.
- Citation du texte
- Laura Geyer (Auteur), 2009, Die aktuelle Forschungsdiskussion über Existenz, Ursprung und Bedeutung von Adel in der Merowingerzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168440