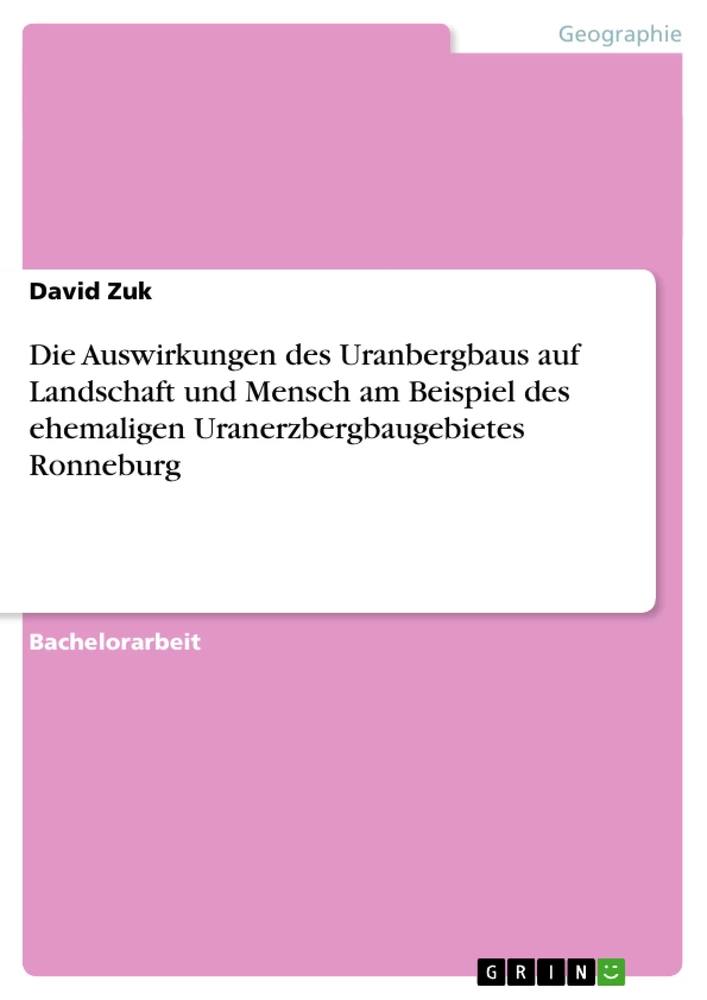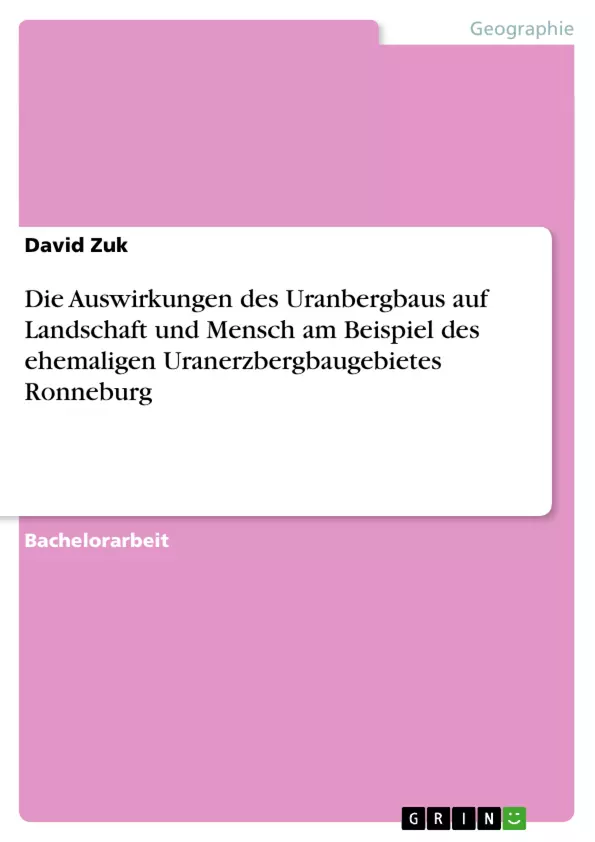In der vorliegenden Arbeit wurde die historische Modifikation der Bodenfunktion Lebensraumfunktion für das Gebiet der „Neuen Landschaft“ in Ronneburg betrachtet. Dabei ergab sich, aufgrund der kleinräumigen Heterogenität der Gebietseinheiten, ein ebenso vielschichtiges Ergebnis. Die nördliche Gessental-Hochfläche zeigt beispielsweise nur eine geringe bis mäßige Veränderung gegenüber der vorbergbaulichen Zeit. Die hier vorgefundenen Böden weisen, aufgrund ihrer Genese und Bestandteile, eine bedeutend höhere Ertragsfähigkeit auf, als die sauren und stauwasserbeeinflussten Böden der Gessentalaue. Zudem bilden sie, aufgrund der noch weitestgehend intakten Bodenhorizontierung, gute Standorte für die Entwicklung kleinräumiger Biotope. Die östliche Gessentalaue (heute „Neues Tal“) hingegen musste differenzierter betrachtet werden. An den nördlichen Hängen hat sich ein über Jahrzehnte bestehender Waldbestand halten können, weshalb diese Bereiche auch heute noch eine mikroklimatische Bedeutung besitzen. Südlich davon wurde der Auenbereich in der Zeit des Bergbaus versiegelt, verdichtet und mit Schadstoffen belastet. Zudem wurde der Badergraben in ein Betonbett gezwungen, womit er seine Funktion als Vorfluter nur noch bedingt wahrnehmen konnte. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurde ein neues Bachbett angelegt und eine neue Auenlandschaft geschaffen. Der Bereich der „Lichtenberger Kanten“ und des „Ronneburger Balkons“ wurde durch die bergbaulichen Tätigkeiten am grundlegendsten verändert, was sich schon in ihrer streng geometrischen Form erkennen lässt. Auf diesen Rohböden sind inzwischen, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, neue Biotope sowie Freizeitbereiche für die Bevölkerung entstanden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhalt
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchungsgebiet „Neue Landschaft“ Ronneburg
- Lage und Klima
- Geologischer Überblick
- Geologie des Untersuchungsgebietes
- Entstehung der Uranlagerstätte von Ronneburg
- Historischer Überblick – Vom Uranbergbau zur BUGA 2007
- Uranerzbergbau in Ostthüringen
- Die SDAG WISMUT
- Sanierung der WISMUT-Hinterlassenschaften
- Gesetzlicher Rahmen für die Sanierung
- Die Sanierungstätigkeit
- Die Bundesgartenschau 2007 in Gera und Ronneburg
- Grundlagen der Bodenfunktionsbewertung
- Bodenschätzung
- Bodenfunktionen im BBodSchG
- Anforderungen zum Vergleich von Bodenbewertungsverfahren
- Verfahren der Bodenfunktionsbewertung als Grundlage für die Betrachtung der Veränderung der Lebensraumfunktion
- Methodisches Vorgehen im Untersuchungsgebiet
- Bodenkundliche Charakteristik der einzelnen Gebietseinheiten
- Profil 1
- Profil 2
- Profil 3
- Profil 4
- Diskussion und Ergebnisse
- Lebensraumfunktion vor 1950
- Lebensgrundlage für Menschen
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen und Bodenorganismen
- Lebensraumfunktion zwischen 1950 und 1991
- Lebensgrundlage für Menschen
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen und Bodenorganismen
- Lebensraumfunktion 1991 bis 2007
- Lebensgrundlage für Menschen
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen und Bodenorganismen
- Lebensraumfunktion vor 1950
- Zukünftige Entwicklung weiterer Bodenfunktionen in der „Neuen Landschaft\" Ronneburg
- Natürliche Bodenfunktionen
- Bestandteil des Naturhaushaltes
- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium
- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
- Natürliche Bodenfunktionen
- Nachbetrachtung und Handlungsempfehlung
- Lebensgrundlage für Menschen
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen und Bodenorganismen
- Zusammenfassung
- Quellen
- Anhang
- Fotos
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des Uranbergbaus auf Landschaft und Mensch am Beispiel des ehemaligen Uranerzbergbaugebietes Ronneburg. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Veränderung der Lebensraumfunktion des Bodens über die Zeit. Die Arbeit untersucht, wie die anthropogenen Eingriffe des Uranbergbaus die Bodenfunktionen beeinflusst haben und welche Auswirkungen dies auf die Lebensgrundlage für Mensch, Pflanze und Bodenorganismen hatte.
- Die Entwicklung der Lebensraumfunktion des Bodens im ehemaligen Uranerzbergbaugebiet Ronneburg
- Die Auswirkungen des Uranbergbaus auf die Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Bodenorganismen
- Die Sanierung der WISMUT-Hinterlassenschaften und ihre Auswirkungen auf die Bodenfunktionen
- Die Rolle der Bundesgartenschau 2007 in Gera und Ronneburg für die zukünftige Entwicklung der „Neuen Landschaft“
- Die Bedeutung der Bodenfunktionsbewertung für die nachhaltige Entwicklung der „Neuen Landschaft“ Ronneburg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Anschließend wird das Untersuchungsgebiet „Neue Landschaft“ Ronneburg vorgestellt, einschließlich seiner Lage, seines Klimas und seiner geologischen Besonderheiten. Das dritte Kapitel beleuchtet den historischen Überblick des Uranbergbaus in Ostthüringen, die Rolle der SDAG WISMUT und die Sanierung der WISMUT-Hinterlassenschaften. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Bodenfunktionsbewertung und stellt verschiedene Verfahren vor, die zur Analyse der Veränderung der Lebensraumfunktion genutzt werden.
In Kapitel 5 werden die bodenkundlichen Charakteristika der einzelnen Gebietseinheiten des Untersuchungsgebietes beschrieben. Kapitel 6 analysiert die Lebensraumfunktion des Bodens in verschiedenen Zeitabschnitten: vor 1950, zwischen 1950 und 1991 sowie von 1991 bis 2007. Das siebte Kapitel befasst sich mit der zukünftigen Entwicklung weiterer Bodenfunktionen in der „Neuen Landschaft“ Ronneburg. Die Arbeit endet mit einer Nachbetrachtung und Handlungsempfehlung sowie einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Uranbergbau, Ronneburg, Lebensraumfunktion, Bodenfunktionsbewertung, Sanierung, WISMUT-Hinterlassenschaften, „Neue Landschaft“, Bundesgartenschau 2007, nachhaltige Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte der Uranbergbau die Landschaft in Ronneburg?
Der Bergbau führte zu massiven Bodenversiegelungen, Schadstoffbelastungen und einer völligen Umgestaltung der Topographie durch Halden und Tagebaue.
Was ist die „Lebensraumfunktion“ des Bodens?
Sie beschreibt die Fähigkeit des Bodens, als Grundlage für Menschen, Pflanzen und Bodenorganismen zu dienen.
Welche Rolle spielte die WISMUT bei der Sanierung?
Die SDAG WISMUT (bzw. die Nachfolgegesellschaft) war verantwortlich für die Dekontamination und Renaturierung der bergbaulichen Hinterlassenschaften.
Was wurde durch die BUGA 2007 in Ronneburg erreicht?
Die Bundesgartenschau markierte den Abschluss wichtiger Sanierungsschritte und schuf die „Neue Landschaft“ als Freizeit- und Naturraum.
Sind die Böden in Ronneburg heute wieder voll nutzbar?
In vielen Bereichen wurden neue Biotope geschaffen, jedoch bleiben einige Flächen aufgrund ihrer Genese als Rohböden in ihrer Ertragsfähigkeit eingeschränkt.
- Quote paper
- B.Sc. David Zuk (Author), 2007, Die Auswirkungen des Uranbergbaus auf Landschaft und Mensch am Beispiel des ehemaligen Uranerzbergbaugebietes Ronneburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168682