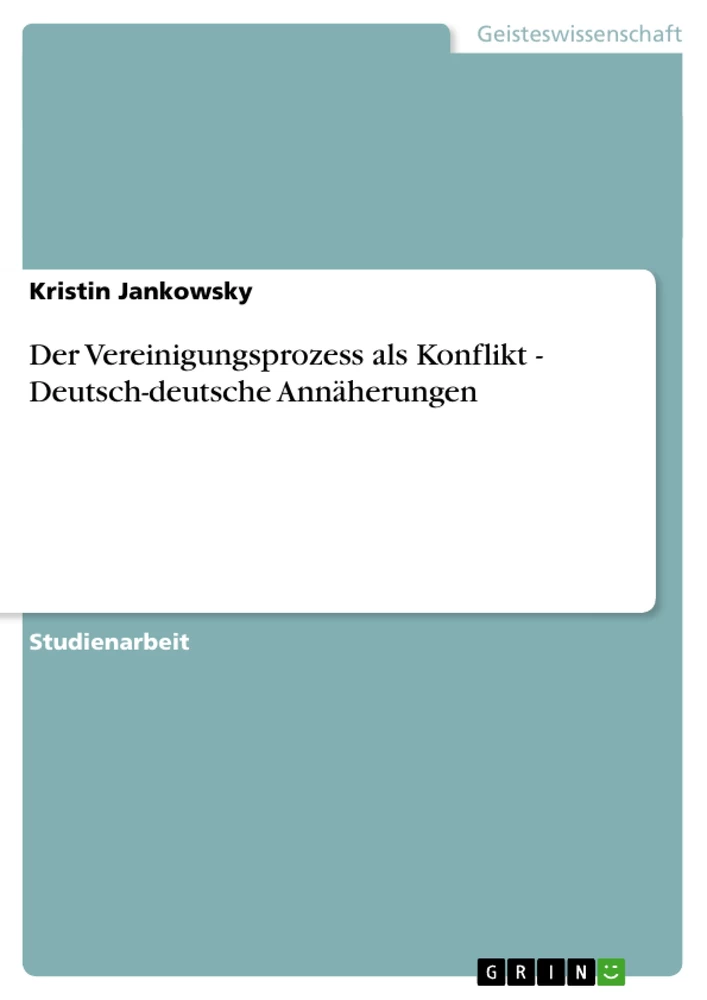Das Wort „Konflikt“ stammt von dem Lateinischen von dem Wort conflictus ab und bedeutet Aneinanderschlagen, Zusammenstoß und im weiteren Sinne Kampf oder Streit. Interpersonelle Konflikte charakterisieren sich durch folgende Eigenschaften:
x Vorhandensein von mindestens zwei Konfliktparteien
x d.h. es existieren zwei oder mehrere Parteien, die sich gegenüberstehen und unterschiedliche Standpunkte einnehmen, wobei das Verhalten der einen Partei Konsequenzen für das Verhalten der anderen Partei nach sich zieht
x Unvereinbarkeit der Handlungstendenzen
x allgemein sind Konflikte durch Handlungsdispositionen gekennzeichnet, welche sich aus der Wirksamkeit subjektiver Interessen (Motive), grundlegender Überzeugungen und Werthaltungen sowie aus den damit zusammenhängenden Erwartungen und Einstellungen erklären
x Unvereinbarkeit des Verhaltens
x dies stellt das direkt beobachtbare Konfliktverhalten dar, wobei Meinungsverschiedenheiten noch nicht dazu gehören, falls sie noch nicht in entsprechendem Interaktionsverhalten manifestiert sind
Selbstverständlich können auch widersprüchliche Handlungstendenzen innerhalb einer Person auftreten. Hier spricht man dann von einem intrapersonalen Konflikt.
likt als Kampf, so daß Konfliktverhalten als Kampfhandlung verstanden werden kann, die je nach Situation und nach der Ausstattung der beteiligten Parteien mit unterschiedlichen Strategien vollzogen wird.
Aus Kapitel IV des Buches „Theorie sozialer Konflikte“ ( Lewis A. Coser ) geht im letzten Abschnitt hervor „Konflikt kann dazu dienen, auflösende Elemente aus einer Beziehung zu entfernen und die Einheit wiederherzustellen...“. Diese These werde ich unter Betrachtung des Themas wieder aufgreifen und untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Begriff „Konflikt“
- Geschichtlicher Hintergrund
- Das Nachkriegsdeutschland (1945 – ca. 1961)
- Der kalte Krieg (1961 – ca. 1980)
- Die Entspannungsphase (1980 – ca. 1989/90)
- Das Ende der DDR und die deutsche Einheit (1989/90)
- Deutschland nach der Wiedervereinigung
- Das deutsch- deutsche Verhältnis
- Die Jugend in Ostdeutschland zehn Jahre nach der Vereinigung
- Möglichkeiten der Konfliktlösung
- Abschlusswort
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Vereinigungsprozess Deutschlands und den damit verbundenen Konflikten. Ziel ist es, die historischen Entwicklungen und das deutsch-deutsche Verhältnis im Kontext des Kalten Krieges und der Wiedervereinigung zu beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung von Konflikten im Kontext der deutschen Teilung
- Das Spannungsverhältnis zwischen Ost und West, die unterschiedlichen Ideologien und die damit verbundenen Machtstrukturen
- Die Rolle von individueller und gesellschaftlicher Konfliktbewältigung im Prozess der Wiedervereinigung
- Die Herausforderungen und Chancen der deutschen Einheit für die Gesellschaft und insbesondere für die Jugend in Ostdeutschland
- Die Analyse von Konfliktlösungsstrategien und die Bedeutung von interpersoneller und intrapersonaler Konfliktbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel erläutert den Begriff des Konflikts und definiert dessen Eigenschaften. Es wird die Unterscheidung zwischen interpersonalen und intrapersonalen Konflikten dargestellt und die Definition von Lewis A. Coser (1965) zum Konfliktverhalten als Kampfhandlung aufgegriffen.
- Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund des deutsch-deutschen Konflikts. Es beschreibt die vier wichtigsten Phasen der gegensätzlichen Regierungen in Ost- und Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnend mit der Nachkriegszeit bis hin zur deutschen Einheit. Dabei wird die Entstehung des Kalten Krieges und die Entwicklung der beiden deutschen Staaten im Kontext der jeweiligen Besatzungsmächte aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Der Text fokussiert auf zentrale Themen und Konzepte wie deutsche Teilung, Kalter Krieg, Wiedervereinigung, Konflikt, Konfliktentwicklung, Konfliktbewältigung, deutsch-deutsches Verhältnis, ostdeutsche Jugend, und Machtstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Begriff „Konflikt“ in dieser Arbeit definiert?
Konflikt wird als Zusammenstoß oder Kampf definiert, der durch unvereinbare Handlungstendenzen und Verhaltensweisen zwischen mindestens zwei Parteien gekennzeichnet ist.
Was ist der Unterschied zwischen interpersonalen und intrapersonalen Konflikten?
Interpersonale Konflikte finden zwischen zwei oder mehr Personen statt, während intrapersonale Konflikte widersprüchliche Tendenzen innerhalb einer einzelnen Person beschreiben.
Welche Phasen der deutsch-deutschen Geschichte werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet das Nachkriegsdeutschland (1945–1961), den Kalten Krieg (1961–1980), die Entspannungsphase (1980–1989) und die Wiedervereinigung.
Welche These von Lewis A. Coser wird untersucht?
Untersucht wird die These, dass Konflikte dazu dienen können, auflösende Elemente aus einer Beziehung zu entfernen und so die Einheit wiederherzustellen.
Wie wird die Situation der Jugend in Ostdeutschland bewertet?
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen für die ostdeutsche Jugend zehn Jahre nach der Wiedervereinigung im Kontext des deutsch-deutschen Verhältnisses.
- Quote paper
- Kristin Jankowsky (Author), 2002, Der Vereinigungsprozess als Konflikt - Deutsch-deutsche Annäherungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16869