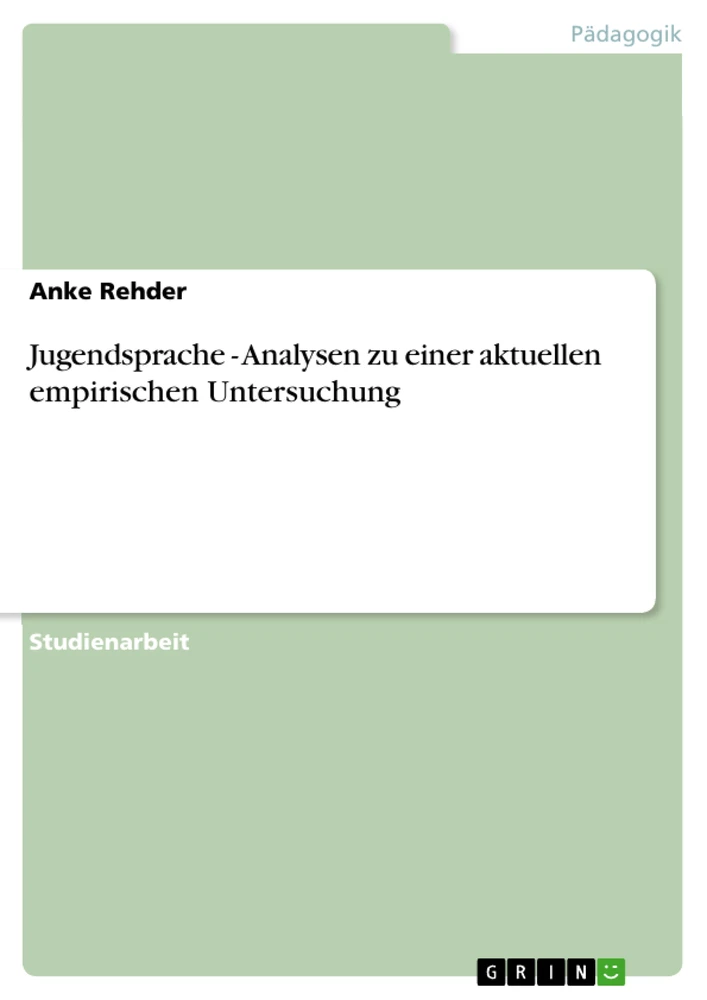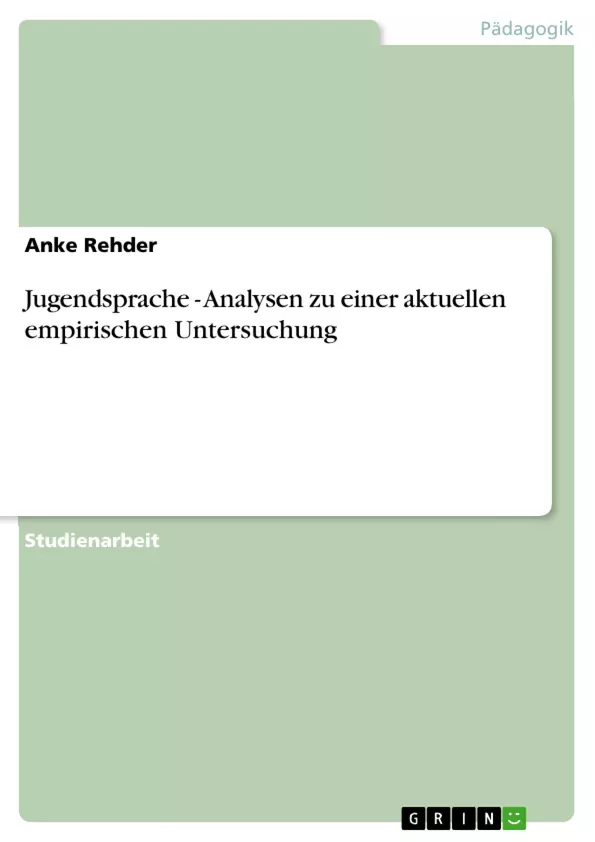Was guckst du? Bin isch Kino oder was?
Die deutsche Sprache hat sich schon immer verändert, aber gerade in den letzten Jahren hat sich eine Diskussion entwickelt, die Sprachwissenschaftler, Erzieher, Lehrer, Eltern und auch die Jugend beschäftigt. Diese Diskussionen beschäftigen sich mit der Jugendsprache und vor allem auch mit der Kanak Sprak, die eine Variation der Jugendsprache ist. Viele haben Angst, dass die deutsche Standardsprache ausstirbt. Denn was soll nur aus ihr werden, wenn die heutige Jugend erwachsen wird und ihr Sprachgut an die Kinder weitergibt? Sagen dann die Schulkinder die oben kursiv gedruckten Sätze, wenn sie sich von der Lehrperson provoziert fühlen? Wird die hochdeutsche Sprache dann von der Sprache der heutigen Jugendlichen geprägt? Wie beispielsweise von der Anredefloskel Alter lan, was gehtn ab bei dir? oder Moinsen Digger, gehs du auch Schule jetzt?
Da auch an mir diese Diskussionen nicht vorbeigegangen sind und ich die Auswirkungen der Jugendsprache häufig in meinem Umfeld miterlebe, war mein Entschluss schnell gefasst, eine Arbeit zu diesem Thema zu schreiben. Gerade weil dieses Thema bei weitem noch nicht so ausgiebig erforscht ist wie andere sprachliche Phänomene und viel zu selten Gegenstand an der Universität oder an der Schule ist, war meine Motivation groß, mehr zu diesem Thema zu erfahren.
Mit meiner Arbeit möchte ich einen Überblick zu dieser sprachlichen Besonderheit geben. Dazu habe ich mich zur Einführung in die Thematik mit einer Definition der Begrifflichkeit „Jugendsprache“ versucht, um anschließend ihre sprachlichen Register und Eigenheiten näher zu beschreiben. Auch die für meine Hausarbeit so wichtige Kanak Sprak hat in Punkt 2.3 mein Interesse geweckt und ich werde versuchen, sie in all ihren Facetten vorzustellen.
Ich möchte in dieser Arbeit außerdem eine eigene empirische Untersuchung vorstellen, die sich mit der Jugendsprache an sich und der Kanak Sprak im Besonderen beschäftigt. Mit diesem Fragebogen wollte ich Faktoren ermitteln, die den Gebrauch dieser Sprachvariationen beeinflussen. Außerdem will ich eine von mir selbst aufgestellte These be- bzw. widerlegen. Die These lautet wie folgt: Deutsche Jugendliche sprechen die Kanak Sprak, um Teil der Gruppe zu werden und so Gruppenzugehörigkeit zu erfahren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung in die Jugendsprache
- 2.1 Versuch der Definition der Jugendsprache
- 2.2 Merkmale und Register der sprachlichen Oberfläche der Jugendsprache
- 2.3 Die Kanak Sprak
- 3. Die empirische Untersuchung
- 3.1 Beschreibung der empirischen Untersuchung
- 3.2 Auswertung der empirischen Untersuchung
- 4. Fazit
- 5. Literatur- und Quellenangaben
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache, insbesondere die „Kanak Sprak“, und deren Einfluss auf die deutsche Standardsprache. Es wird versucht, den komplexen Begriff „Jugendsprache“ zu definieren und die sprachlichen Merkmale dieser Varietät zu beschreiben. Die Arbeit beinhaltet eine eigene empirische Untersuchung, die Faktoren untersucht, welche den Gebrauch dieser Sprachvarianten beeinflussen und eine aufgestellte These überprüft.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Jugendsprache“
- Beschreibung der sprachlichen Merkmale der Jugendsprache und der „Kanak Sprak“
- Darstellung einer empirischen Untersuchung zu den Einflussfaktoren auf den Gebrauch der Jugendsprache
- Analyse der sozialen Funktion der Jugendsprache, insbesondere im Hinblick auf Gruppenzugehörigkeit
- Diskussion des Einflusses der Jugendsprache auf die deutsche Standardsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Jugendsprache und insbesondere die „Kanak Sprak“ ein. Der Autor beschreibt die gesellschaftliche Relevanz der Thematik und die Notwendigkeit einer eingehenderen Untersuchung, da diese Sprachvarietät im wissenschaftlichen Diskurs noch unzureichend behandelt wird. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die Jugendsprache zu geben, ihre sprachlichen Register zu beschreiben und eine eigene empirische Untersuchung vorzustellen, die den Einflussfaktoren auf den Gebrauch dieser Sprachvarianten nachgeht und eine These zur Gruppenzugehörigkeit testet.
2. Einführung in die Jugendsprache: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Jugendsprache und versucht, eine Definition zu erstellen, wobei die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und die Vielfalt der Jugendsprache hervorgehoben werden. Der Autor diskutiert die Herausforderungen, die mit der Definition des Begriffs verbunden sind, und zeigt die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise auf. Der Begriff der „Kanak Sprak“, geprägt von Feridun Zaimoglu, wird ebenfalls eingeführt und in seinen verschiedenen Facetten betrachtet. Die Diskussion um die Definition von „Jugend“ und die Problematik des Trends der ewigen Jugend wird ebenfalls angesprochen.
3. Die empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt und wertet eine empirische Untersuchung des Autors zur Jugendsprache und „Kanak Sprak“ aus. Der Fokus liegt auf der Methodik der Untersuchung und der Auswertung der gewonnenen Daten. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die aufgestellte These – der Gebrauch der „Kanak Sprak“ dient der Gruppenzugehörigkeit – analysiert und diskutiert. Details zur Methodik und den genauen Ergebnissen werden hier nicht im Detail wiedergegeben, um die Arbeit nicht vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Kanak Sprak, Soziolekt, Gruppenzugehörigkeit, empirische Untersuchung, Sprachwandel, Standardsprache, Sprachvariation, Definition, Register.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Jugendsprache und der „Kanak Sprak“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Jugendsprache, insbesondere die „Kanak Sprak“, und deren Einfluss auf die deutsche Standardsprache. Sie untersucht den komplexen Begriff „Jugendsprache“, beschreibt deren sprachliche Merkmale und präsentiert eine eigene empirische Untersuchung zu den Einflussfaktoren auf den Gebrauch dieser Sprachvarianten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Begriffs „Jugendsprache“, die Beschreibung der sprachlichen Merkmale der Jugendsprache und der „Kanak Sprak“, eine empirische Untersuchung zu den Einflussfaktoren auf den Gebrauch der Jugendsprache, die Analyse der sozialen Funktion der Jugendsprache (insbesondere im Hinblick auf Gruppenzugehörigkeit) und die Diskussion des Einflusses der Jugendsprache auf die deutsche Standardsprache.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Einführung in die Jugendsprache (inkl. Definition, Merkmale und „Kanak Sprak“), ein Kapitel zur Beschreibung und Auswertung einer empirischen Untersuchung, ein Fazit, Literatur- und Quellenangaben sowie einen Anhang. Ein Inhaltsverzeichnis ist ebenfalls enthalten.
Was ist das Ziel der empirischen Untersuchung?
Die empirische Untersuchung zielt darauf ab, Faktoren zu identifizieren, die den Gebrauch der Jugendsprache und der „Kanak Sprak“ beeinflussen. Sie überprüft eine These, die besagt, dass der Gebrauch der „Kanak Sprak“ der Gruppenzugehörigkeit dient.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (ohne Details)?
Die Arbeit liefert eine umfassende Analyse der Jugendsprache und der „Kanak Sprak“, einschließlich einer Beschreibung ihrer sprachlichen Merkmale und einer Auswertung der empirischen Untersuchung im Hinblick auf die aufgestellte These. Detaillierte Ergebnisse werden in der Arbeit selbst dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Jugendsprache, Kanak Sprak, Soziolekt, Gruppenzugehörigkeit, empirische Untersuchung, Sprachwandel, Standardsprache, Sprachvariation, Definition, Register.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema Jugendsprache und die „Kanak Sprak“ ein, beschreibt die gesellschaftliche Relevanz und die Notwendigkeit einer eingehenderen Untersuchung dieser Sprachvarietät und skizziert den Aufbau und die Ziele der Arbeit.
Was wird im Kapitel zur Einführung in die Jugendsprache behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Jugendsprache, versucht eine Definition zu erstellen, diskutiert die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und die Vielfalt der Jugendsprache, führt den Begriff „Kanak Sprak“ ein und thematisiert die Definition von „Jugend“ und die Problematik des Trends der ewigen Jugend.
Was wird im Kapitel zur empirischen Untersuchung behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt und wertet eine empirische Untersuchung zur Jugendsprache und „Kanak Sprak“ aus. Der Fokus liegt auf der Methodik und der Auswertung der Daten, die Ergebnisse werden im Hinblick auf die aufgestellte These analysiert. Details zur Methodik und den genauen Ergebnissen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht im Detail wiedergegeben.
- Quote paper
- Anke Rehder (Author), 2009, Jugendsprache - Analysen zu einer aktuellen empirischen Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168925