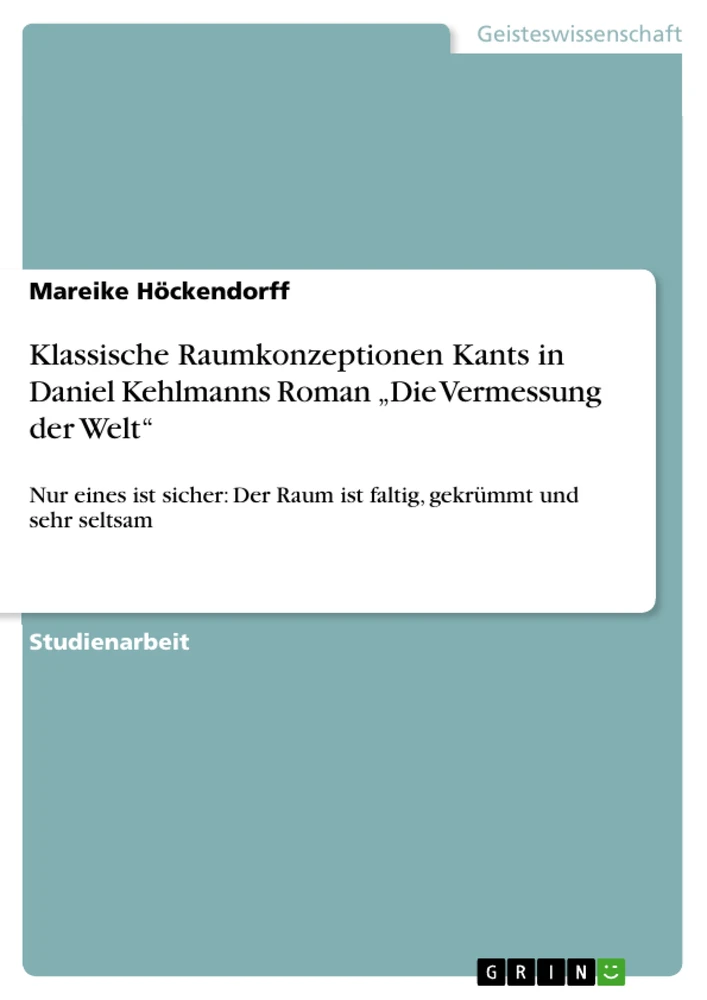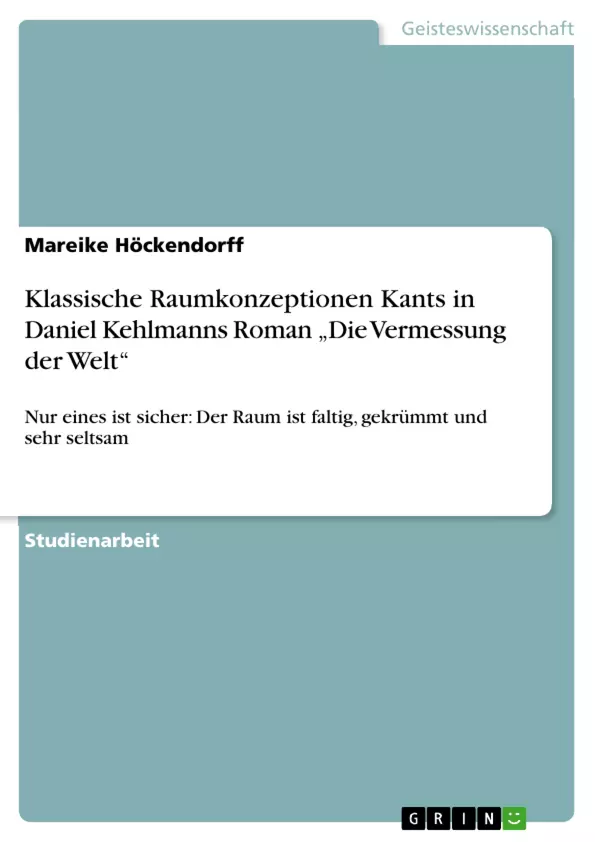Der Raumbegriff hat spätestens in den 1970er Jahren, als ein „Spatial Turn“ für die
Kulturwissenschaften festgestellt wurde, auch in der Philosophie wieder erhöhte Aufmerksamkeit
erhalten. Erneute Beschäftigung mit dem Raum könnte auch erneute Beschäftigung mit klassischer
und moderner Philosophie bedeuten, die sich seit Aristoteles mit Fragen der Räumlichkeit
auseinander setzte. Einer der einflussreichsten Philosophen der klassischen Philosophie auch auf
diesem Gebiet war Immanuel Kant. Er bezog sich auf die Ansätze anderer wichtiger Philosophen
und Wissenschaftler wie zum Beispiel Isaac Newton oder Wilhelm Leibniz, entwickelte diese
weiter und kam so zu einem a priorischen Begriff des Raumes.
Die Literaturwissenschaft hingegen nahm lange Zeit an, dass Räumlichkeit der bildenden Kunst
vorbehalten war, während die Literatur zeitlichen Ordnungsparametern gehorchte (dies besagte
Lessings Laokoon-These von 1766). Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandelte sich diese
Grundannahme zu Gunsten eines Raumwissens in der Literatur. Mit dem oben bereits erwähnten
„Spatial Turn“ setzte dann auch in dieser Wissenschaft eine rege Beschäftigung mit dem Thema
Raum ein. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich allerdings nicht mit Fragen der Räumlichkeit der
Literatur an sich, sondern untersucht, wie die philosophische Diskussion zum Thema Raum in der
Gegenwartsliteratur verarbeitet wird. Literatur wurde als Medium gewählt, da es ein Kulturprodukt
ist, welches stets auch einen Beitrag zu aktuellen Diskursen leisten kann.
Der Roman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann deutet bereits im Titel die enge
Verbindung zum Thema des Raumes an. Greift der Autor aber tatsächlich Gedanken aus der
konzeptionellen Auseinandersetzung mit dem Raumbegriff auf, um diese an seinen Protagonisten
Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt deutlich zu machen?
Da Kant mit seinem a priorischen Raumbegriff der Mathematik, wie sie vom Protagonisten Carl
Friedrich Gauß vertreten wird, eher nahe steht als der empirischen Forschung, die hier an Alexander
von Humboldt gezeigt wird, ist es wahrscheinlich, dass Kehlmann mit Gauß einen Wissenschaftler
beschreibt, der den a priorischen Gedanken der Raumkonzeption verfolgt und umsetzt. Der
Charakter Alexander von Humboldts fungiert aus dieser Perspektive eher als Abgrenzung und zeigt
die Überflüssigkeit seiner eigenen Vorgehensweise, die durch reine Berechnung ersetzt werden
kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze historische Verortung Kants und seines a-priorischen Raumbegriffs
- Der Raumbegriff in „Von dem ersten Unterschiede der Gegenden im Raume“
- Der Raumbegriff in „Von dem Raume“
- Der Raumbegriff in „Was heißt: sich im Denken orientieren?“
- Zwischenfazit
- Der Roman „Die Vermessung der Welt“
- Carl Friedrich Gauß
- Der a priorische Raumgedanke
- Geometrie vor Empirie
- Körper sind Grenzen
- Unwissenheit ist die Schranke der Erkenntnis
- Wo Gauß über Kant hinaus wächst
- Alexander von Humboldt
- Unterschiede von Humboldts Arbeitsweise in Abgrenzung zu Gauß
- Gemeinsamkeiten
- Wertung
- Carl Friedrich Gauß
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Raumbegriffs Immanuel Kants in Daniel Kehlmanns Roman „Die Vermessung der Welt“. Dabei wird untersucht, wie der a priorische Raumgedanke in der Gegenwartsliteratur verarbeitet wird. Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen Kants Raumphilosophie und den Figuren Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt, die im Roman eine zentrale Rolle spielen.
- Der a priorische Raumbegriff Immanuel Kants
- Die Darstellung von Raumkonzepten in der Literatur
- Die Beziehung zwischen Mathematik und empirischer Forschung im Kontext des Raumbegriffs
- Die Bedeutung von Raum in der Kulturgeschichte
- Die Verbindung zwischen Philosophie und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Raumbegriffs in den Kulturwissenschaften und der Philosophie. Sie beleuchtet den "Spatial Turn" und die Rolle der Literatur als Kulturprodukt.
- Kurze historische Verortung Kants und seines a-priorischen Raumbegriffs: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Abriss der historischen Entwicklung des Raumbegriffs und beleuchtet die Ansätze von Descartes, Newton und Leibniz. Es stellt Kants a priorischen Raumbegriff im Kontext der damaligen Philosophie vor.
- Der Raumbegriff in „Von dem ersten Unterschiede der Gegenden im Raume“: Dieses Kapitel analysiert Kants Schrift „Von dem ersten Unterschiede der Gegenden im Raume“ und untersucht seine Argumentation zu den Eigenschaften des Raumes und dessen Beziehung zum Körper. Der a priorische Charakter des Raumbegriffs wird näher beleuchtet.
- Der Roman „Die Vermessung der Welt“: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Romans „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann. Die Figuren Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt werden im Kontext des Raumbegriffs betrachtet. Es wird untersucht, wie Kehlmann Kants Gedanken in seinem Roman verarbeitet.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Raumbegriff, Immanuel Kant, a priori, "Die Vermessung der Welt", Daniel Kehlmann, Carl Friedrich Gauß, Alexander von Humboldt, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaften, Spatial Turn.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Kants a priorischer Raumbegriff?
Kant versteht Raum nicht als etwas Empirisches, sondern als eine notwendige Anschauungsform a priori, die jeder Erfahrung vorausgeht und diese erst ermöglicht.
Wie wird Kants Philosophie in Kehlmanns Roman verarbeitet?
Der Roman „Die Vermessung der Welt“ nutzt die Figuren Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt, um unterschiedliche wissenschaftliche und philosophische Herangehensweisen an den Raum darzustellen.
Welche Rolle spielt Carl Friedrich Gauß im Kontext von Kants Raumbegriff?
Gauß wird im Roman als Wissenschaftler dargestellt, der dem a priorischen Gedanken der Raumkonzeption und der mathematischen Berechnung nähersteht als der reinen Empirie.
Inwiefern grenzt sich Alexander von Humboldt von Gauß ab?
Humboldt repräsentiert die empirische Forschung, die den Raum durch Vermessung und Erfahrung erfassen will, was im Roman oft als Kontrast zur theoretischen Brillanz von Gauß dient.
Was bedeutet der „Spatial Turn“ für die Literaturwissenschaft?
Der „Spatial Turn“ markiert eine Wende in den Kulturwissenschaften, bei der die Bedeutung des Raumes (statt nur der Zeit) in der Literatur und Philosophie verstärkt in den Fokus rückte.
Welche Schriften Kants werden in der Arbeit zur Analyse herangezogen?
Analysiert werden unter anderem „Von dem ersten Unterschiede der Gegenden im Raume“ und „Was heißt: sich im Denken orientieren?“.
- Quote paper
- Mareike Höckendorff (Author), 2010, Klassische Raumkonzeptionen Kants in Daniel Kehlmanns Roman „Die Vermessung der Welt“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169225