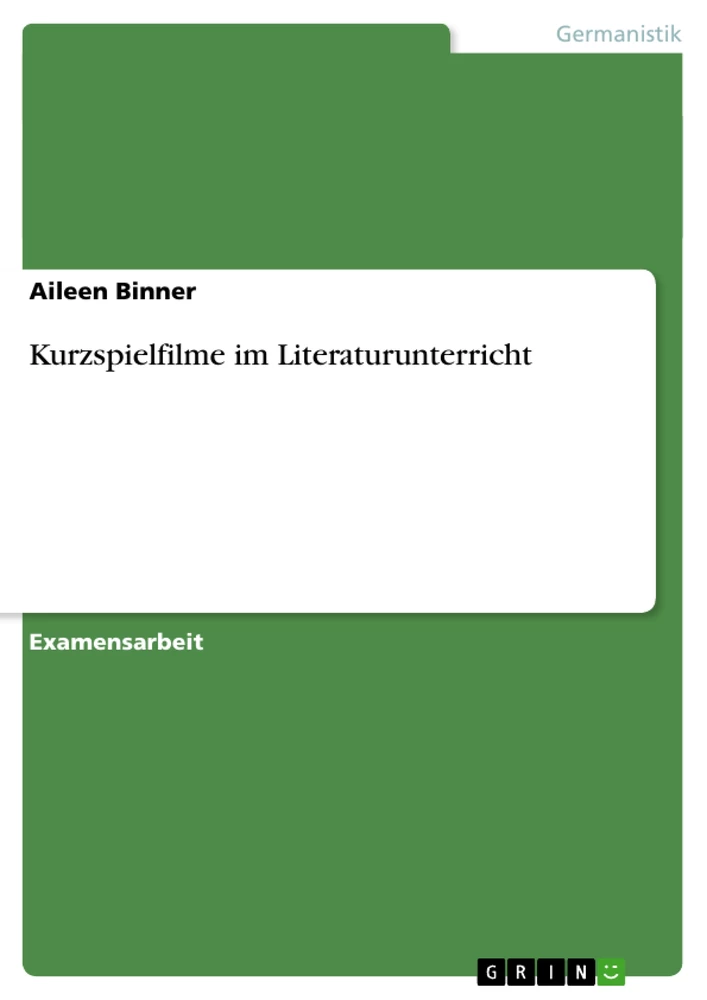Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Zielen und Perspektiven einer umfassenden Spielfilmbildung im Deutschunterricht. Die schulische Spielfilmbildung kann, entgegen den Befürchtungen medienkritischer Lehrpersonen, SchülerInnen einen reflektierten und lustvollen Umgang mit alten und neuen Medien ermöglichen.
Gezielt wird der Frage nachgegegangen, welche Möglichkeiten und Grenzen sich bei der Einbindung von Kurzspielfilmen in den Literaturunterricht zeigen. In der letzten Zeit betonen einige
Didaktiker, dass der Kurzspielfilm in besonderem Maße für den Literaturunterricht geeignet sei – und doch ist die Liste der Publikationen speziell zu diesem Thema bis dato spärlich.
In der Tat können Kurzspielfilme den Unterricht bereichern – sie stehen für eine Ästhetik abseits des Mainstream-Kinos, an ihnen können exemplarisch Aspekte der Filmsprache besprochen werden.
Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer äußeren Kürze gut in den Unterrichtsalltag zu integrieren.
Während in den letzten Jahren einige Schlagwörter der Mediendidaktik und -pädagogik – wie Medien- und Spielfilmkompetenz, Wahrnehmungsschulung und Filmerleben – den Diskurs über die
schulische Filmbildung bestimmt und erweitert haben, lassen sich darüber hinaus weitere genuin literaturdidaktische Konzepte mit zentralen Aspekten der Filmdidaktik verbinden. Die Literarische und Ästhetische Bildung der SchülerInnen, ihre Fähigkeit zum
Fremdverstehen und zum reflektierten Umgang mit Fiktionalität sowie ihre rezeptive und aktive Narrative Kompetenz können auch anhand von Kurzspielfilmen geschult und weiterentwickelt werden.
Diese Arbeit enthält auch einige Überlegungen zu möglichen Unterrichtsmethoden für den Umgang mit (Kurz)-Spielfilmen.
Die sinnvolle Verbindung kreativer, gestaltender Verfahren mit Aspekten der Filmanalyse soll im vierten Kapitel im Vordergrund stehen. Hierfür wurden verschiedene Analyseschemata und Hilfsmittel hinsichtlich ihrer Eignung für den Literaturunterricht geprüft.
Die im letzten Kapitel präsentierten Unterrichtsvorschläge sind als
Anregung für den methodengeleiteten, schülerzentrierten Umgang mit Kurzspielfilmen zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Vorspann
- 2. Kurzspielfilm: Gattungsreflexion
- 2.1 Eine Frage der Länge?
- 2.2 Besonderheiten der Narration
- 2.2.1 Handlungsgerüst
- 2.2.2 Erzählperspektive
- 2.2.3 Charaktere und Charakterisierung
- 2.3 Produktionskontext und Ästhetik
- 2.4 Zugänge und Stellenwert - die „, unsichtbare Gattung”
- 2.5 Zwischenfazit
- 3. Ziele und Perspektiven der Filmdidaktik
- 3.1 Mediendidaktische Schwerpunkte
- 3.1.1 Medienkompetenz
- 3.1.2 Spielfilmkompetenz
- 3.1.3 Wahrnehmungsschulung
- 3.1.4 Filmerleben
- 3.2 Ästhetische Bildung und Literarisches Lernen
- 3.2.1 Identität und Alterität
- 3.2.2 Narrative Kompetenz
- 3.2.3 Realitäts-Fiktionalitäts-Unterscheidungskompetenz
- 3.3 Zwischenfazit
- 3.1 Mediendidaktische Schwerpunkte
- 4. Zugänge und methodische Vorüberlegungen
- 4.1 Filmanalyse
- 4.1.1 Funktionen
- 4.1.2 Vorgehensweisen und Analyseschemata
- 4.1.3 Instrumentarium und Hilfsmittel
- 4.1.4 Grenzen der analytischen Filmbetrachtung
- 4.2 Der Produktive Literaturunterricht und Spielfilmbildung
- 4.2.1 Eine produktive Hermeneutik
- 4.2.2 Imaginationsfördernde Verfahren
- 4.2.3 Selbsterfahrung durch Kunst: Die Kreative Rezeption
- 4.3 Zwischenfazit
- 4.1 Filmanalyse
- 5. Unterrichtsvorschläge
- 5.1 Begründung der Filmauswahl
- 5.2 Zenit (2007)
- 5.2.1 Filmografische Daten
- 5.2.2 Inhalt
- 5.2.3 Didaktische Analyse
- 5.2.4 Didaktische Intention
- 5.2.5 Vorgehen und Methoden
- 5.3 Zur Zeit verstorben (2003)
- 5.3.1 Filmografische Daten
- 5.3.2 Inhalt
- 5.3.3 Didaktische Analyse
- 5.3.4 Didaktische Intention
- 5.3.5 Vorgehen und Methoden
- 5.4 Meine Eltern (2003)
- 5.4.1 Filmografische Daten
- 5.4.2 Didaktische Analyse
- 5.4.3 Didaktische Intention
- 5.4.4 Vorgehen und Methoden
- 5.5 Reflexion und Zwischenfazit
- 6. Abspann
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kurzspielfilmen in den Literaturunterricht. Sie befasst sich mit der Frage, wie Kurzfilme dazu beitragen können, Schülerinnen und Schüler in ihrer Medienkompetenz zu stärken, ihre Wahrnehmung zu schulen und ihre ästhetische Bildung zu fördern.
- Kurzspielfilme als Medium für die Entwicklung von Medienkompetenz und Spielfilmkompetenz
- Die Rolle von Kurzfilmen in der ästhetischen Bildung und im literarischen Lernen
- Methodische Zugänge zur Filmanalyse und zur kreativen Rezeption von Kurzfilmen
- Didaktische Intentionen und konkrete Unterrichtsvorschläge zur Einbindung von Kurzspielfilmen im Unterricht
- Die Bedeutung der Filmsprache und der narrativen Möglichkeiten von Kurzfilmen für die Interpretation literarischer Texte
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel stellt die Problematik der Einbindung von Filmen in den Literaturunterricht dar und beleuchtet die Relevanz von Filmbildung in der heutigen Zeit. Das zweite Kapitel widmet sich einer ausführlichen Gattungsreflexion des Kurzspielfilms und untersucht dessen spezifische Merkmale, seinen Produktionskontext und seinen Stellenwert in der Filmwelt. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Zielen und Perspektiven der Filmdidaktik, insbesondere mit den Schwerpunkten Medienkompetenz, Spielfilmkompetenz, Wahrnehmungsschulung und Filmerleben. In Kapitel 4 werden verschiedene methodische Zugänge zur Filmanalyse und zur produktiven Rezeption von Kurzfilmen vorgestellt. Schließlich werden in Kapitel 5 konkrete Unterrichtsvorschläge für die Einbindung von Kurzspielfilmen in den Literaturunterricht präsentiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kurzspielfilm, Filmdidaktik, Medienkompetenz, Spielfilmkompetenz, Filmanalyse, produktive Rezeption, ästhetische Bildung, literarisches Lernen, narrative Kompetenz, Unterrichtsvorschläge.
Häufig gestellte Fragen
Warum eignen sich Kurzspielfilme besonders gut für den Deutschunterricht?
Aufgrund ihrer Kürze lassen sie sich ideal in eine Unterrichtsstunde integrieren und bieten eine Ästhetik abseits des Mainstream-Kinos, an der Filmsprache exemplarisch gelernt werden kann.
Was versteht man unter „Spielfilmkompetenz“?
Es ist die Fähigkeit, Filme reflektiert wahrzunehmen, ihre narrative Struktur zu verstehen und sich kritisch mit audiovisuellen Medien auseinanderzusetzen.
Wie kann die Filmanalyse im Unterricht methodisch umgesetzt werden?
Durch den Einsatz von Analyseschemata, die Verbindung mit kreativen Verfahren (produktiver Literaturunterricht) und die Schulung der Wahrnehmung.
Welche literaturdidaktischen Konzepte lassen sich auf Filme übertragen?
Dazu gehören das Fremdverstehen (Identität und Alterität), die narrative Kompetenz sowie der reflektierte Umgang mit Fiktionalität.
Welche Kurzfilme werden in der Arbeit als Unterrichtsbeispiele genannt?
Die Arbeit präsentiert Unterrichtsvorschläge zu den Filmen „Zenit“ (2007), „Zur Zeit verstorben“ (2003) und „Meine Eltern“ (2003).
- Quote paper
- Aileen Binner (Author), 2010, Kurzspielfilme im Literaturunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169226