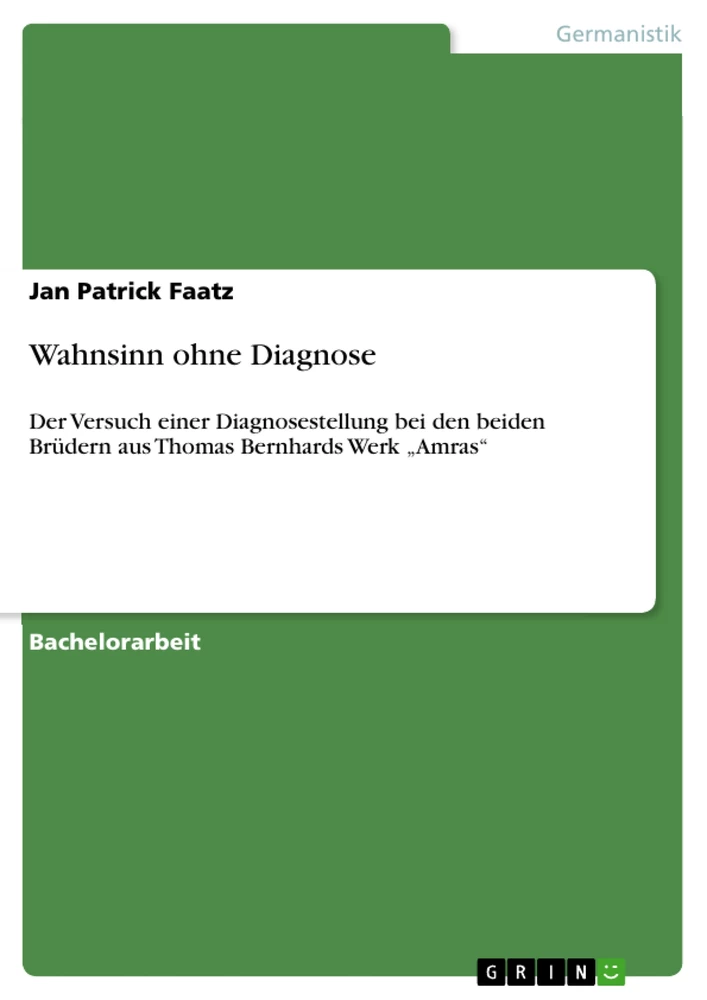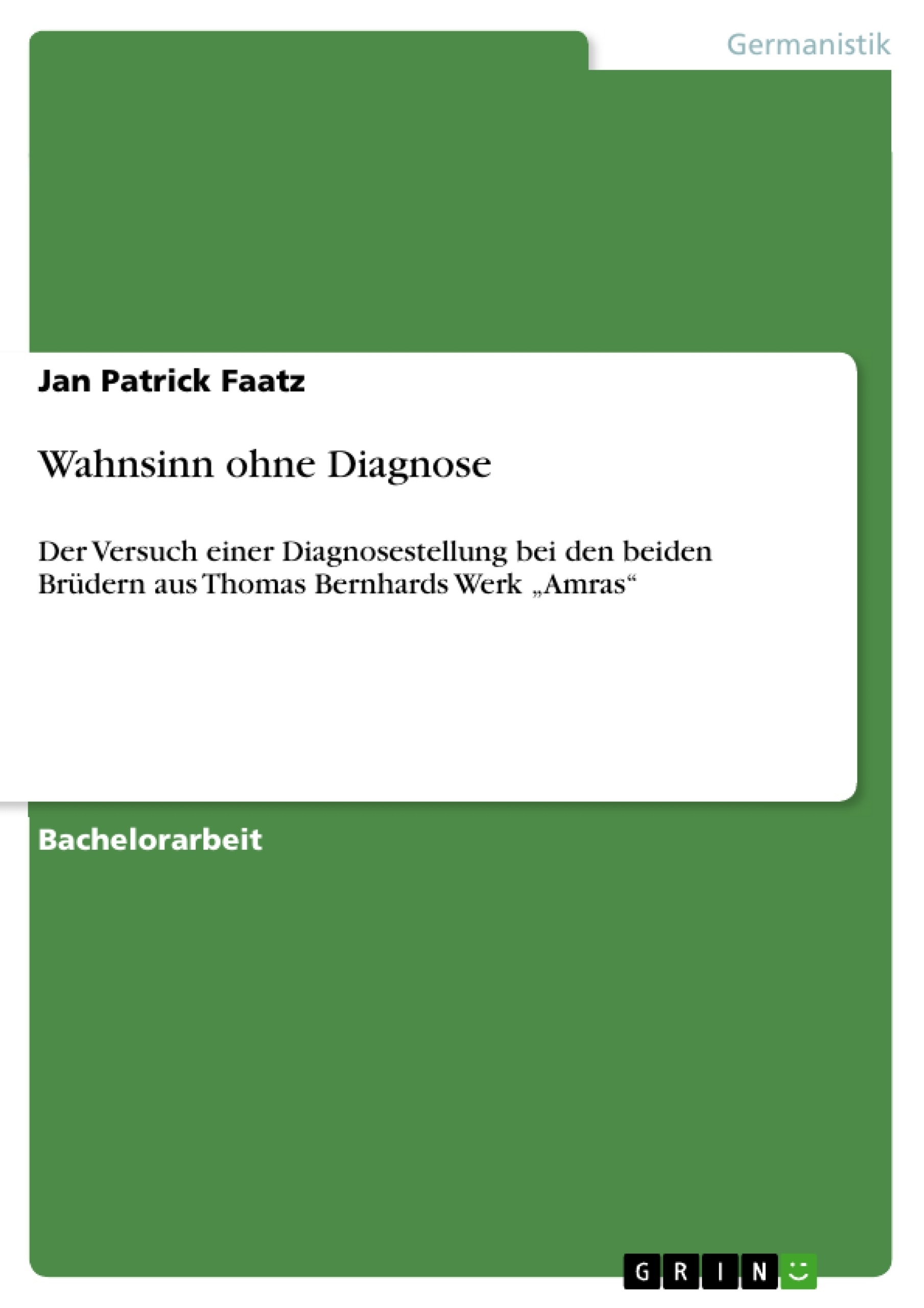In Thomas Bernhards Bücher spielen Krankheit, Tod, Verderben und Selbstmord sowie zwischenmenschliche Kälte und Grausamkeiten eine große Rolle. Krankheit ist im Bernhardschen Werk omnipräsent, denn nahezu alle Menschen leiden unter der einen oder anderen Krankheit. Eine Einteilung in "Gesunde" und "Kranke" lässt sich oft nicht vornehmen, lediglich der Grad der Krankheit unterscheidet die Personen. Einige sind nur leicht kränklich, andere leiden an einer schweren "Todeskrankheit". Es sind aber nicht nur die Menschen krank, sondern die gesamte erzählte Welt scheint von Schmerzen und Sinnlosigkeit zerfressen, alles ist unabänderlich krank. Bernhards Faszination für das Thema durchzieht wie ein Leitfaden sämtliche seiner Werke und ist insbesondere an den beiden Brüdern aus dem Roman AMRAS, den Bernhard selbst als sein "Lieblingsbuch" bezeichnet hat, gut zu sehen. In dieser Arbeit möchte ich näher auf die Krankheitsdarstellung der Brüder Karl und Walter aus dem 1962 veröffentlichten Werk eingehen. Lässt sich anhand der von Bernhard beschriebenen Symptome eine Diagnose stellen? Leiden die beiden Brüder an einer realen Krankheit oder mischt sich der Autor aus den verschiedensten Symptomen einen passenden Krankheitscocktail ganz nach seinen Bedürfnissen zusammen? Diesen Fragen soll mithilfe moderner diagnostischer Kriterien des DIAGNOSTISCHEN UND STATISTISCHEN HANDBUCHES PSYCHISCHER STÖRUNGEN (DSM)nachgegangen werden. Neben dem Blick auf die Diagnosestellung soll immer auch untersucht werden, was Bernhard mit seinen Krankheitsbeschreibungen ausdrücken möchte. Hierbei steht insbesondere die Frage im Vordergrund, ob (und wenn ja, in welcher Weise) die Krankheiten als Metapher gemeint sind. Für diese Fragestellung wird sowohl auf Novalis' Ausführungen zur Krankheit als auch auf Antonovskys Modell der Salutogenese eingegangen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Forschungsüberblick
- Inhalt des Romans
- Teil I - Novalis, Brown und Antonovsky
- Erhebung des Kohärenzgefühls bei Karl
- Brownismus und Novalis
- Der Stheniker
- Der Astheniker
- Eine Welt voller Stheniker
- Teil II – Krankheit und Verderben
- Die Tiroler Epilepsie
- Realistik in der Krankheitsbeschreibung?
- Die Tiroler Epilepsie als Teil der literarische Tradition
- Der Epileptikersessel
- Die Geisteskrankheit ....
- Anamnese Sammlung der Symptome
- Der Weg zur Diagnose
- Charakteristische Schizophreniesymptome
- Charakteristische Symptome einer Depression
- Das Bild der Ärzte
- Teil III – Uns alle beschämende Zustände
- Ein Plädoyer für die Antipsychiatrie ?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Index
- Diagnosestellung der Krankheiten der Brüder Karl und Walter in "Amras" mithilfe des DSM
- Analyse der Krankheitsbeschreibungen im Hinblick auf Bernhards künstlerische Absicht
- Untersuchung der Frage, ob die Krankheiten als Metaphern verwendet werden
- Einbezug der Konzepte von Novalis und Antonovskys Modell der Salutogenese
- Beurteilung der Rolle von Krankheit und Verderben im Werk von Thomas Bernhard
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Krankheitsdarstellung der Brüder Karl und Walter im Roman "Amras" von Thomas Bernhard. Das Ziel ist es, anhand der beschriebenen Symptome eine Diagnose zu stellen und zu untersuchen, ob Bernhard reale Krankheiten darstellt oder einen fiktiven Krankheitscocktail zusammenmischt. Die Analyse berücksichtigt dabei sowohl die moderne diagnostische Kriterien des DSM als auch Bernhards künstlerische Absicht, die Krankheit als Metapher zu verwenden.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Krankheit im Werk von Thomas Bernhard ein und beleuchtet die Präsenz von Krankheit, Tod und Verderben in seinen Büchern. Die Arbeit konzentriert sich auf die beiden Brüder aus "Amras", die Bernhard als seine "Lieblingsfiguren" bezeichnet. Das Kapitel beleuchtet die Frage, ob die Krankheit der Brüder realistisch dargestellt ist oder ob Bernhard sie als metaphorische Elemente einsetzt.
Der Forschungsüberblick beleuchtet die aktuelle Forschung zu Krankheit und Geisteskrankheit in der Literatur, insbesondere im Werk von Thomas Bernhard. Der Teil "Inhalt des Romans" gibt eine kurze Zusammenfassung des Romans "Amras" und stellt die zentralen Figuren vor.
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit dem Kohärenzgefühl von Karl, dem Einfluss von Brownismus und Novalis auf die Krankheitsdarstellung sowie den Begriffen Stheniker und Astheniker.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der "Tiroler Epilepsie" und der Frage, ob die Krankheit realistisch dargestellt ist. Es wird diskutiert, ob die Krankheit in Bernhards Werk Teil einer literarischen Tradition ist und die Bedeutung des "Epileptikersessels" analysiert.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Bernhards Darstellung der Krankheit als ein Plädoyer für die Antipsychiatrie gelesen werden kann.
Schlüsselwörter (Keywords)
Thomas Bernhard, "Amras", Krankheit, Geisteskrankheit, Diagnose, DSM, Novalis, Antonovsky, Salutogenese, Metapher, Literaturanalyse, Antipsychiatrie.
Häufig gestellte Fragen
Welches Werk von Thomas Bernhard steht im Fokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Roman „Amras“ von 1962, den Bernhard selbst als eines seiner Lieblingsbücher bezeichnete.
Was ist das Ziel der medizinischen Analyse in der Arbeit?
Mithilfe des DSM (Diagnostisches Handbuch psychischer Störungen) soll untersucht werden, ob sich für die Brüder Karl und Walter eine reale Diagnose stellen lässt.
Welche Rolle spielt die „Tiroler Epilepsie“ im Roman?
Sie ist eine zentrale Krankheitsdarstellung, die sowohl im Hinblick auf ihre Realistik als auch auf ihre literarische Tradition hinterfragt wird.
Wird die Krankheit bei Bernhard als Metapher verwendet?
Die Arbeit untersucht, inwiefern Bernhards Krankheitsbeschreibungen Metaphern für eine kranke, sinnlose Welt und menschliche Kälte sind.
Welche philosophischen Konzepte werden zur Analyse herangezogen?
Es werden Novalis' Ausführungen zur Krankheit sowie Antonovskys Modell der Salutogenese (Kohärenzgefühl) einbezogen.
- Citar trabajo
- Jan Patrick Faatz (Autor), 2011, Wahnsinn ohne Diagnose, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169926