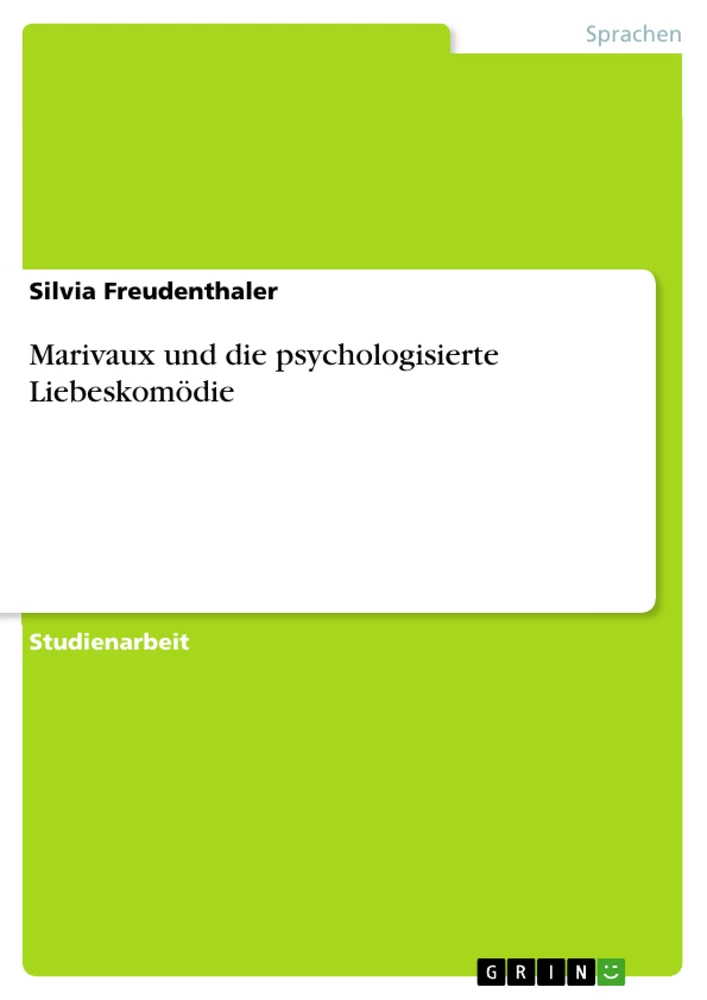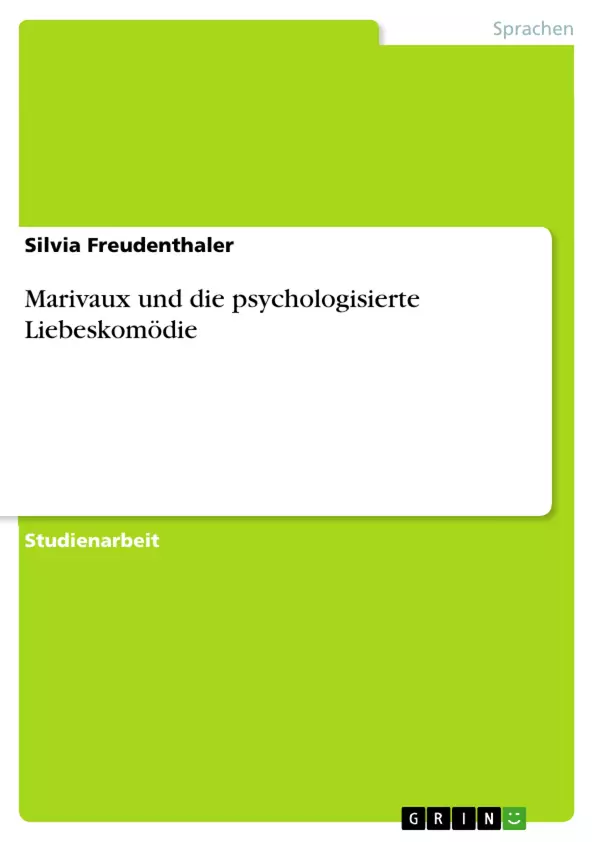Es mag dem heutigen Leser oder Theaterbesucher normal erscheinen, dass in Komödien die handelnden Figuren mehrere, oft auch widersprüchliche Charaktereigenschaften besitzen. Doch war eine psychologische Darstellung in dieser Gattung lange Zeit keine Selbstverständlichkeit. Eine Analyse von Marivaux` Werk soll nun aufzeigen, in wieweit dieses den typologischen Figuren die Maske vom Gesicht nahm und ihnen statt derer mehrere Charakterzüge und vor allem auch damit verbundene Gefühlsunsicherheiten zusprach.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pierre Chamblain de Marivaux: Autor und Werk im historischen Kontext.
- Die Commedia dell'arte: Masken in Paris
- Das Théâtre Italien
- Die Masken der Commedia dell'arte
- La Double Inconstance..
- Die Differenz zwischen dem Gemeinten und Gesagten
- Inhalt, Figurenkonstellation und Aufbau
- Die Intrige als Selbstfindungsprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der psychologisierten Liebeskomödie von Pierre Chamblain de Marivaux und untersucht, inwiefern seine Werke von der traditionellen typologischen Figurenkonzeption der Commedia dell'arte abweichen. Das Ziel ist es, die Entwicklung der Charakterisierung in Marivaux' Stücken aufzuzeigen und die Bedeutung der Selbstfindungsprozesse seiner Figuren zu beleuchten.
- Die Entwicklung der Charakterisierung in Marivaux' Komödien
- Der Einfluss der Commedia dell'arte auf Marivaux' Werk
- Die Bedeutung der Selbstfindungsprozesse in Marivaux' Stücken
- Die Psychologie der Figuren in Marivaux' Komödien
- Die Rolle der Intrige in Marivaux' Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der psychologisierten Liebeskomödie ein und stellt die Besonderheiten von Marivaux' Werk im Kontext der klassischen französischen Komödientradition dar. Kapitel 2 beleuchtet Marivaux' Leben und Werk im historischen Kontext, wobei die Bedeutung seiner Ausbildung, seiner Zeit in den Salons und seiner gesellschaftlichen Stellung hervorgehoben werden. Kapitel 3 widmet sich der Commedia dell'arte, ihrer Geschichte in Frankreich und ihrem Einfluss auf Marivaux' Stücke. Kapitel 4 analysiert Marivaux' Komödie "La Double Inconstance" und untersucht die Differenz zwischen dem Gemeinten und Gesagten, die Figurenkonstellation, den Aufbau und die Intrige als Selbstfindungsprozess.
Schlüsselwörter
Marivaux, Liebeskomödie, Commedia dell'arte, Selbstfindung, Intrige, Psychologie, Charakterisierung, Figurenkonstellation, Théâtre Italien, La Double Inconstance.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Marivaux und was zeichnet sein Werk aus?
Pierre Chamblain de Marivaux war ein französischer Autor, der die Komödie durch eine psychologische Darstellung der Figuren revolutionierte, indem er ihnen widersprüchliche Charakterzüge und Gefühlsunsicherheiten zusprach.
Wie unterscheidet sich Marivaux von der traditionellen Commedia dell'arte?
Während die Commedia dell'arte auf starren Masken und Typen basierte, nahm Marivaux seinen Figuren die symbolische Maske ab und ersetzte sie durch komplexe psychologische Profile.
Welches Stück wird in der Analyse besonders betrachtet?
Die Arbeit analysiert intensiv die Komödie „La Double Inconstance“ (Die doppelte Unbeständigkeit) im Hinblick auf Figurenkonstellation und Aufbau.
Welche Rolle spielt die Intrige in Marivaux' Stücken?
Die Intrige dient bei Marivaux oft als Katalysator für einen Selbstfindungsprozess der Figuren, bei dem die Differenz zwischen dem Gesagten und dem tatsächlich Gemeinten deutlich wird.
Was bedeutet der Begriff „Marivaudage“?
Obwohl nicht explizit im Abstract genannt, bezieht sich die Arbeit auf diesen Stil der geistreichen, psychologisch nuancierten Liebesgespräche, der typisch für Marivaux' psychologisierte Komödien ist.
- Quote paper
- Silvia Freudenthaler (Author), 2009, Marivaux und die psychologisierte Liebeskomödie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170284