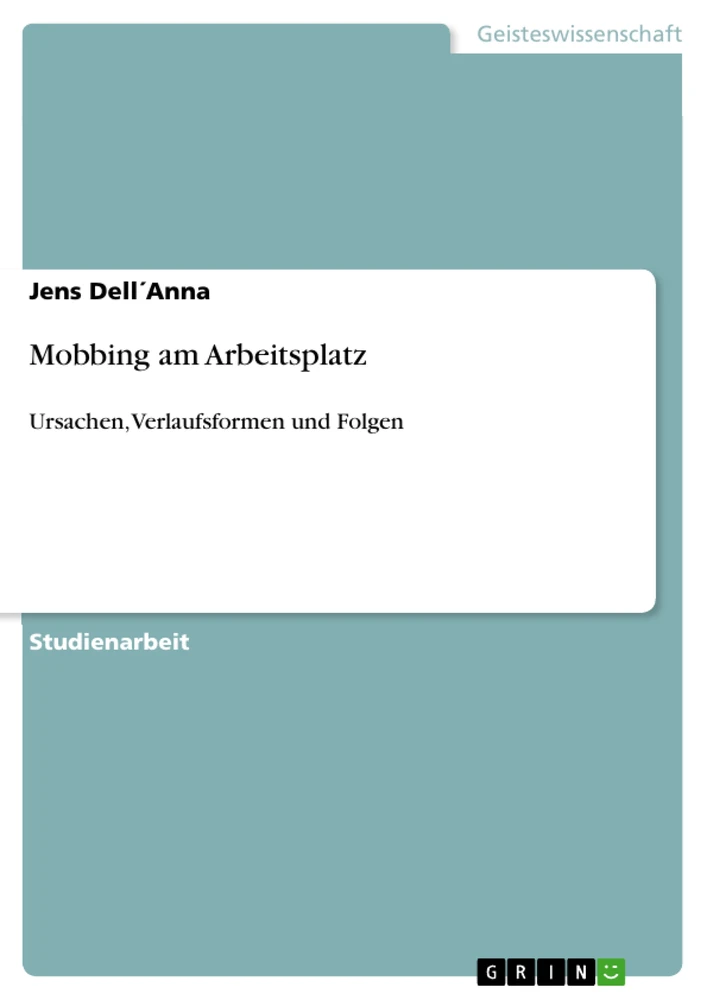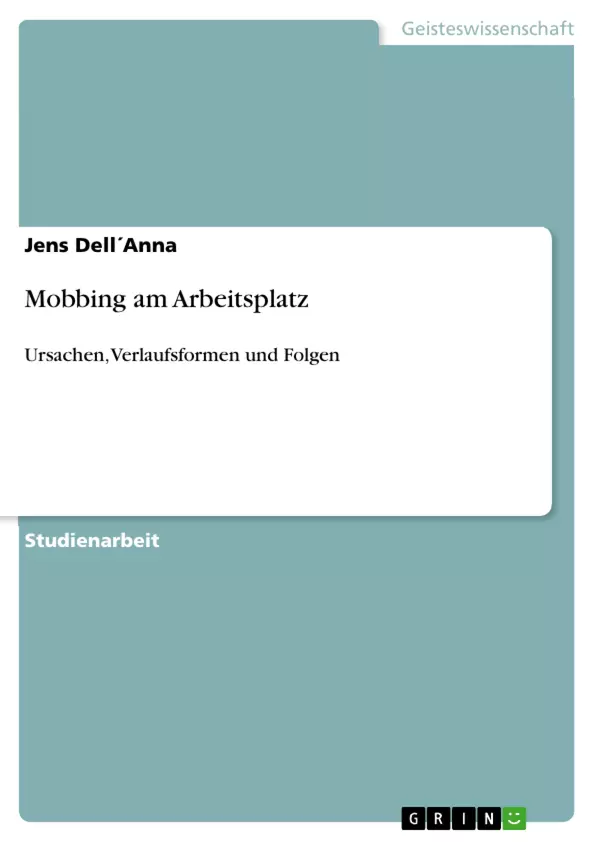In der heutigen Gesellschaft und vor allem in der Arbeitswelt, ist Mobbing ein weit verbreiteter Begriff. Vor noch 15 Jahren war dieser Begriff kaum bekannt, obwohl es auch schon damals diese Art von Diskriminierung gab. Nach Auswertung einer Repräsentativstudie aus dem Jahre 2002 (Meschkutat, Stackelberg & Langenhoff, 2002) wurde
festgestellt, dass jede neunte Person im erwerbsfähigen Alter, schon mal von Mobbinghandlungen betroffen war. Daraus abgeleitet stellt sich die Frage, was überhaupt Mobbing ist und wie sich Mobbing auf den Arbeitsplatz auswirkt. Im nachfolgenden Text wird Mobbing beschrieben und die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass es sich hierbei nicht um eine Aktivität, sondern vielmehr um einen Prozess handelt. Ferner werden in Kapitel 2 theoretische Grundlagen erklärt, die das Verständnis der unterschiedlichen Handlungstypen von Mobbing erleichtern. In Kapitel 3 werden auf die Ursachen, Verlaufsphasen und
die daraus resultierenden Folgen eingegangen. Nach der anschließenden
Zusammenfassung in Kapitel 4, wird zu den Auslösefaktoren, in Anlehnung an die Untersuchungsergebnisse von LEYMANN aus dem Jahre 1994, Stellung genommen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen von Mobbing
2.1 Definitionen von Mobbing
2.2 Fünf Handlungstypen von Mobbing
3. Ursachen, Verlauf und Folgen von Mobbing am Arbeitsplatz
3.1 Ursachen von Mobbing
3.2 Verlaufsphasen des Mobbing
3.3 Folgen von Mobbing
4. Zusammenfassung und Stellungnahme
Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobbing am Arbeitsplatz definiert?
Mobbing wird nicht als einmalige Aktivität, sondern als ein systematischer Prozess der Diskriminierung und Schikane über einen längeren Zeitraum verstanden.
Wie viele Menschen sind statistisch von Mobbing betroffen?
Laut einer Repräsentativstudie aus dem Jahr 2002 war etwa jede neunte Person im erwerbsfähigen Alter bereits einmal von Mobbinghandlungen betroffen.
Was sind die fünf Handlungstypen von Mobbing?
Nach Leymann lassen sich Mobbinghandlungen in fünf Kategorien unterteilen, die von Angriffen auf die Kommunikation bis hin zu Angriffen auf die Gesundheit reichen.
Welche Phasen durchläuft ein typischer Mobbingprozess?
Mobbing verläuft meist in mehreren Phasen, beginnend bei ungelösten Konflikten über die Ausweitung der Schikanen bis hin zum möglichen Ausschluss aus dem Arbeitsleben.
Welche Folgen hat Mobbing für die Betroffenen?
Die Folgen sind gravierend und reichen von psychischen Belastungen und psychosomatischen Erkrankungen bis hin zum dauerhaften Verlust des Arbeitsplatzes.
- Quote paper
- Jens Dell´Anna (Author), 2010, Mobbing am Arbeitsplatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170445