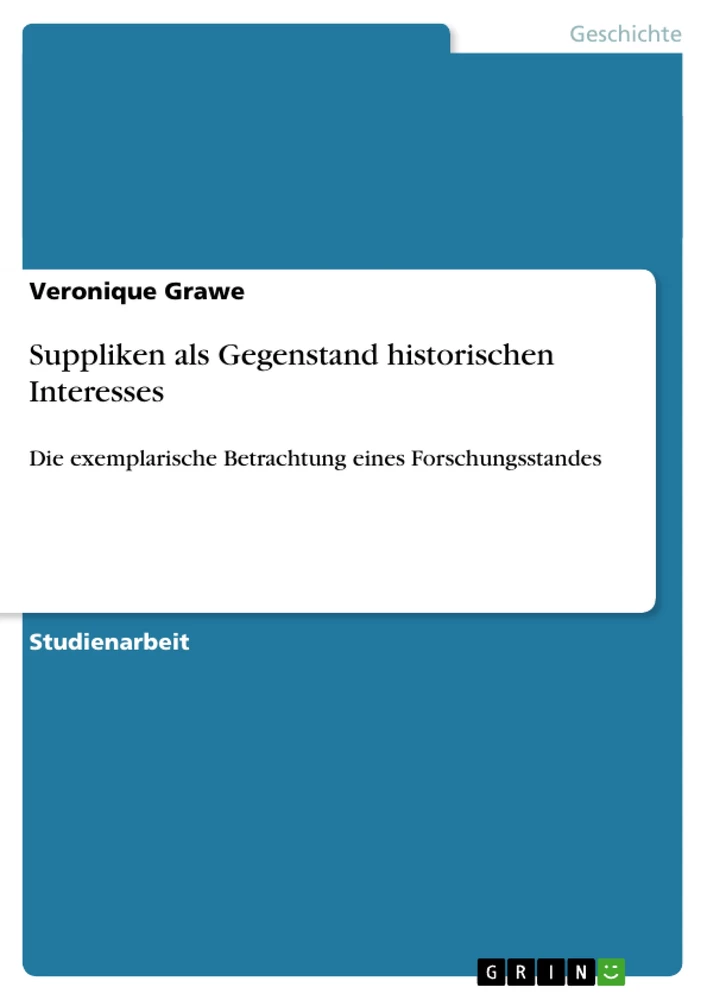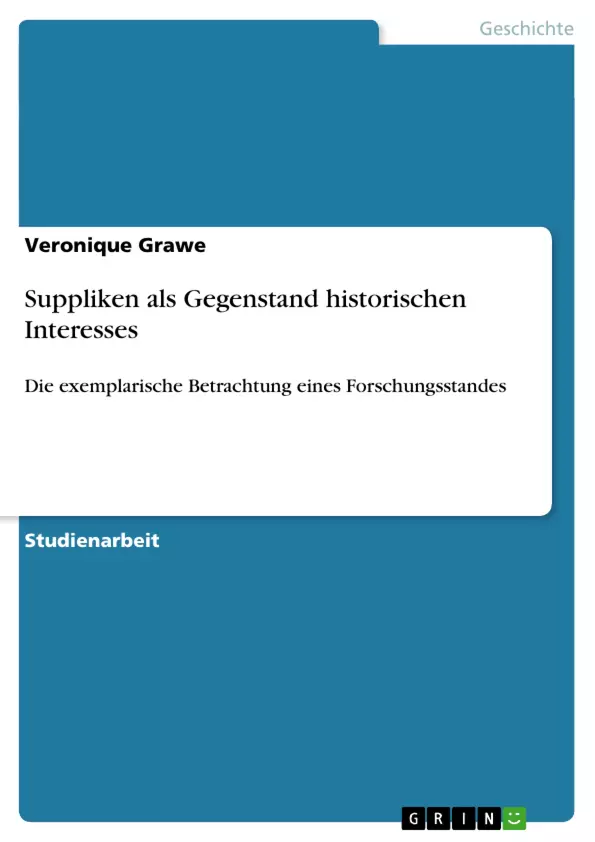Artikel 17 des Bonner Grundgesetzes vom 24.05.1949 garantiert das Petitionsrecht in der Bundesrepublik Deutschland wie folgt: „Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“ Empfänger der jeweiligen Petitionen ist der Petitionsausschuss des Bundestages, dessen Tätigkeit mit dem Artikel 45c in das Grundgesetz aufgenommen wurde. Mit jeder dieser schriftlich verfassten Beschwerden, Klagen und Bitten tritt der Bürger der Bundesrepublik mit „seiner“ Regierung in Kommunikation. Er beschreibt seine Wünsche und Nöte, er weiß, an wen er sich zu wenden hat und von wem er sich Hilfe erhoffen darf. Diese Form der Kommunikation ist gesetzlich geschützt und heute ein demokratisches Grundrecht. Aber das Recht auf Bittgesuche ist schon älter und keine Erfindung demokratischer Staaten.
Die Suppliken im Fokus der Geschichtswissenschaft soll Thema dieser Arbeit sein. Warum erhalten Suppliken (und auch Beschwerden, Gravamina genannt) aus der Frühen Neuzeit, in den letzten 30 Jahren innerhalb der deutschsprachigen wissenschaftlichen Geschichtsbetrachtung Aufmerksamkeit? Für welche Forschungsgebiete ist die Betrachtung der Bittschriften und ihrer Verfasser von Interesse? Historiker unterscheiden verschiedene Typen von Suppliken und es soll herausgestellt werden welche Typen systematisiert werden. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, kann nur ein kleiner Ausschnitt der Forschungsgeschichte, exemplarisch eine Annäherung an dieses Thema präsentiert und können letztere Betrachtungen nur knapp gehalten werden. Ein Fazit am Ende soll die Ergebnisse zusammenfassen und Antworten auf die in der Hausarbeit gestellten Fragen geben. Ferner soll ausblickartig aufgezeigt werden, welche Fragen noch zu klären und ob eventuelle Defizite innerhalb der Forschungsliteratur aufzuarbeiten sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil - Suppliken als Forschungsgegenstand
- „Gnade vor Recht“
- „Wer nicht befehlen kann muss bitten“
- „Supplizieren und Wassertrinken ist jedermann gestattet“
- „Die subjektive Seite der Geschichte“
- „Kollektive Wortmeldungen“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Suppliken als Forschungsgegenstand in der Geschichte der Frühen Neuzeit. Dabei werden die verschiedenen Arten von Suppliken und ihre Rolle in der politischen Kommunikation zwischen Obrigkeit und Untertanen untersucht. Ziel ist es, die Relevanz dieser Schriftstücke für die Erforschung von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen der Vormoderne zu beleuchten.
- Das Supplikenwesen als Ausdruck des Verhältnisses zwischen Obrigkeit und Untertanen
- Die Rolle von Suppliken in der Justiz und Strafrechtspflege der Frühen Neuzeit
- Suppliken als Quelle für die Erforschung von sozialen und wirtschaftlichen Strukturen
- Die Bedeutung von Suppliken für die Analyse von Kommunikationsprozessen in der Frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Suppliken ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und seiner Bedeutung. Der Hauptteil widmet sich den Suppliken als Forschungsgegenstand und analysiert verschiedene Aspekte des Supplikenwesens, wie z.B. die Rolle von Gnade und Recht, die Kommunikation zwischen Bittsteller und Obrigkeit und die verschiedenen Typen von Suppliken. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Suppliken, Bittschriften, politische Kommunikation, Frühe Neuzeit, Obrigkeit, Untertanen, Justiz, Strafrechtspflege, soziale Strukturen, wirtschaftliche Strukturen, Kommunikationsprozesse, Gnadenrecht, Gravamina.
- Quote paper
- Veronique Grawe (Author), 2007, Suppliken als Gegenstand historischen Interesses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170694