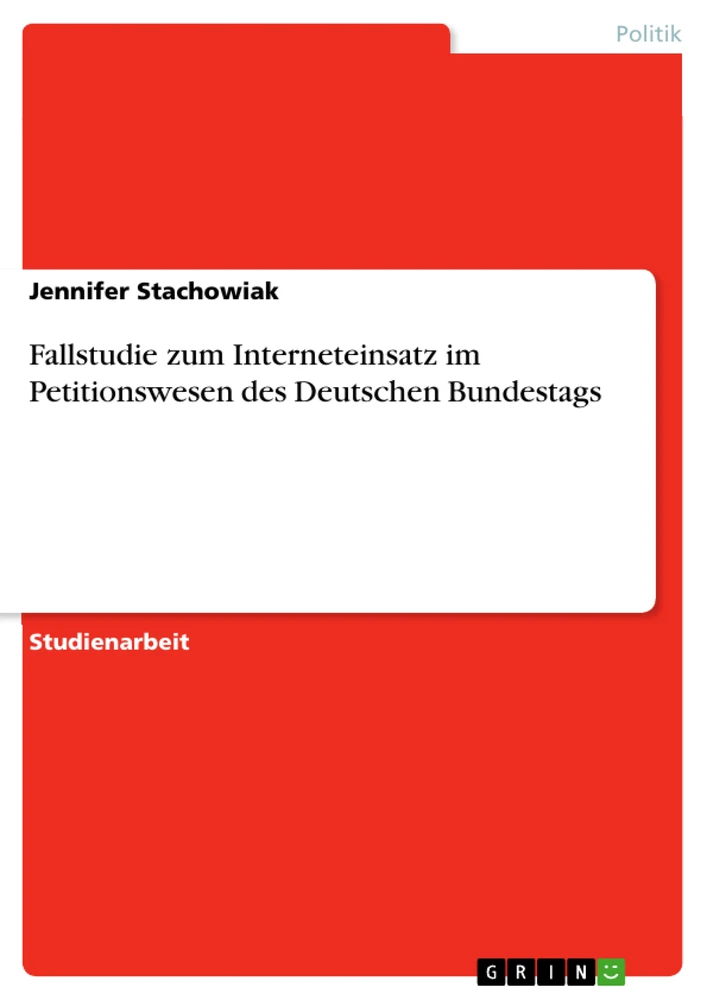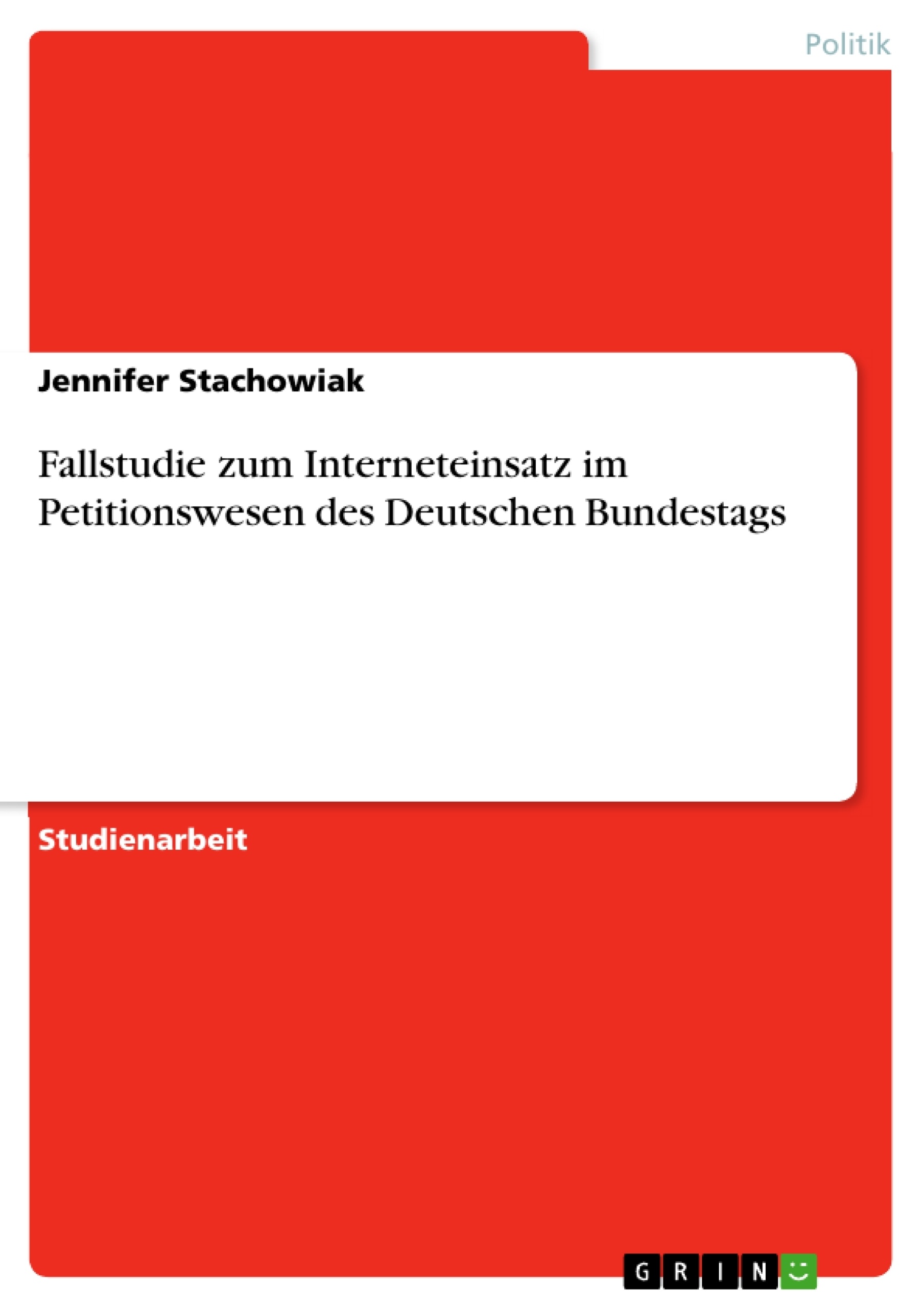Die Petition als Möglichkeit eines Bürgers sich mit einer Eingabe direkt an einen Herrscher zu wenden war bereits in der Antike bekannt und wurde im Verlauf der Geschichte bis in die heutige Zeit hinein immer wieder den geänderten politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Der Kern des Petitionswesens war dabei immer die Vertrauensbildung zwischen Staat und Bürger durch direkte Kommunikation und damit die Erhöhung der Legitimität des gesamten politischen Systems. Auch in modernen demokratischen Staaten hat das Petitionswesen davon nichts eingebüßt. So beschloss der Deutsche Bundestag im Jahr 2005 eine Reform mit dem Ziel der Modernisierung des Petitionswesens in Hinblick auf die Implementation moderner elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten. Diese Reform hatte zur Folge, dass das Petitionsangebot des Bundestags auf das Internet erweitert wurde. Petitionen können seitdem im Internet öffentlich zugänglich gemacht, mitgezeichnet und diskutiert werden. Hierdurch sollten Transparenz und eine größere Teilhabe durch die Bevölkerung erreicht werden. Das elektronische Petitionssystem stellt damit eine Plattform für einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs dar, welcher gerade aus deliberativer Perspektive beachtenswert ist.
Die vorliegende Arbeit ist eine Betrachtung der Auswirkungen dieser Änderungen des Petitionswesens beim Bundestag. Die Forschungsfrage lautet hierbei, ob das Reformziel einer Steigerung der Partizipation erreicht wurde.
Hierfür wird zunächst eine Einführung in die verschiedenen Typen von Petitionen gegeben, sowie die historische Entwicklung des Petitionswesens in Deutschland skizziert. Anschließend werden, aufgrund der hohen deliberativen Erwartungen der Reform, Verknüp-fungen mit HABERMAS Ansatz eines deliberativen Demokratiemodells vorgenommen. Die Analyse des elektronischen Petitionssystems erfolgt auf der Grundlage eines Rasters, welches im Zuge der Evaluierung der Reform von RIEHM und BLÜMEL aufgestellt worden ist. Abschließend werden die Ergebnisse der Analyse mit den deliberativen Vorstellungen HABERMAS verknüpft und diskutiert, um ein umfassendes Fazit ziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. BEGRIFFSKLÄRUNG
- 2.1. DEFINITION PETITION UND E-PETITION
- 2.2. TYPEN UND FORMEN VON PETITIONEN
- 3. HISTORISCHE UND THEORETISCHE EINORDNUNG
- 3.1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG
- 3.2. DELIBERATIVE DEMOKRATIETHEORIE
- 3.2.1. ÖFFENTLICHKEIT UND DISKURS
- 3.2.2. VERORTUNG VON ÖFFENTLICHEN PETITIONEN
- 4. ANALYSE
- 4.1. VORSTELLUNG DES ANALYSERASTERS
- 4.2. POLITISCHER UND INSTITUTIONELLER KONTEXT
- 4.2.1. KONTEXT UND ZIELSETZUNG DES PETITIONSSYSTEMS
- 4.2.2. EINFÜHRUNG IN DAS PETITIONSSYSTEM
- 4.2.3. KRITERIEN FÜR DIE TECHNISCHE ENTWICKLUNG DES E-PETITIONSSYSTEMS
- 4.3. DAS E-PETITIONSSYSTEM DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS: VERFAHREN UND TECHNIK
- 4.3.1. FORMALE BESTIMMUNG
- 4.3.2. PROZEDERE
- 4.3.3. STRUKTUR UND FUNKTIONALITÄT DES E-PETITIONSSYSTEMS
- 4.4. EINSCHÄTZUNG DER NUTZUNG, AKZEPTANZ UND EINFLUSS AUF politische WiLLENSBILDUNG
- 4.4.1. EVALUATION DES DEUTSCHEN PETITIONSSYSTEMS
- 4.4.2. ZUFRIEDENHEIT UND AKZEPTANZ DES PETITIONSSYSTEMS
- 4.4.3. VORSCHLäge zur Verbesserung DES SYSTEMS
- 5. DISKUSSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Auswirkungen der Modernisierung des Petitionswesens beim Deutschen Bundestag, insbesondere die Einführung des elektronischen Petitionssystems im Jahr 2005. Das zentrale Forschungsziel ist die Beantwortung der Frage, ob die Reform die angestrebte Steigerung der Partizipation erreicht hat.
- Historische Entwicklung des Petitionswesens in Deutschland
- Verknüpfung mit dem deliberativen Demokratiemodell von HABERMAS
- Analyse des elektronischen Petitionssystems anhand eines Rasters von RIEHM und BLÜMEL
- Bewertung der Auswirkungen der Reform auf die politische Willensbildung
- Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die deliberativen Erwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und formuliert die Forschungsfrage. Es wird betont, dass das Petitionswesen eine lange Geschichte hat und in der heutigen Zeit durch die Einführung elektronischer Möglichkeiten modernisiert wurde.
- Kapitel 2: Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Petition und differenziert zwischen klassischen und elektronischen Petitionen. Es werden die Funktionen des Petitionswesens sowohl für den Petenten als auch für den Petitionsadressaten erläutert.
- Kapitel 3: Hier wird die historische Entwicklung des Petitionswesens in Deutschland skizziert und das Konzept der deliberativen Demokratie nach HABERMAS vorgestellt. Die Verortung von öffentlichen Petitionen im deliberativen Kontext wird diskutiert.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert das elektronische Petitionssystem des Deutschen Bundestags. Es werden der politische und institutionelle Kontext, das Verfahren, die technische Struktur und die Ergebnisse der Evaluation des Systems beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Petitionswesens, insbesondere mit der Einbindung von modernen Technologien. Wesentliche Begriffe sind Petition, E-Petition, öffentliches Petitionssystem, deliberative Demokratie, Partizipation, Transparenz und politische Willensbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Reform des Petitionswesens 2005?
Das Ziel war die Modernisierung durch Einführung elektronischer Kommunikationswege, um Transparenz, Teilhabe und Partizipation der Bürger zu steigern.
Was ist eine E-Petition?
Eine E-Petition ist eine Petition, die über das Internet eingereicht, dort veröffentlicht und von anderen Bürgern mitgezeichnet oder diskutiert werden kann.
Welche Rolle spielt Habermas in dieser Untersuchung?
Sein Modell der deliberativen Demokratie dient als theoretische Basis, um zu prüfen, ob das E-Petitionssystem einen echten gesellschaftlichen Diskurs ermöglicht.
Wie wird das elektronische Petitionssystem evaluiert?
Die Analyse nutzt ein Raster von Riehm und Blümel, das Kriterien wie technische Funktionalität, Akzeptanz und Einfluss auf die politische Willensbildung umfasst.
Führte die Reform zu mehr Bürgerbeteiligung?
Die Forschungsfrage der Arbeit untersucht genau diesen Punkt und diskutiert die Ergebnisse im Hinblick auf die tatsächliche Steigerung der Partizipation.
Was sind die Vorteile von öffentlichen Petitionen?
Sie schaffen Öffentlichkeit für Anliegen, ermöglichen die Vernetzung von Gleichgesinnten und erhöhen die Legitimität des politischen Systems durch direkte Kommunikation.
- Citar trabajo
- Jennifer Stachowiak (Autor), 2011, Fallstudie zum Interneteinsatz im Petitionswesen des Deutschen Bundestags, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170985