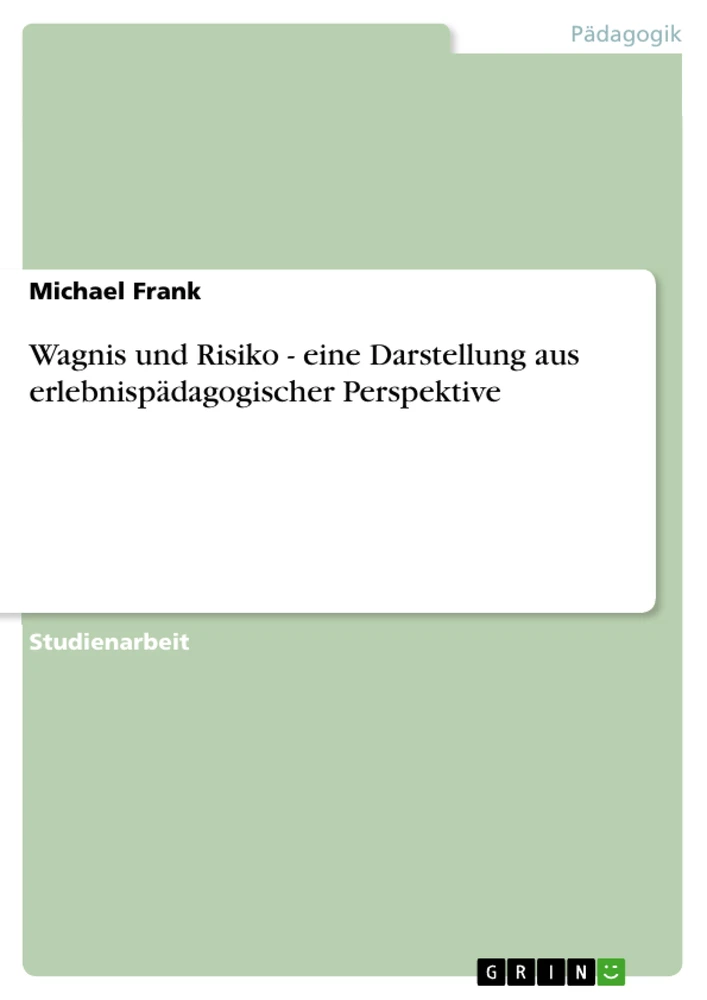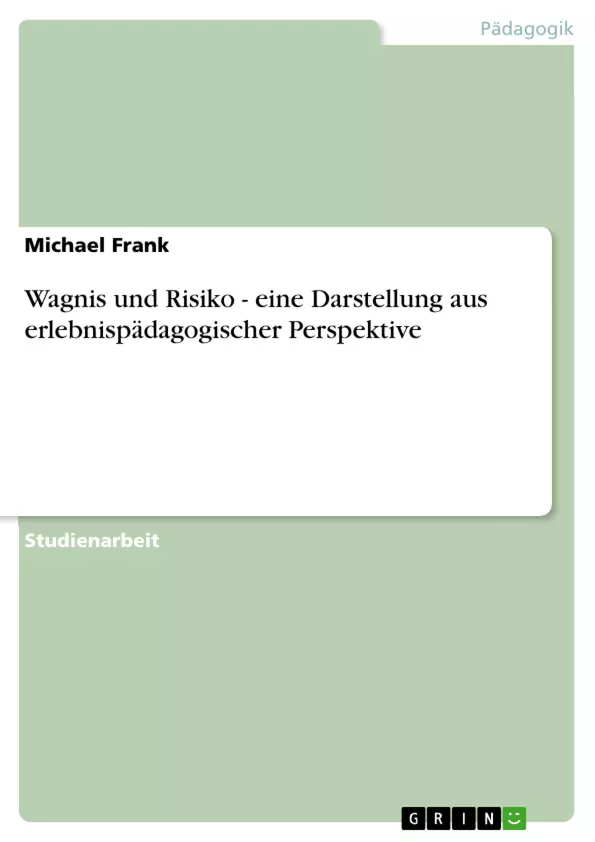Diese Arbeit befasst sich mit zwei Grundelementen der Erlebnispädagogik. Wagnis und Risiko. Neben der Begriffsdifferenzierung erfolgt auch eine Darstellung darüber, was die Begriffe Wagnis und Risiko verbindet. Es wird die Bedeutung der Begriffe für die Erlebnispädagogik und deren Grenzen herausgearbeitet. Die im Verlauf der Arbeit aufgestellte These (Wer Erlebnispädagogik macht, muss mit der Schädigung des Klienten rechnen.) wird anhand praktischer Beispiele belegt. Dies geschieht aus Sicht der TeilnehmerInnen aber auch aus Sicht der durchführenden PädagogInnen. Ein Fazit mit Ausblick auf eine mögliche Entwicklung der Wagnis- und Risikobereitschaft in der Erlebnispädagogik schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdifferenzierung
- 2.1 Wagnis
- 2.2 Risiko
- 3 Begriffsverbindung
- 4 Wagnisse und Risiken in der Erlebnispädagogik
- 5 Grenzen von Wagnissen und Risiken für die Erlebnispädagogik
- 6 Thesenbeleg anhand praktischer Beispiele
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Begriffe Wagnis und Risiko im Kontext der Erlebnispädagogik. Ziel ist es, die begrifflichen Unterschiede zu klären und ihre Bedeutung für die Praxis der Erlebnispädagogik zu beleuchten. Die Arbeit wird durch praktische Beispiele ergänzt und kritisch reflektiert.
- Begriffsdifferenzierung von Wagnis und Risiko
- Bedeutung von Wagnissen und Risiken in der Erlebnispädagogik
- Grenzen von Wagnissen und Risiken in der Erlebnispädagogik
- Praktische Beispiele zur Veranschaulichung
- Kritische Reflexion der aufgeworfenen Thesen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz der Begriffe Wagnis und Risiko in der Erlebnispädagogik. Sie verweist auf Kurt Hahn als "Gründungsvater" und betont die Bedeutung von Wagnissen und Risiken für die Entwicklung sozialer Tugenden. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Hausarbeit, die darin besteht, die begrifflichen Grenzen zwischen Wagnis und Risiko abzustecken und diese durch persönliche, praktische Beispiele zu konkretisieren. Die Einleitung betont den persönlichen Bezug des Autors zum Arbeitsfeld und die Intention, aufgeworfene Fragen und Thesen kritisch zu beleuchten.
2 Begriffsdifferenzierung: Dieses Kapitel beginnt mit der Feststellung, dass der Diskurs um die Begriffe Wagnis und Risiko auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Ebenen und in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten stattfindet. Es wird darauf hingewiesen, dass der Begriff Risiko eher im Bereich Soziologie und Betriebswirtschaft angesiedelt ist, während Wagnis in der Pädagogik, insbesondere der Sportpädagogik, zu finden ist. Die Arbeit hebt die ambivalente Beziehung zwischen den Begriffen hervor, die im weiteren Verlauf untersucht wird.
2.1 Wagnis: Der Begriff Wagnis wird im Kontext der Arbeit von Warwitz erläutert, der ihn von "wagan" ableitet und als Mut, etwas zu tun, beschreibt. Der Fokus liegt auf den intrapersonellen Auswirkungen des Wagnisses. Im Gegensatz zum Risiko werden mit dem Begriff Wagnis keine gesellschaftlichen Unsicherheiten bezeichnet. Der Prozess des Wagnisses beinhaltet ein Abwägen zwischen Risikoeinsatz und Sinnschöpfung. Das Wagnis wird als selbstbestimmte Suche nach spannenden und bereichernden Situationen dargestellt, die zur Selbsteinschätzung und Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Allerdings wird auch die Frage aufgeworfen, ob Handlungen wie das Anhaften an eine fahrende S-Bahn als Wagnis oder als bewusstes/unbewusstes Risiko einzustufen sind. Die Arbeit verweist auf Existenzphilosophen und Pädagogen, die den Wagnisbegriff im Zusammenhang mit sinn- und wertgerichteten Fragen und dem hohen Persönlichkeitsaspekt sehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Wagnis und Risiko in der Erlebnispädagogik
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Begriffe "Wagnis" und "Risiko" im Kontext der Erlebnispädagogik. Sie differenziert zwischen den Begriffen, beleuchtet ihre Bedeutung für die Praxis und reflektiert deren Grenzen anhand praktischer Beispiele.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdifferenzierung (inkl. Unterkapitel zu Wagnis und Risiko), Begriffsverbindung, Wagnisse und Risiken in der Erlebnispädagogik, Grenzen von Wagnissen und Risiken für die Erlebnispädagogik, Thesenbeleg anhand praktischer Beispiele und Fazit und Ausblick.
Wie werden Wagnis und Risiko definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen Wagnis und Risiko. Risiko wird eher im soziologischen und betriebswirtschaftlichen Kontext verortet, während Wagnis stärker in der Pädagogik, insbesondere der Sportpädagogik, verankert ist. Wagnis wird, angelehnt an Warwitz, als Mut, etwas zu tun, beschrieben, mit Fokus auf die intrapersonellen Auswirkungen und die selbstbestimmte Suche nach bereichernden Situationen. Risiko hingegen impliziert gesellschaftliche Unsicherheiten.
Welche Rolle spielen Wagnis und Risiko in der Erlebnispädagogik?
Die Hausarbeit beleuchtet die Bedeutung von Wagnissen und Risiken für die Erlebnispädagogik, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung sozialer Tugenden (bezugnehmend auf Kurt Hahn). Sie untersucht aber auch die Grenzen dieser Konzepte im pädagogischen Kontext.
Welche praktischen Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet praktische Beispiele zur Veranschaulichung der Begriffe und zur kritischen Reflexion der aufgeworfenen Thesen. Ein Beispiel ist die Frage, ob das Anhaften an eine fahrende S-Bahn als Wagnis oder Risiko einzustufen ist.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist die Klärung der begrifflichen Unterschiede zwischen Wagnis und Risiko und die Beleuchtung ihrer Bedeutung für die Praxis der Erlebnispädagogik. Die Arbeit soll durch praktische Beispiele ergänzt und kritisch reflektiert werden.
Wer ist der "Gründungsvater" der Erlebnispädagogik, der in der Arbeit erwähnt wird?
Kurt Hahn wird als "Gründungsvater" der Erlebnispädagogik genannt und seine Bedeutung für die Konzepte von Wagnis und Risiko in diesem Kontext hervorgehoben.
Wie wird die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und die Zielsetzung beschreibt. Es folgt eine Begriffsdifferenzierung, die die zentralen Begriffe definiert und voneinander abgrenzt. Die weiteren Kapitel befassen sich mit der Rolle von Wagnis und Risiko in der Erlebnispädagogik, ihren Grenzen und der kritischen Reflexion anhand praktischer Beispiele. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick.
- Quote paper
- Diplom Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (FH) Michael Frank (Author), 2009, Wagnis und Risiko - eine Darstellung aus erlebnispädagogischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171343