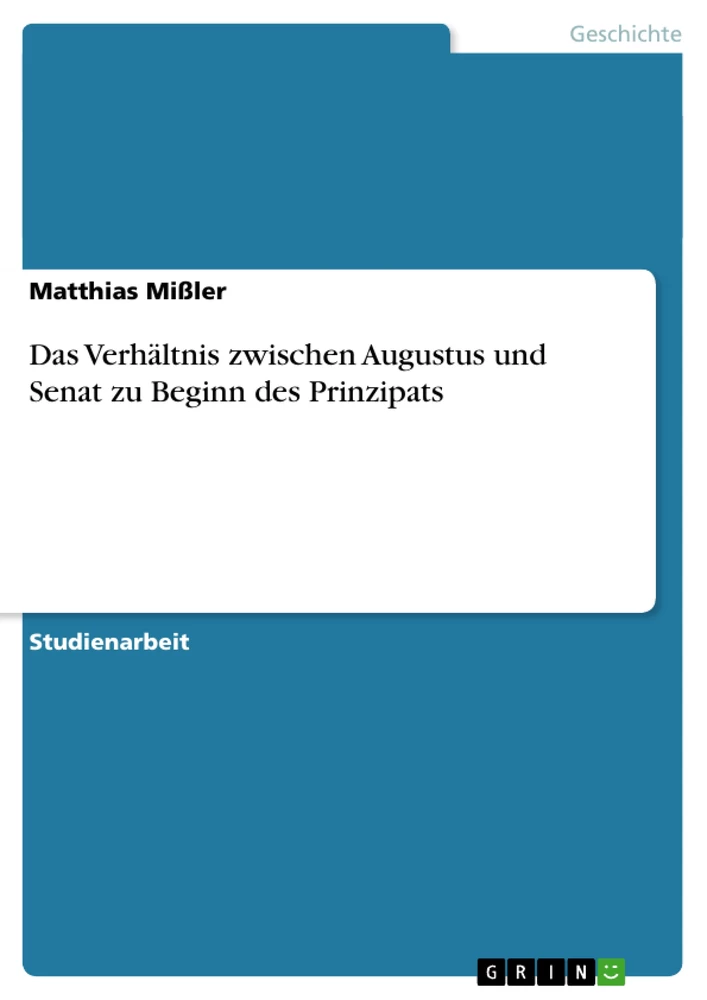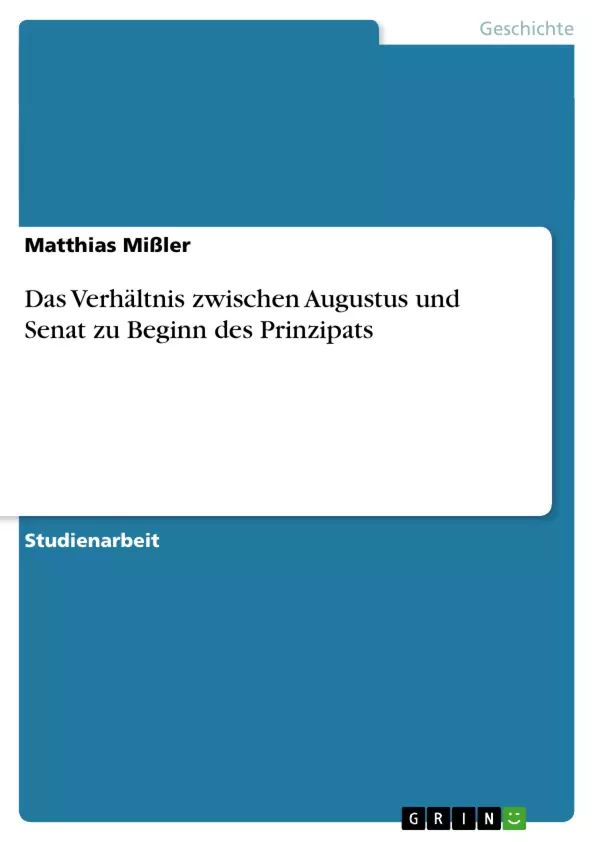Die vorliegende Arbeit wird sich im Folgenden mit der Analyse des Verhältnisses zwischen Augustus und dem Senat beschäftigen. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Beschreibung von Kontinuität und Wandel in Bezug auf die moralischen und traditionellen Werte der späten Republik und ihre Übernahme, bzw. ihre Einarbeitung in die neue staatliche Ordnung, dem sog. Prinzipat, liegen. Der zeitliche Schwer-punkt wird dabei auf die erste " lectio senatus " 27 v. Chr. liegen, Des weiteren werden wichtige Ereignisse aus dem Jahre 23 v. Chr. mit einbezogen. Die Arbeit analysiert wieso Augustus von sich behauptet die Republik 27 v. Chr. wiederhergestellt zu haben und wie beispiellos seine Machtbefugnisse waren, bezogen auf eine Einzelperson, im Vergleich zu der späten Republik. Sie wird sich ebenso näher der Verleihung der " tribunicia potestas " und dem " imperium proconsulare " an Augustus durch den Senat, im Zuge des sogenannten 1. und 2. Staatsaktes widmen. Auf Grund dieser Untersuchung wird hier auch auf die traditionellen spätrepublikanischen Begrenzungsmittel der Macht eingegangen, die da wären "Annuität" und "Kollegialität".
Die Arbeit wird auch der Vorgeschichte ihren berechtigten Platz einräumen. Es ist führ das Verständnis unabdingbar den Weg zur Macht, den Augustus ging kurz zu beschreiben. In den Nachfolgenden Kapiteln werde ich dann davon ausgehen, an Hand der Kompetenzen des Princeps, die Macht des Senats ins Verhältnis zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Vorgeschichte
- II. 1 Octavians Aufstieg zur Macht
- II. 2. Octavians Bruch mit Antonius
- III. Tradition - Ausgangsbasis für d. neue pol. Ordnung
- III. 1. Octavians gespaltenes Verhältnis zur Tradition
- III. 2. Legitimationsfunktion der Tradition
- III. 3. Der Senatorenstand u. seine pol. Gewichtung i. d. damal. Rep.
- IV. Die Verschmelzung d. Rep. m. d. Anspruch auf Alleinherrs.
- IV. 1. Wichtigste Faktoren für die Verschmelzung
- IV. 1.1. Der Senat
- IV. 1.2. Die Magistratur
- IV. 1.3. Der Staatsakt des Jahres 27 v. Chr.
- IV. 1.3.1. Die Ausgangsbasis
- IV. 1.3.2. Die zensorische Gewalt
- IV. 1.3.3. Das Konsulat
- IV. 1.3.4. Der Auftakt zum Staatsakt
- IV. 1.3.5. Der eigentliche Staatsakt
- IV. 1.3.5.1. Die Senatssitzung am 13. Januar 27 v. Chr.
- IV. 1.3.5.2. Die Ehrungen des Senats an Augustus
- IV. 1.3.5.3. Die „tribunicia potestas“
- IV. 1.3.6. Die Senatskommission
- IV. 2. Politische und soziale Einflussfaktoren auf den Senatorenstand
- IV. 1. Wichtigste Faktoren für die Verschmelzung
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen Augustus und dem Senat zu Beginn des Prinzipats, wobei der Fokus auf der Beschreibung von Kontinuität und Wandel in Bezug auf die moralischen und traditionellen Werte der späten Republik liegt. Der zeitliche Schwerpunkt liegt auf der ersten „Lectio Senatus“ 27 v. Chr. und wichtigen Ereignissen aus dem Jahre 23 v. Chr. Die Arbeit untersucht, warum Augustus von sich behauptete, die Republik 27 v. Chr. wiederhergestellt zu haben, und wie beispiellos seine Machtbefugnisse im Vergleich zur späten Republik waren. Außerdem wird auf die Verleihung der „tribunicia potestas“ und dem „imperium proconsulare“ an Augustus durch den Senat im Zuge des sogenannten 1. und 2. Staatsaktes eingegangen. Die Arbeit befasst sich auch mit den traditionellen spätrepublikanischen Begrenzungsmitteln der Macht, nämlich „Annuität“ und „Kollegialität“.
- Die Kontinuität und der Wandel traditioneller Werte der späten Republik im Prinzipat
- Die Rolle des Senats im Prinzipat
- Die Machtbefugnisse und Legitimität von Augustus
- Der Einfluss der „tribunicia potestas“ und des „imperium proconsulare“ auf das Verhältnis zwischen Augustus und dem Senat
- Die Bedeutung von „Annuität“ und „Kollegialität“ für die Machtbegrenzung in der späten Republik und im Prinzipat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Fokus der Arbeit vor, die auf das Verhältnis zwischen Augustus und dem Senat zu Beginn des Prinzipats gerichtet ist. Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen und Kontinuitäten im Vergleich zu den moralischen und traditionellen Werten der späten Republik. Die Arbeit konzentriert sich auf die erste "Lectio Senatus" im Jahr 27 v. Chr. sowie wichtige Ereignisse des Jahres 23 v. Chr.
Die Kapitel II.1 und II.2 skizzieren die Vorgeschichte, insbesondere Octavians Aufstieg zur Macht und seinen Bruch mit Marcus Antonius. Im Kapitel III. wird die Bedeutung der Tradition als Ausgangsbasis für die neue politische Ordnung untersucht, wobei Octavians ambivalentes Verhältnis zur Tradition, die Legitimationsfunktion der Tradition sowie die politische Gewichtung des Senatorenstandes in der späten Republik beleuchtet werden.
Kapitel IV. widmet sich der Verschmelzung der Republik mit dem Anspruch auf Alleinherrschaft. Es werden die wichtigsten Faktoren für diese Verschmelzung, wie der Senat, die Magistratur und der Staatsakt des Jahres 27 v. Chr. genauer betrachtet. Insbesondere wird der Staatsakt im Detail analysiert, einschließlich der Senatssitzung am 13. Januar 27 v. Chr., der Ehrungen des Senats für Augustus, der „tribunicia potestas“ sowie der Senatskommission. Schließlich werden die politischen und sozialen Einflussfaktoren auf den Senatorenstand erörtert.
Schlüsselwörter
Augustus, Senat, Prinzipat, Republik, Tradition, Kontinuität, Wandel, moralische Werte, „Lectio Senatus“, „tribunicia potestas“, „imperium proconsulare“, Staatsakt, Machtbefugnisse, „Annuität“, „Kollegialität“, späte Republik.
Häufig gestellte Fragen zu Augustus und dem Senat
Was geschah beim sogenannten "1. Staatsakt" im Jahr 27 v. Chr.?
Augustus gab formal seine außerordentlichen Vollmachten an den Senat zurück und behauptete, die Republik wiederhergestellt zu haben (restitutio rei publicae), erhielt jedoch gleichzeitig lebenswichtige Befugnisse zurück.
Was bedeuten die Begriffe "Annuität" und "Kollegialität"?
Es sind traditionelle Begrenzungsmittel der Macht in der römischen Republik: Ämter wurden nur für ein Jahr (Annuität) und an mindestens zwei Personen gleichzeitig (Kollegialität) vergeben.
Welche Bedeutung hatte die "tribunicia potestas" für Augustus?
Die Vollmacht eines Volkstribuns verlieh ihm Unverletzlichkeit, das Recht zur Einberufung des Senats und das Vetorecht, was seine Herrschaft sakrosankt und unangreifbar machte.
War Augustus' Herrschaft wirklich eine Wiederherstellung der Republik?
Formal ja, faktisch jedoch begründete er das Prinzipat, eine Alleinherrschaft unter dem Deckmantel republikanischer Institutionen und Traditionen.
Warum war das Verhältnis zum Senatorenstand für Augustus so wichtig?
Der Senat diente als Legitimationsbasis. Augustus musste den Senat einbinden und respektieren, um soziale Stabilität zu gewährleisten und den Schein der Tradition zu wahren.
- Quote paper
- Matthias Mißler (Author), 2001, Das Verhältnis zwischen Augustus und Senat zu Beginn des Prinzipats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17138