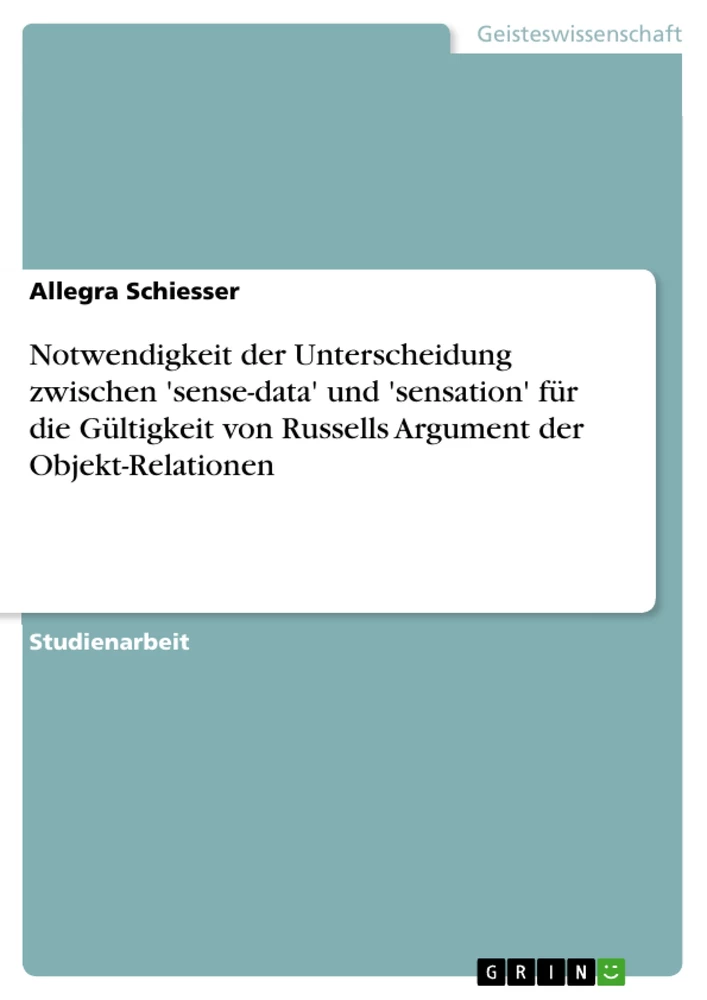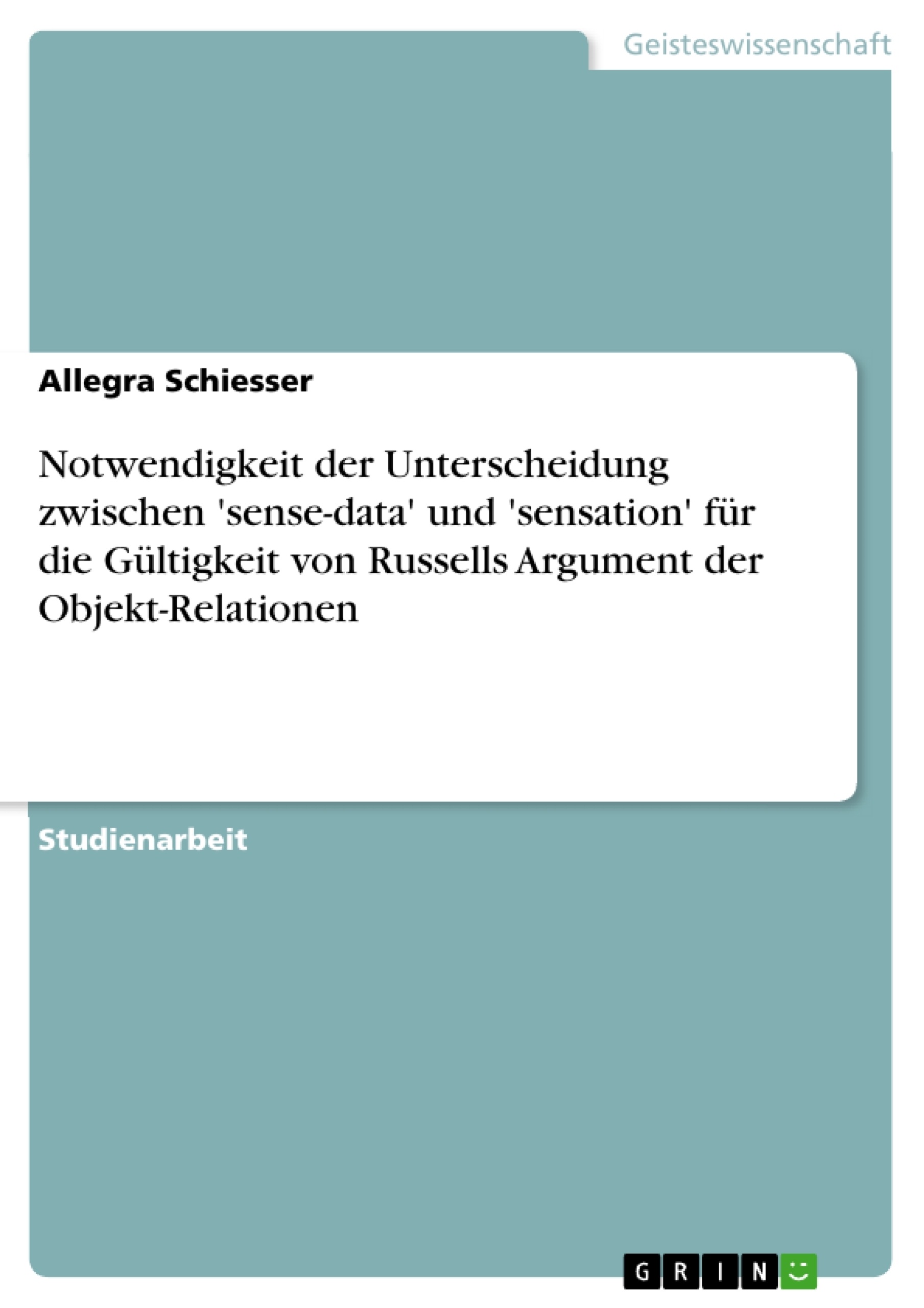Russell baut in seinem Argument in den ersten drei Kapiteln von Problems of Philosophy wesentlich
auf dem Begriff der sense-data auf, den er von sensation unterscheidet. Der Begriff der sense-data
erlaubt ihm zudem die Trennung des physical space vom private space, zu welchem die sense-data gehören,
so dass er Objekte wie seinen Beispiel-Tisch als unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung
betrachten kann. Der Begriff der sense-data erfüllt also eine zentrale Funktion für seine
Argumentation. Russell unterscheidet zwar zwischen sense-data und sensation, aber eine klare Bedeutungstrennung
der beiden sowie die Gründe für seine Unterscheidung bleiben unklar. Ich
möchte deshalb versuchen heraus zu finden, was genau der Bedeutungsunterschied der beiden
Begriffe ist und welchen Einfluss die Unterscheidung auf die Gültigkeit des Arguments hat. Dazu
gehört auch eine genauere Untersuchung, welche Funktionen die Begriffe in der Argumentation
erfüllen und daraus abgeleitet, ob der Unterschied der beiden Begriffe vielleicht nur in ihrer
Funktion liegt. Das könnte für das Argument heissen, dass es ohne die Unterscheidung nicht
funktionieren würde.
Ich stelle meiner Arbeit deshalb folgende Fragestellung voran: Ist die Unterscheidung zwischen
sense-data und sensation nötig für die Gültigkeit von Russells Argument dafür, dass wir kein Wissen
über die physischen Objekte an sich haben können, sondern nur über die Relationen zwischen
ihnen?
Zuerst werde ich den Versuch einer Begriffsklärung von sense-data und sensation aufgrund Russells
Bedeutungsangabe auf S. 4f. machen, als zweiten Punkt dann die Funktion und den Einfluss
der beiden Begriffe, vor allem aber derjenige der sense-data, in der Argumentation versuchen zu
rekonstruieren, und schliesslich werde ich im dritten Punkt untersuchen, ob das Argument auch
ohne die Unterscheidung zwischen sense-data und sensation funktionieren würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Definition der Begriffe sense-data und sensation
- Die Funktion von sense-data und sensation in Russells Argumentation
- Der Einfluss der Unterscheidung zwischen sense-data und sensation auf die Gültigkeit des Arguments
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Unterscheidung zwischen sense-data und sensation notwendig für die Gültigkeit von Russells Argument ist, dass wir kein Wissen über physische Objekte an sich haben können, sondern nur über die Relationen zwischen ihnen. Das Argument basiert auf Russells Verwendung von sense-data, die er von sensation unterscheidet und die ihm die Trennung des physical space vom private space ermöglichen. Die Arbeit analysiert die Definitionen der Begriffe sense-data und sensation, untersucht ihre Funktion in Russells Argumentation und bewertet den Einfluss der Unterscheidung auf die Gültigkeit des Arguments.
- Die Definitionen von sense-data und sensation nach Russell
- Die Funktion von sense-data und sensation in Russells Argument
- Der Einfluss der Unterscheidung zwischen sense-data und sensation auf die Gültigkeit des Arguments
- Die Rolle des physical space und des private space in Russells Argumentation
- Die Problematik der Unterscheidung zwischen sense-data und sensation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor: Ist die Unterscheidung zwischen sense-data und sensation notwendig für die Gültigkeit von Russells Argument? Sie führt den Leser in die Argumentation von Russell ein und beschreibt die zentrale Rolle von sense-data und sensation in seinem Argument. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Schritte der Argumentation.
Die Definition der Begriffe sense-data und sensation
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition der Begriffe sense-data und sensation, die Russell in seinem Argument verwendet. Es analysiert die Definitionen und zeigt die Problematik der Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen auf.
Die Funktion von sense-data und sensation in Russells Argumentation
Dieses Kapitel untersucht die Funktion der Begriffe sense-data und sensation in Russells Argumentation. Es rekonstruiert das Argument und analysiert die Rolle der beiden Begriffe an zentralen Stellen des Arguments.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen sense-data und sensation, deren Unterscheidung und deren Rolle in Russells Argumentation. Weitere wichtige Themen sind der physical space, der private space, die Relationen zwischen Objekten, das Problem des direkten Erfahrungswissens und die Gültigkeit von Russells Argument.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „sense-data“ und „sensation“ bei Russell?
Russell nutzt „sense-data“ für die Dinge, die uns unmittelbar in der Wahrnehmung gegeben sind, während „sensation“ den Prozess des Wahrnehmens beschreibt.
Warum ist diese Unterscheidung für Russells Argument wichtig?
Sie ermöglicht ihm die Trennung zwischen dem „physical space“ (Objekte an sich) und dem „private space“ (Wahrnehmungsinhalte).
Was ist Russells zentrale These zu physischen Objekten?
Er argumentiert, dass wir kein direktes Wissen über physische Objekte an sich haben können, sondern nur über die Relationen zwischen ihnen.
Welches Beispiel nutzt Russell zur Verdeutlichung?
Er verwendet das Beispiel eines Tisches, um zu zeigen, dass dessen Erscheinung (sense-data) von der Wahrnehmung abhängt.
Was untersucht diese Arbeit kritisch?
Die Arbeit prüft, ob Russells Argument auch ohne die (oft unklare) Unterscheidung zwischen sense-data und sensation gültig bleiben würde.
- Citation du texte
- Allegra Schiesser (Auteur), 2009, Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen 'sense-data' und 'sensation' für die Gültigkeit von Russells Argument der Objekt-Relationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171898