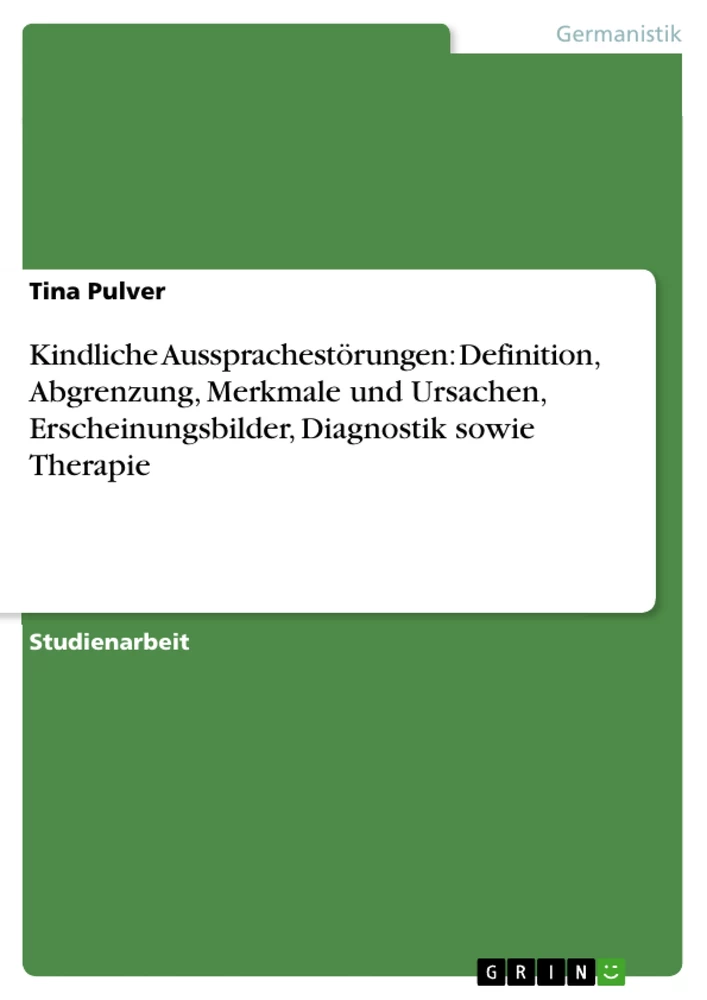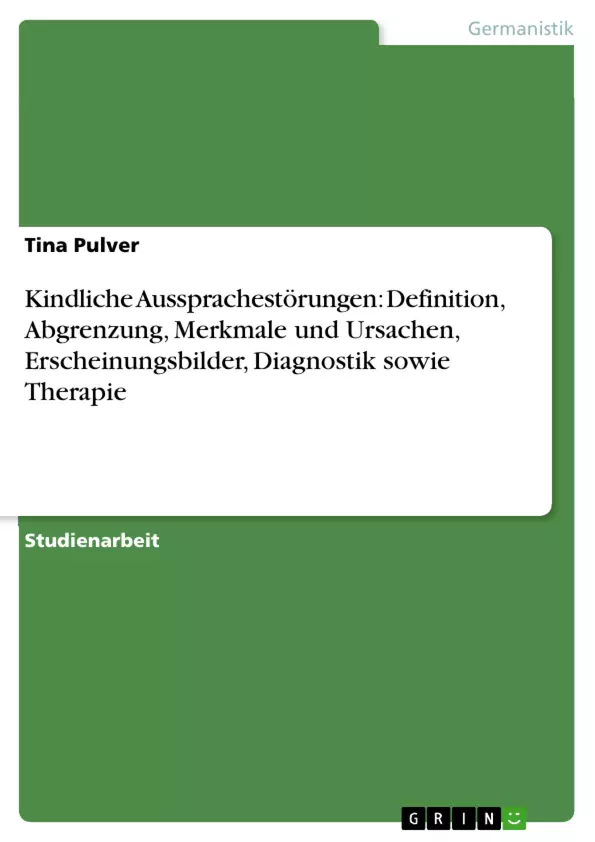Auszug aus der Einleitung:
Zunächst werden „Aussprachestörungen“ definiert und dabei Merkmale,
Unterteilungen sowie Ursachen dieser näher beleuchtet. In einem zweiten Schritt wird der Versuch unternommen, Aussprachestörungen konkret von „phonetischen und phonologischen Störungen“ sowie „Dyslalien“ abzugrenzen. Auch hier sollen Definitionsversuche, Eigenschaften und Gründe von phonetischen, phonologischen Störungen sowie Dyslalien näher bestimmt werden. Im Folgenden werden die konkreten „Erscheinungsbilder“ der phonologischen und der phonetischen Störungen, also „phonetische Fehlbildungen“ und „phonologische Prozesse“, genauer erklärt. Im nächsten Punkt sollen die Diagnosemöglichkeiten phonetisch-phonologischer Fähigkeiten Aufschluss darüber geben, wie Aussprachestörungen erfasst werden.
Dadurch werden auch Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden aufgedeckt. Darauf schließt sich der Punkt der Behandlung an, welcher in phonetisch orientierte und phonologisch orientierte Therapie unterteilt sein wird. Auch werden die einzelnen Beispiele der Therapieverfahren kritisch hinterfragt. Des Weiteren soll ein spezielles Fallbeispiel die therapeutische Vorgehensweise beim Rhotazismus näher beleuchten und so den Ablauf einer möglichen phonetisch orientierten Therapie anschaulich darstellen. In einem letzten Punkt wird noch einmal das Wichtigste zusammengetragen und die Ergebnisse knapp wiedergegeben. Außerdem soll ein kurzer Ausblick erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Abgrenzung sowie Merkmale und Ursachen
- Aussprachestörungen
- Phonetische und Phonologische Störungen
- Phonetische Störungen
- Phonologische Störungen
- Dyslalien
- Phonetische Störungen: Lautfehlbildungen
- Phonologische Störungen: Phonologische Prozesse
- Diagnostik phonetisch-phonologischer Fähigkeiten
- Traditionelle Diagnostikverfahren
- Aktuelle Verfahren
- Therapie von phonetischen und phonologischen Störungen
- Phonetisch orientierte Therapie
- Phasen der phonetischen Therapie an einem Fallbeispiel des Rhotazismus
- Phonologisch orientierte Therapie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit kindlichen Aussprachestörungen. Sie soll einen umfassenden Überblick über die Definition, Abgrenzung, Merkmale, Ursachen, Erscheinungsbilder, Diagnostik und Therapie dieser Störungen bieten.
- Definition und Abgrenzung von Aussprachestörungen, phonetischen und phonologischen Störungen sowie Dyslalien
- Analyse von Merkmalen und Ursachen von Aussprachestörungen
- Erläuterung der Erscheinungsformen von phonetischen und phonologischen Störungen, insbesondere Lautfehlbildungen und phonologische Prozesse
- Vorstellung verschiedener Diagnoseverfahren für phonetisch-phonologische Fähigkeiten
- Vergleich und Analyse phonetisch und phonologisch orientierter Therapieansätze
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema kindliche Aussprachestörungen in den Kontext und verdeutlicht die Relevanz des Themas anhand von Statistiken und Beispielen.
- Kapitel 2 definiert den Begriff "Aussprachestörung" und grenzt ihn von anderen Begriffen wie "phonetische und phonologische Störungen" und "Dyslalien" ab. Es werden auch Merkmale und Ursachen von Aussprachestörungen beleuchtet.
- Kapitel 3 behandelt die Erscheinungsformen phonetischer Störungen, die als Lautfehlbildungen bezeichnet werden.
- Kapitel 4 beleuchtet die Erscheinungsformen phonologischer Störungen, die als phonologische Prozesse bezeichnet werden.
- Kapitel 5 beschreibt verschiedene Verfahren zur Diagnostik von phonetisch-phonologischen Fähigkeiten, wobei sowohl traditionelle als auch aktuelle Ansätze vorgestellt werden.
- Kapitel 6 befasst sich mit der Therapie von phonetischen und phonologischen Störungen, wobei sowohl phonetisch als auch phonologisch orientierte Ansätze erläutert werden. Zusätzlich wird ein Fallbeispiel des Rhotazismus verwendet, um die therapeutische Vorgehensweise zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Kindliche Aussprachestörungen, Phonetische Störungen, Phonologische Störungen, Dyslalien, Lautfehlbildungen, Phonologische Prozesse, Diagnostik, Therapie, Phonetisch orientierte Therapie, Phonologisch orientierte Therapie, Rhotazismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen phonetischen und phonologischen Störungen?
Phonetische Störungen betreffen die motorische Lautbildung (Artikulation), während phonologische Störungen die Verwendung von Lauten zur Bedeutungsunterscheidung im Sprachsystem betreffen.
Was versteht man unter "Dyslalien"?
Dyslalie ist der klassische Oberbegriff für Aussprachestörungen, bei denen Laute ausgelassen, ersetzt oder fehlerhaft gebildet werden.
Was sind "phonologische Prozesse"?
Das sind Vereinfachungsstrategien von Kindern (z.B. "Taffee" statt "Kaffee"), die bis zu einem gewissen Alter normal sind, bei Persistenz aber als Störung gelten.
Wie werden Aussprachestörungen diagnostiziert?
Durch standardisierte Tests, Bildbenennungsverfahren und die Analyse der Spontansprache werden die phonetisch-phonologischen Fähigkeiten erfasst.
Was ist Rhotazismus?
Rhotazismus ist eine spezifische Fehlbildung des Lautes /r/, die in der Arbeit als Fallbeispiel für eine phonetisch orientierte Therapie dient.
Welche Ursachen haben kindliche Aussprachestörungen?
Ursachen können organisch (z.B. Hörstörungen), funktionell (z.B. Muskelschwäche im Mundbereich) oder kognitiv-linguistisch bedingt sein.
- Quote paper
- Tina Pulver (Author), 2011, Kindliche Aussprachestörungen: Definition, Abgrenzung, Merkmale und Ursachen, Erscheinungsbilder, Diagnostik sowie Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172466