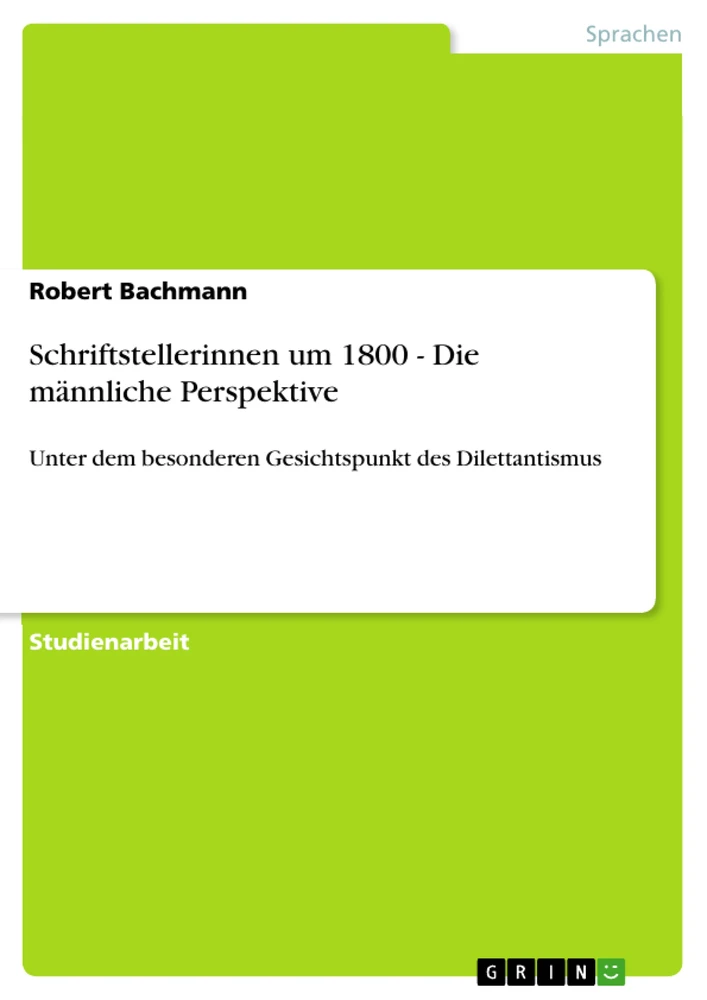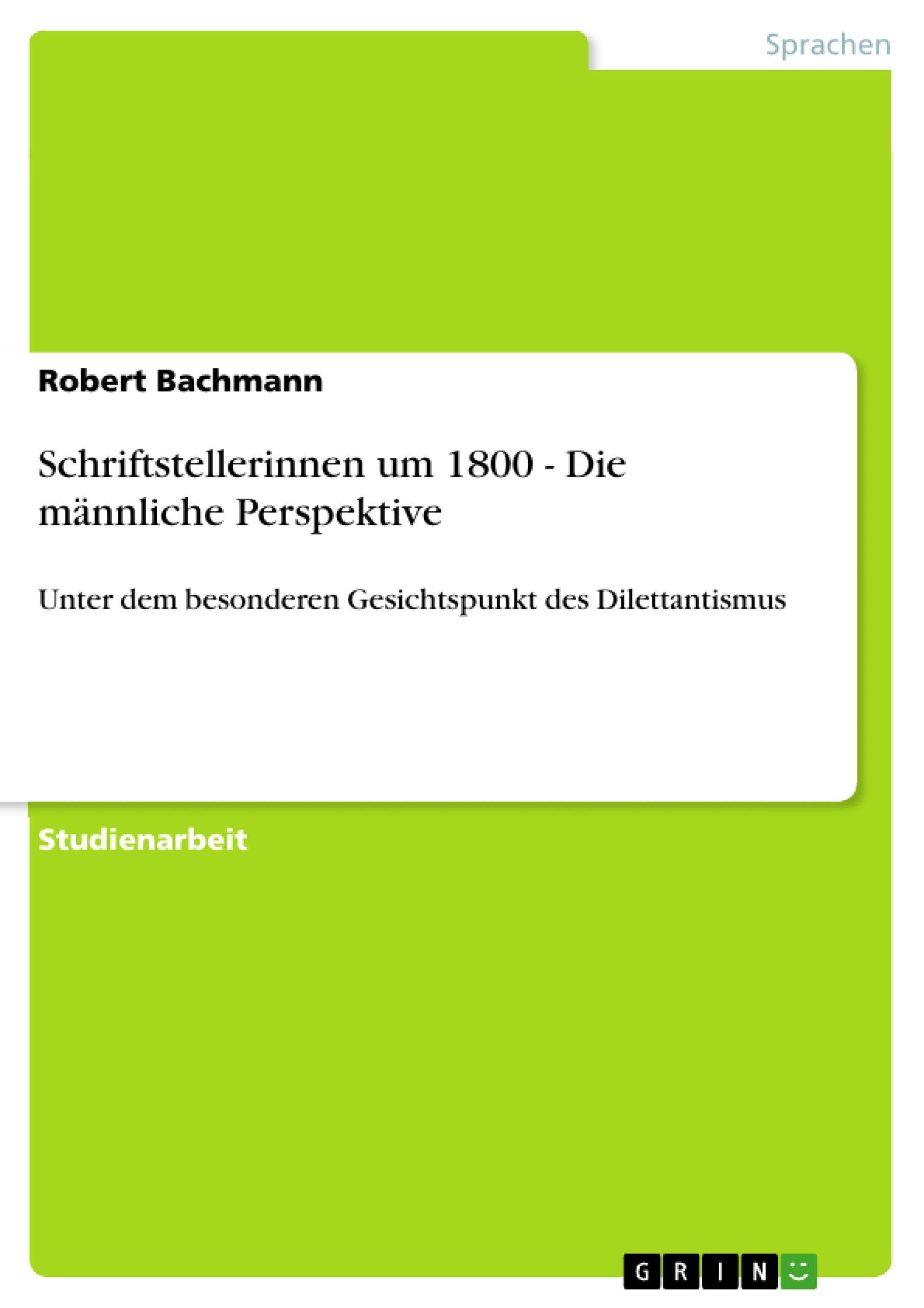Aus der Einleitung: "Allein schon durch das Gesetz der Natur sind die Frauen ebenso wie die Kinder dem Urteil der Männer ausgesetzt. [...] Die Frau ist dazu geschaffen, dem Mann nachzugeben und selbst eine Ungerechtigkeit zu ertragen. Knaben kann man nie dahin bringen; ihr innerstes Gefühl erhebt sich gegen die Ungerechtigkeit; die Natur schuf sie nicht, Ungerechtigkeit zu dulden." (Jean Jacques Rousseau: Emile oder über die Erziehung.12.Auflage. Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schönigh Verlag 1995. S. 733 u. 795.)
Was Jean- Jacques Rousseau hier so unverblümt zur Sprache bringt, dürfte wohl manch aufgeklärter Frau von heute die Haare zu Berge stehen lassen. Tatsächlich jedoch entspricht genau dies dem allgemein gültigem Rollenverständnis im Europa des 18. Jahrhunderts. Auch in Deutschland stießen Rousseaus programmatische Schriften auf positive Resonanz. Namhafte Pädagogen wie Johann-Gottfried Herder stehen vehement hinter dem Gedanken der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und setzen, was die Aggressivität der Äußerungen angeht, noch kräftig nach. Für das Feld der Literatur gewinnt dieses Thema im ausgehenden 18. Jahrhundert ebenfalls immer mehr an Bedeutung. Die Frauen dieser Zeit bilden nicht nur einen großen Teil des Lesepublikums; immer mehr treibt es sie auch zur eigenen schriftstellerischen Betätigung. Stoff für konfliktreiche Auseinandersetzungen ist hier nun reichlich gegeben. Gegenstand der folgenden Darstellung soll es sein, das männliche Urteil näher zu betrachten, dem Rousseau zu folge die Frauen, und hier besonders die Autorinnen um 1800, ausgesetzt sind. Wie beurteilen die männlichen Zeitgenossen die literarischen Bestrebungen des anderen Geschlechts und welche Legitimationen führen sie dabei ins Feld?
Zunächst soll in einem ersten Teil anhand einiger Beispiele ein kurzer Einblick in das Rollenverständnis der Zeit gegeben werden. Im Anschluss soll in einem zweiten Teil verdeutlicht werden, in welcher Form diese Ansichten sich im literarischen Diskurs wiederfinden. Im Zentrum der Untersuchung soll dabei der Zusammenhang zwischen weiblicher Schriftstellerei und Dilettantismus stehen, so wie er v.a. von Goethe und Schiller zur Jahrhundertwende insbesondere den Frauen zum Vorwurf gemacht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Frau und ihre Natur - Anthropologie der Ungleichheit
- Martin Wieland über den Nutzen des Fräulein von Sternheim...
- Goethe, Schiller und die schreibende Frau
- Zum sogenannten Dilettantismus..
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die männliche Perspektive auf Schriftstellerinnen um 1800, insbesondere im Kontext des Dilettantismus. Sie analysiert, wie männliche Zeitgenossen die literarischen Bestrebungen von Frauen bewerteten und welche Rechtfertigungen sie dafür anführten.
- Das Rollenverständnis von Frauen im 18. Jahrhundert
- Die Auswirkungen der Aufklärung auf die Rolle der Frau
- Die Darstellung weiblicher Schriftstellerei im literarischen Diskurs
- Der Vorwurf des Dilettantismus an Schriftstellerinnen
- Die Rezeption von Rousseaus Schriften in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der männlichen Beurteilung weiblicher Schriftstellerinnen um 1800 dar. Sie basiert auf Rousseaus kontroverser Sicht auf die weibliche Natur und kündigt die Struktur der Arbeit an: Zuerst wird das damalige Rollenverständnis beleuchtet, anschließend die Reflexion dieser Ansichten im literarischen Diskurs, mit dem Fokus auf den Vorwurf des Dilettantismus, insbesondere seitens Goethe und Schiller.
Die Frau und ihre Natur - Anthropologie der Ungleichheit: Dieses Kapitel untersucht die anthropologische Sicht auf die Ungleichheit der Geschlechter im 18. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Aufklärung. Es beleuchtet den Widerspruch zwischen den emanzipatorischen Ideen der Aufklärung und der anhaltenden Betonung des Geschlechterunterschieds. Die zunehmende Bedeutung des Lesens und der Literatur für die bürgerliche Emanzipation wird hervorgehoben, wobei der große Anteil von Frauen am Lesepublikum betont wird. Gleichzeitig wird der Widerspruch zwischen den neuen Idealen der Selbstbestimmung und den traditionellen, oft religiös begründeten, Rollenvorstellungen diskutiert, wobei die Bibel und Martin Luther als Beispiele angeführt werden.
Schlüsselwörter
Schriftstellerinnen, 18. Jahrhundert, Dilettantismus, Aufklärung, Geschlechterrollen, Rollenverständnis, Literatur, Rousseau, Goethe, Schiller, Emanzipation, literarischer Diskurs.
Häufig gestellte Fragen zu: Männliche Perspektiven auf Schriftstellerinnen um 1800
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die männliche Perspektive auf Schriftstellerinnen um 1800, insbesondere im Kontext des Vorwurfs des Dilettantismus. Sie analysiert, wie männliche Zeitgenossen die literarischen Bestrebungen von Frauen bewerteten und welche Rechtfertigungen sie dafür anführten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Rollenverständnis von Frauen im 18. Jahrhundert, die Auswirkungen der Aufklärung auf die Rolle der Frau, die Darstellung weiblicher Schriftstellerei im literarischen Diskurs, den Vorwurf des Dilettantismus an Schriftstellerinnen, und die Rezeption von Rousseaus Schriften in Deutschland. Ein besonderer Fokus liegt auf den Ansichten von Goethe und Schiller.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die anthropologische Sicht auf die Ungleichheit der Geschlechter, ein Kapitel über die Meinung Martin Wielands (bezüglich des "Fräuleins von Sternheim"), ein Kapitel über Goethe, Schiller und die schreibende Frau (mit einem Unterkapitel zum Dilettantismus), und ein Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der männlichen Beurteilung weiblicher Schriftstellerinnen um 1800 dar. Sie basiert auf Rousseaus kontroverser Sicht auf die weibliche Natur und beschreibt die Struktur der Arbeit.
Worum geht es im Kapitel "Die Frau und ihre Natur - Anthropologie der Ungleichheit"?
Dieses Kapitel untersucht die anthropologische Sicht auf die Ungleichheit der Geschlechter im 18. Jahrhundert im Kontext der Aufklärung. Es beleuchtet den Widerspruch zwischen emanzipatorischen Ideen und der anhaltenden Betonung des Geschlechterunterschieds und diskutiert die Rolle von Literatur und Lesen in der bürgerlichen Emanzipation.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schriftstellerinnen, 18. Jahrhundert, Dilettantismus, Aufklärung, Geschlechterrollen, Rollenverständnis, Literatur, Rousseau, Goethe, Schiller, Emanzipation, literarischer Diskurs.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genauen Quellen sind im Volltext der Arbeit aufgeführt, aber die Arbeit bezieht sich explizit auf Rousseau, Goethe und Schiller, sowie auf die Bibel und Martin Luther im Kontext der religiösen Begründung traditioneller Rollenvorstellungen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie bewerteten männliche Zeitgenossen um 1800 die literarischen Bestrebungen von Frauen, und welche Rechtfertigungen führten sie dafür an?
- Arbeit zitieren
- Robert Bachmann (Autor:in), 2007, Schriftstellerinnen um 1800 - Die männliche Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172721