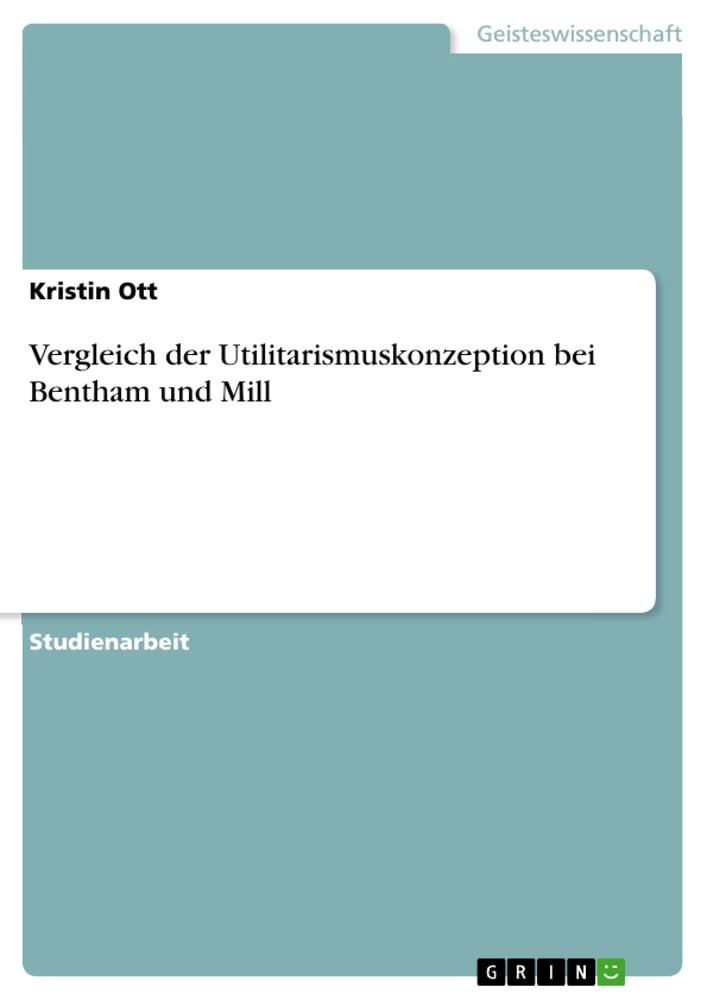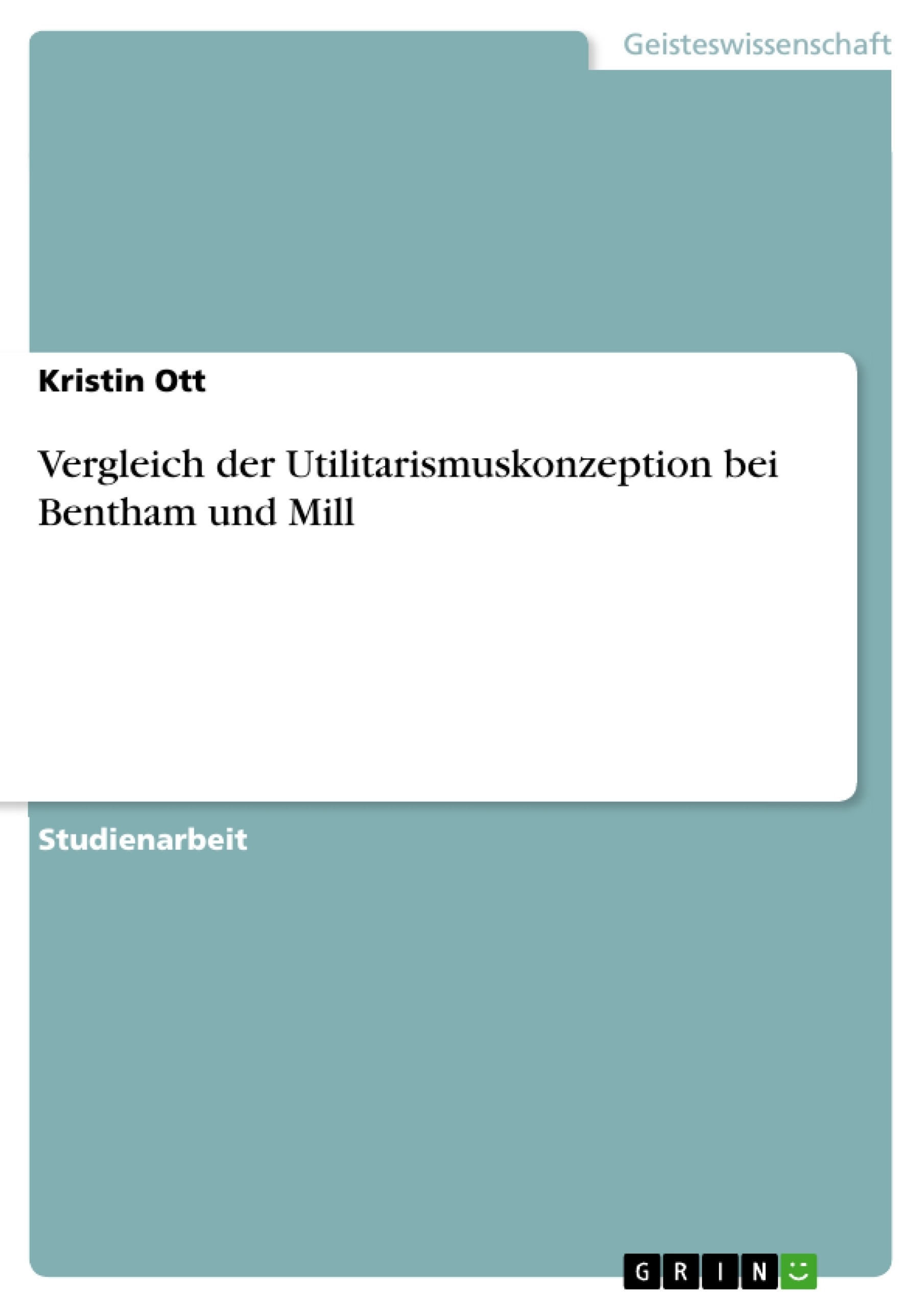Die Utilitarismus-Konzeption bei Bentham und Mill scheint auf den ersten Blick ähnlich zu sein. Doch bei genauerer Betrachtung fallen diverse Unterschiede bzw. Weiterentwicklungen auf Seiten Mills auf.
Jeremy Bentham, geboren 1748, arbeitete 60 Jahre lang darauf hin, der „Newton of legislation“1 zu werden. Er wurde in London geboren, in einer damals durchaus respektablen Gegend2, als Sohn von Jeremiah Bentham, einem engagierten und ehrgeizigen Anwalt, dessen Ambitionen sich jedoch eher auf die Karriere seines Sohnes als auf die eigene bezogen. Erziehung war eine einfache Sache für Jeremiah Bentham: das Ziel war Geld oder eine andere angemessene Form von Macht, und als Mittel zum Zweck musste die Ausbildung sowohl technisch als auch sozial sein. Die am besten geeignetste technische Ausbildung war das Jurastudium, da es mit allen Bereichen des Lebens zu tun hatte – also sollte Jeremy Anwalt werden. Doch Jeremiah Bentham wusste, dass Jura allein nicht genug sein würde, also musste sich der Sohn auch sozial weiterbilden, um in der höheren Gesellschaft eines Tages akzeptiert zu werden. Dazu gehörte das Tanzen, Französisch, die Malerei und die Musik, und natürlich der Besuch einer großen Public School und später eines guten Colleges an der Universität. Schon im Kleinkindalter lernte Bentham Latein und Griechisch, und auch in Musik erwies sich Jeremy als sehr lernfähig. Mit fünf konnte er Footes Menuett auf seiner Miniaturgeige spielen, danach folgten Corelli und Händel. Mit sieben Jahren wurde er auf die Westminster School geschickt, eine der renommiertesten Jungenschulen Englands, und dort blieb er jeden Winter bis er 12 war. Mit „twelfe years, three months, and thirteen days“3 wurde er an der Oxford University eingeschrieben, und auch die mitgenommene Büchersammlung spricht für die Erziehung Benthams: darunter fanden sich unter anderem Werke von Milton, Cicero, Ovid, Horaz, Virgil und Homer. 1763, mit 15 Jahren, bekam Bentham das Bacherlor’s Degree verliehen, und im November desselben Jahres begann er, im Lincoln’s Inn zu essen und Verhandlungen bei Gericht beizuwohnen. [...]
1 Charles W. Everett, Jeremy Bentham, (London: Dell, 1966), S. 6.
2 Cf. Everett S. 13.
3 Ibid, S. 15.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herleitung des Utilitarismus
- Qualitativ vs. Quantitativ
- Beweis des Utilitarismus
- Sanktionen
- Conclusio
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Utilitarismus von Bentham und Mill und untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Konzeptionen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie sich die beiden Denker dem Prinzip des größten Glücks der größten Zahl nähern und welche Unterschiede in ihrer Herangehensweise an die Quantifizierung und Qualität von Glück erkennbar sind.
- Die Entwicklung und Herleitung des Utilitarismus
- Der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen zum Glück
- Die Rolle von Sanktionen im Kontext des Utilitarismus
- Die Beweise für die Gültigkeit des Utilitarismus
- Die Weiterentwicklung des Utilitarismus durch Mill
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Utilitarismus bei Bentham und Mill ein und hebt die vermeintlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihren Konzeptionen hervor.
- Herleitung des Utilitarismus: Dieses Kapitel beleuchtet die philosophischen Grundlagen des Utilitarismus bei Bentham und Mill und untersucht, wie sie zum Prinzip des größten Glücks der größten Zahl gelangen.
- Qualitativ vs. Quantitativ: Dieses Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, ob Glück quantifiziert werden kann und wie Bentham und Mill die Qualität und Quantität von Glück beurteilen.
- Beweis des Utilitarismus: Dieses Kapitel analysiert die Beweise, die Bentham und Mill für die Gültigkeit des Utilitarismus anführen, und diskutiert deren Überzeugungskraft.
- Sanktionen: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Sanktionen im Utilitarismus und wie Bentham und Mill diese zur Förderung des größten Glücks einsetzen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen des Utilitarismus, den Philosophen Jeremy Bentham und John Stuart Mill, sowie mit Themen wie größtes Glück der größten Zahl, Quantifizierung und Qualität von Glück, Sanktionen und Beweisführung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen dem Utilitarismus von Bentham und Mill?
Bentham verfolgt einen rein quantitativen Ansatz („größte Summe an Glück“), während Mill qualitative Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Vergnügen einführt.
Wie definierte Jeremy Bentham das Ziel der Gesetzgebung?
Bentham wollte der „Newton der Gesetzgebung“ sein und Gesetze so gestalten, dass sie das größtmögliche Glück für die größte Zahl an Menschen fördern.
Welche Rolle spielen Sanktionen in der utilitaristischen Theorie?
Sanktionen dienen als Instrumente, um das Verhalten des Einzelnen so zu steuern, dass es mit dem allgemeinen Glück der Gesellschaft in Einklang steht.
Wie wurde Jeremy Bentham in seiner Kindheit geprägt?
Er erhielt eine extrem frühe und umfassende Ausbildung in Sprachen (Latein, Griechisch) und Musik, um später in der höheren Gesellschaft und als Anwalt erfolgreich zu sein.
Wie beweist Mill die Gültigkeit des Utilitarismus?
Die Arbeit analysiert Mills Beweisführung für das Nützlichkeitsprinzip und diskutiert die philosophische Überzeugungskraft seiner Argumente.
- Citation du texte
- Kristin Ott (Auteur), 2003, Vergleich der Utilitarismuskonzeption bei Bentham und Mill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17278