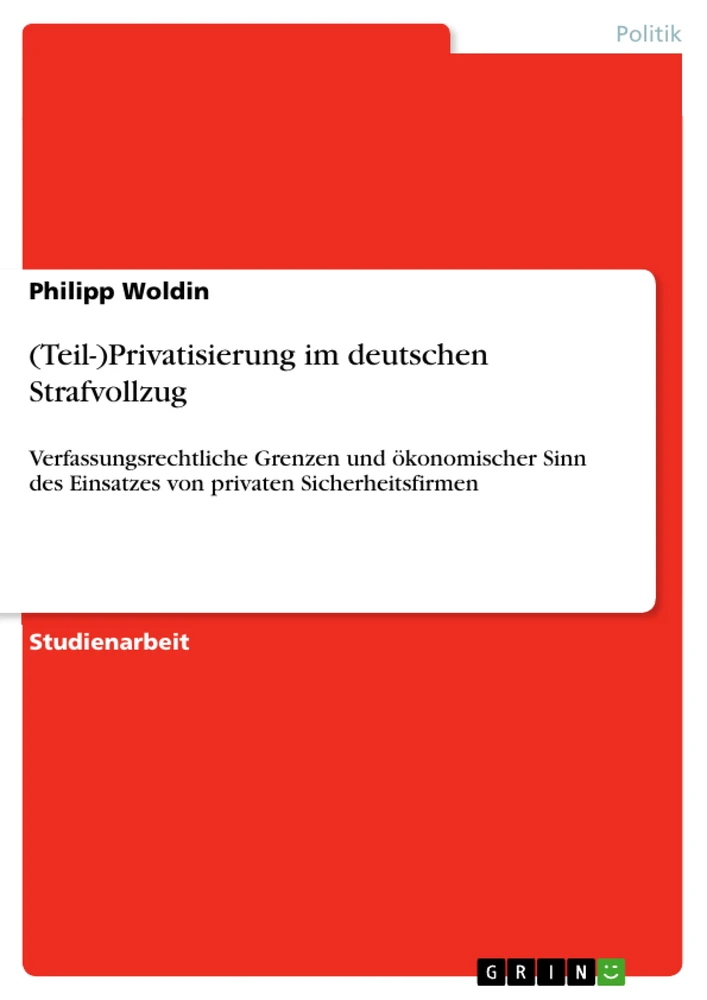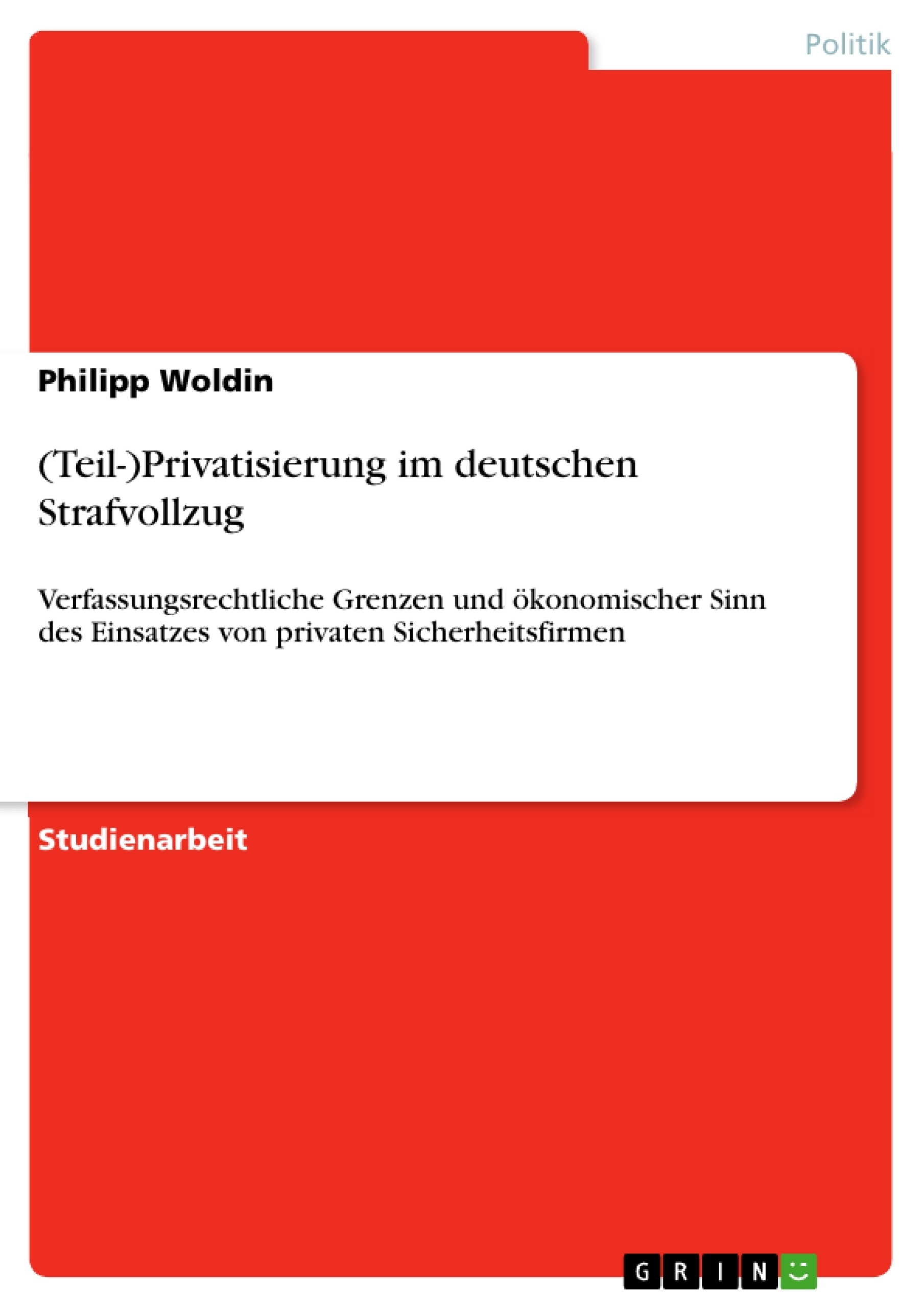Der deutsche Strafvollzug steht vor gewaltigen Herausforderungen: leere Staatskassen, eine chronische Überbelegung der Gefängnisse und kontinuierlich steigende Insassenzahlen. Dies sind keinesfalls rein „deutsche“ Probleme, auch andere westliche Industrienationen wie die USA, Großbritannien und Frankreich mussten und müssen auf die angesprochenen Missstände reagieren.
Die Privatisierung des Strafvollzugs erschien besonders in den Vereinigten Staaten als Ausweg aus finanziellen Engpässen und als gelungene Reform zur Flexibilisierung, Verschlankung und Modernisierung des Vollzugsapparates. In Deutschland ist der Privatisierungsgedanke im Strafvollzug noch vergleichsweise jung, erste Modellprojekte wie die JVA Hünfeld begannen erst 2005. Auch sind grundlegende Abgrenzungen zu den genannten Staaten zu treffen. Auf Deutschland bezogen kann man nur von einer „Teilprivatisierung im Strafvollzug“ sprechen, da eine vollständige Abgabe des Strafvollzuges in private Hände verfassungsrechtlich nicht möglich wäre.
Diese Arbeit soll untersuchen, in welchem Rahmen eine Teilprivatisierung rechtlich zulässig ist und ob eine Teilbetrieb durch Private im deutschen Strafvollzug ökonomisch und qualitativ sinnvoll erscheint. Bei der Beantwortung dieser Frage wird zudem der Einfluss des „vermeintlichen“ Vorbildes in Sachen Privatisierung, den USA, auf Deutschland besprochen und analysiert, ob und welche Lehren sich aus dem amerikanischen Modell ziehen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Privatisierung und Strafvollzug
- I. Rechtliche Grundlagen des Strafvollzugs
- II. Formen der Privatisierung im Strafvollzug
- a. Formelle Privatisierung
- b. Funktionale Privatisierung
- III. Marktwirtschaftliche Logik bei der Privatisierung des Strafvollzugs
- C. Strafvollzug in den USA: Der Gefangene als „Ware“
- I. Voraussetzungen für die herausgehobene Rolle der USA bei der Gefängnisprivatisierung
- II. Private Sicherheitsfirmen auf dem „Gefängnismarkt“ USA
- III. Vorteile aus der Privatisierung des amerikanischen Strafvollzugs?
- D. Teilprivatisierung im Strafvollzug in Deutschland
- I. Motive und Ziele für die Teilprivatisierung
- II. Verfassungsmäßige Grenzen für den Einsatz Privater im Strafvollzug
- III. Empirische Effekte der Teilprivatisierung am Beispiel der JVA Hünfeld
- E. Voraussetzungen einer sinnvollen Teilprivatisierung
- F. Ausblick: Wie weit kann sich der deutsche Strafvollzug in Zukunft noch entwickeln?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Teilprivatisierung im deutschen Strafvollzug. Die Analyse konzentriert sich auf die rechtliche Zulässigkeit der Teilprivatisierung und die Frage, ob ein Teilbetrieb durch Private ökonomisch und qualitativ sinnvoll erscheint. Hierbei wird der Einfluss des amerikanischen Modells der Gefängnisprivatisierung auf Deutschland beleuchtet und analysiert, welche Lehren sich daraus ziehen lassen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Teilprivatisierung im Strafvollzug
- Formen der Privatisierung: formelle vs. funktionale Privatisierung
- Vergleichende Analyse des amerikanischen und deutschen Strafvollzugssystems
- Motive und Ziele der Teilprivatisierung in Deutschland
- Empirische Effekte der Teilprivatisierung am Beispiel der JVA Hünfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Herausforderungen, vor denen der deutsche Strafvollzug steht. Die Privatisierung im Strafvollzug wird als möglicher Lösungsansatz vorgestellt, und es wird auf die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Modell hingewiesen.
- Kapitel B: Privatisierung und Strafvollzug
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen des Strafvollzugs in Deutschland und den verschiedenen Formen der Privatisierung. Es werden die formelle und funktionale Privatisierung detailliert beschrieben, wobei die Besonderheiten der Teilprivatisierung im Strafvollzug im Vordergrund stehen.
- Kapitel C: Strafvollzug in den USA: Der Gefangene als „Ware“
Kapitel C beleuchtet das amerikanische Modell der Gefängnisprivatisierung und untersucht die Ursachen für seine Verbreitung in den USA. Die Rolle privater Sicherheitsfirmen im amerikanischen Strafvollzug wird analysiert, und es werden die vermeintlichen Vorteile der Privatisierung in den USA diskutiert.
- Kapitel D: Teilprivatisierung im Strafvollzug in Deutschland
Das Herzstück der Arbeit liegt in Kapitel D, welches sich mit der Teilprivatisierung im deutschen Strafvollzug befasst. Die Motive und Ziele für die Privatisierung werden beleuchtet, und die verfassungsrechtlichen Grenzen für den Einsatz von Privaten im Strafvollzug werden diskutiert. Die JVA Hünfeld wird als Beispiel für die Auswirkungen der Teilprivatisierung in der Praxis untersucht.
- Kapitel E: Voraussetzungen einer sinnvollen Teilprivatisierung
Kapitel E soll die Ergebnisse der Arbeit zusammenfassen und die Voraussetzungen für eine sinnvolle Teilprivatisierung im deutschen Strafvollzug herausarbeiten.
Schlüsselwörter
Teilprivatisierung, Strafvollzug, Gefängnisprivatisierung, USA, Deutschland, JVA Hünfeld, Rechtliche Grundlagen, Formen der Privatisierung, Marktwirtschaftliche Logik, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Verfassungsmäßige Grenzen, Empirische Effekte, Ausblick.
Häufig gestellte Fragen
Ist eine vollständige Privatisierung des Strafvollzugs in Deutschland möglich?
Nein, aus verfassungsrechtlichen Gründen ist in Deutschland nur eine Teilprivatisierung möglich; hoheitliche Aufgaben müssen beim Staat verbleiben.
Was ist der Unterschied zwischen formeller und funktionaler Privatisierung?
Formelle Privatisierung ändert die Rechtsform (z. B. GmbH), während funktionale Privatisierung die Übertragung einzelner Aufgaben an private Dienstleister bedeutet.
Welche Erfahrungen gibt es mit der JVA Hünfeld?
Die JVA Hünfeld war eines der ersten Modellprojekte für Teilprivatisierung in Deutschland und dient als Beispiel für empirische Effekte auf Kosten und Qualität.
Warum wird der Strafvollzug in den USA oft kritisiert?
In den USA wird der Gefangene oft als „Ware“ betrachtet; die marktwirtschaftliche Logik privater Gefängnisfirmen steht dort häufig in der Kritik.
Was sind die Motive für eine Teilprivatisierung in Deutschland?
Hauptmotive sind leere Staatskassen, die Überbelegung der Gefängnisse und die Hoffnung auf mehr Effizienz und Modernisierung durch private Partner.
- Citar trabajo
- Philipp Woldin (Autor), 2011, (Teil-)Privatisierung im deutschen Strafvollzug, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173151