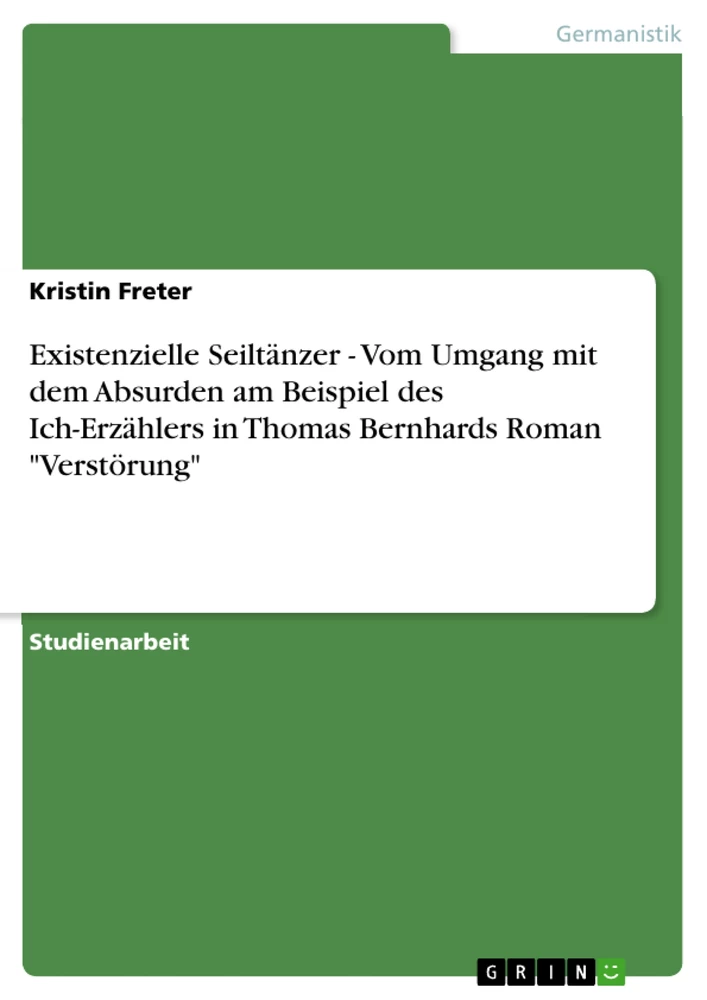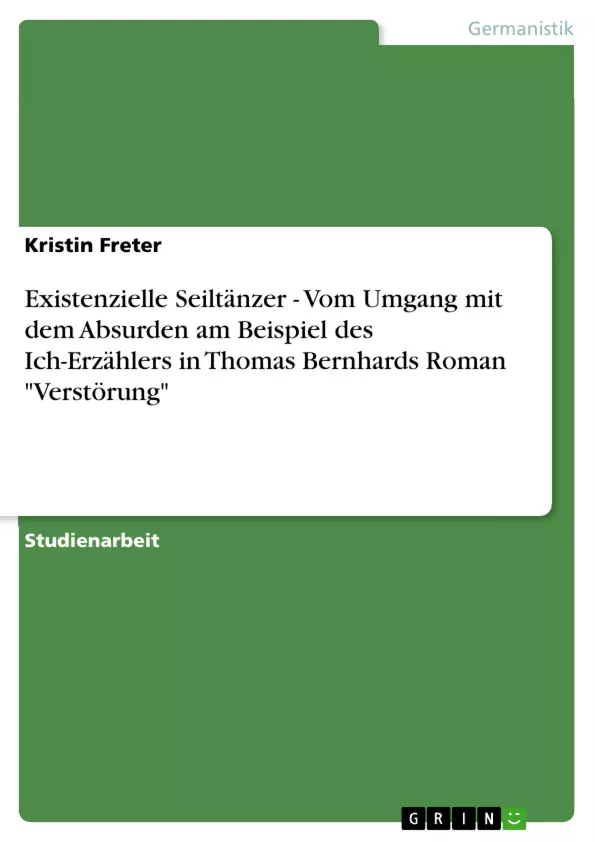Eine Welt, die man […] erklären kann, ist eine vertraute Welt.
Aber in einem Universum, das plötzlich der Illusion und des Lichts beraubt ist, fühlt der Mensch sich fremd.
Albert Camus
Dieser Grundhaltung entspricht auch das Oeuvre Thomas Bernhards und es nimmt nicht wunder, dass seine Werke überwiegend als düster rezipiert worden sind. Die Themen Krankheit, Selbstmord, Tod und eine vernichtende Umwelt (wozu Natur ebenso gehört wie andere Menschen) sind omnipräsent und präsentieren eine grausame, durch die ständige Konstante Tod sinnentleerte Welt.
[...]
Hatte sich der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki bei Thomas Bernhards Debütroman Frost (1963) noch jeglicher Kritik enthalten, reagierte er auf den vier Jahre später erschienenen zweiten Roman Verstörung (1967) mit Unverständnis: Die Werke des Österreichers bezeichnet er als „Konfessionen eines Besessenen“ und den Autor als einen Erzähler von „Krankheitsgeschichten“ . Tatsächlich sind alle Protagonisten Bernhards Geistesmenschen, die als egozentrische, monologisierende Melancholiker dem Rest der Welt als einer Masse von grobschlächtigen Instinktmenschen antipodisch gegenüberstehen.
Dass der Autor in seinen Büchern die Sinn- und Ausweglosigkeit der menschlichen Existenz aufzeigt, ist ein etablierter Gedanke in der Forschung. Dennoch hat Bernhard selbst seine Bücher stets als komisch empfunden; bereits sein Erstlingsroman Frost enthalte das philosophische Lachprogramm, welches sich durch sein ganzes Werk erstrecke.
Diesem Lachprogramm wird hier am Beispiel des Romans Verstörung nachgegangen und als Verzweiflungsabwehr angesichts einer als absurd empfundenen Welt gedeutet. Dokumentiert wird das Schwanken des Ich-Erzählers des Romans Verstörung zwischen Verzweiflungsanfälligkeit und seinen Versuchen, deprimierende Eindrücke mit Hilfe seines Verstandes zu unterdrücken.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER RAHMEN
- WERKANALYSE DES ROMANS VERSTÖRUNG
- ERZÄHLSITUATION, INHALT UND STRUKTUR DES WERKES
- LEBEN ALS KRANKHEIT ZUM TODE
- DER SCHWANKENDE ICH-ERZÄHLER
- FAZIT: IST ES EINE KOMÖDIE? IST ES EINE TRAGÖDIE?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert Thomas Bernhards Roman Verstörung. Das Ziel ist es, die komische Dimension des Romans aufzuzeigen und zu zeigen, wie diese im Kontext von Bernhards Werk und dessen Philosophie des Lachens zu verstehen ist. Der Fokus liegt dabei auf dem Schwanken des Ich-Erzählers zwischen Verzweiflung und Abwehrmechanismen, die er vor dem Absurden der Welt einsetzt.
- Die Bedeutung des Lachens im Werk Thomas Bernhards
- Die Darstellung des Absurden in Verstörung
- Die groteske Darstellung von Melancholie und Verzweiflung
- Die Seiltänzermetapher als Ausdruck des Schwankens zwischen Lachen und Weinen
- Die Rolle des Ich-Erzählers in der Konstruktion des Romans
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt Bernhards Werk im Kontext des Absurden vor und skizziert die zentralen Themen seiner Prosa.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit Bernhards philosophischer Auffassung des Komischen, die er selbst als "philosophisches Lachprogramm" bezeichnet. In diesem Kontext wird die Bedeutung der Groteske für Bernhards Werk erläutert.
Im dritten Abschnitt wird die Werkanalyse des Romans Verstörung begonnen. Der Fokus liegt dabei auf der zunehmenden Verstörung des Ich-Erzählers, die durch eine Reihe grotesker Fälle, die er im Laufe des Romans erlebt, ausgelöst wird.
Schlüsselwörter (Keywords)
Thomas Bernhard, Verstörung, Absurdes, Groteske, Melancholie, Lachprogramm, Seiltanz, Verzweiflung, Ich-Erzähler, groteske Darstellung, österreichische Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Thomas Bernhards Roman „Verstörung“?
Der Roman beschreibt die Reise eines Arztes und seines Sohnes durch eine düstere, krankhafte Welt, die von Tod, Melancholie und dem Absurden geprägt ist.
Was bedeutet das „philosophische Lachprogramm“ bei Bernhard?
Bernhard empfand seine düsteren Werke oft als komisch; das Lachen dient als Verzweiflungsabwehr gegenüber einer als sinnlos und absurd empfundenen Existenz.
Was symbolisiert die Metapher des „Seiltänzers“?
Sie steht für das Schwanken der Protagonisten zwischen totaler Verzweiflung und dem Versuch, das Absurde durch Verstand und Humor zu ertragen.
Wie wird der Ich-Erzähler in „Verstörung“ dargestellt?
Er ist ein beobachtender „Geistesmensch“, der zwischen der Anfälligkeit für Depressionen und dem intellektuellen Unterdrücken deprimierender Eindrücke schwankt.
Warum bezeichnete Reich-Ranicki Bernhard als Erzähler von „Krankheitsgeschichten“?
Wegen der Omnipräsenz von Krankheit, Tod und Besessenheit in Bernhards Werk, was bei Zeitgenossen oft auf Unverständnis stieß.
- Quote paper
- Kristin Freter (Author), 2011, Existenzielle Seiltänzer - Vom Umgang mit dem Absurden am Beispiel des Ich-Erzählers in Thomas Bernhards Roman "Verstörung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173972