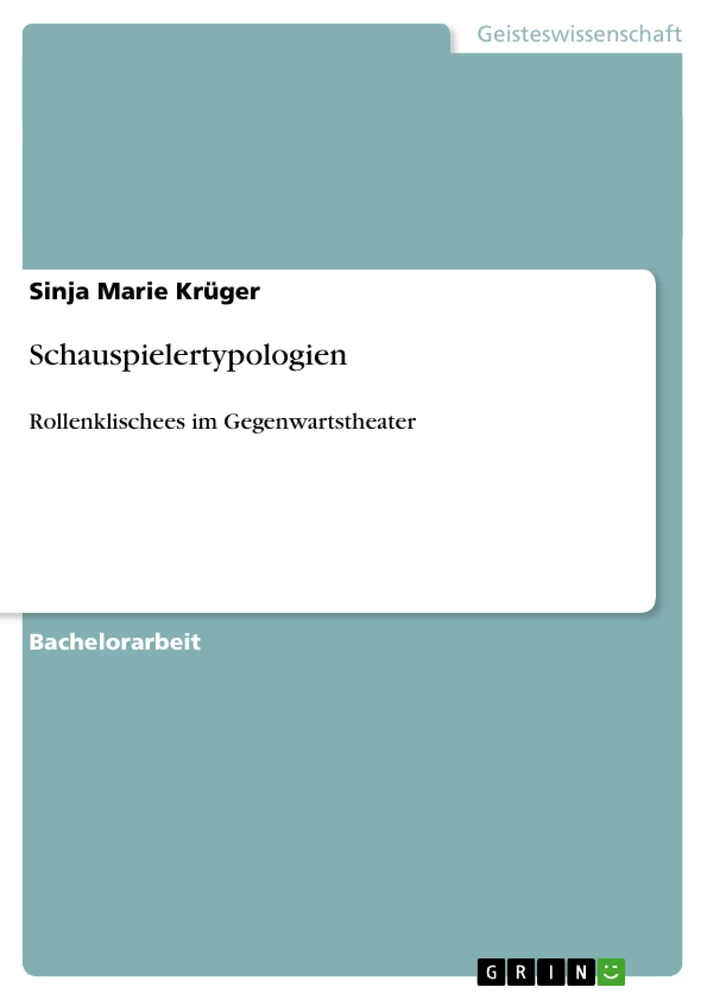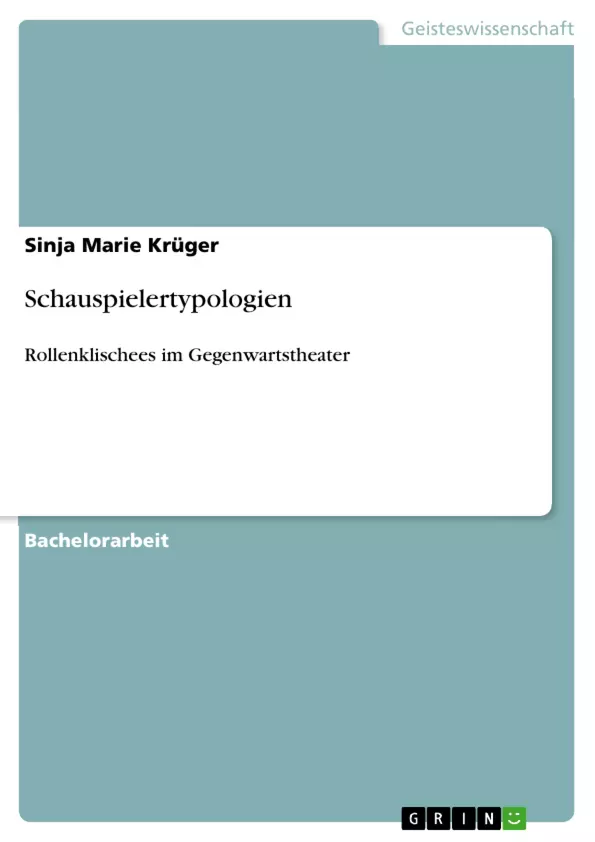Die Arbeit "Schauspielertypologien - Rollenklischees im Gegenwartstheater" befasst sich mit der Ensemblezusammensetzung und Besetzungspraxis an überregional bekannten Theatern des südlichen deutschsprachigen Raums in Bezug auf Geschlecht und Rollenklischees. In diesem Zusammenhang wird auch der Einfluss des Rollenfachsystems auf die heutige Ensemblezusammensetzung und Besetzungspraxis untersucht. Im Zentrum steht hierbei die Benachteiligung bestimmter Personengruppen aufgrund ihres Geschlechts, Alters, ihrer ethnischen Herkunft und ihrer körperlicher Konstitution.
Zunächst findet eine Einordnung des Rollenbegriffs vom historischen und soziologischen Standpunkt aus statt. Darauf folgt die Auseinandersetzung mit dem geschichtlichen Phänomen des Rollenfachsystems und seiner Bedeutung im heutigen Theaterbetrieb. Hieran schließt eine empirische Untersuchung auf Basis der Methode der Inhaltsanalyse an, bei der die Ensemblezusammensetzung und Besetzungspraxis der Münchner Kammerspiele, des Zürcher Schauspielhauses und des Schauspiel Stuttgart untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Rolle
- 2.1 Historische Anmerkungen zum Rollenbegriffs
- 2.2 Die Entwicklung des Rollenbegriffs im Theater
- 2.2.1 Die historische Entwicklung des Rollenbegriffs
- 2.2.2 Definition des Rollenbegriffs im Theater heute
- 2.3 Die Rolle als soziologische Kategorie
- 2.3.1 Definition
- 2.3.2 Rolle und Persönlichkeit
- 2.3.3 Rollenfreiheit, Rollenkonflikt und Rollendistanz
- 2.3.4 Gender und die besondere Bedeutung der sozialen Geschlechterrolle
- 2.3.5 Grenzen der soziologischen Rollentheorie
- 2.4 Bezug zwischen der Rolle als soziologische Kategorie und der Rolle im Theater
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Das Rollenfach
- 3.1 Die Entstehung des Rollenfachs
- 3.2 Die Schauspielerin und das Rollenfach
- 3.3 Rollenmonopol und vertragliche Absicherung
- 3.4 Die Abschaffung des Rollenfachs
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. Ensemble-Vergleich
- 4.1 Forschungsstand
- 4.2 Vergleich der Ensembles des Schauspiel Stuttgart, der Münchner-Kammerspiele und des Schauspielhauses Zürich
- 4.2.1 Forschungsfrage und Hypothesen
- 4.2.2 Grundgesamtheit und Stichprobe
- 4.2.3 Begründung der Untersuchungsmethode
- 4.2.4 Design des Codebuchs
- 4.2.5 Pretest
- 4.2.6 Validität, Reliabilität und Objektivität
- 4.3 Zusammenfassung
- 5. Auswertung
- 5.1 Auswertungsmethode
- 5.2 Durchführung der Auswertung
- 5.2.1 Verstärkte Berücksichtigung von Stücken des 17., 18. und 19. Jahrhunderts
- 5.2.2 Mehr männliche als weibliche festangestellte Schauspielerinnen
- 5.2.3 Mehrheit der weiblichen Schauspielerinnen jünger als fünfzig Jahre
- 5.2.4 Mehrheit der weiblichen Schauspielerinnen sehr schlank oder Normalgewichtig
- 5.2.5 Männliche und weibliche SchauspielerInnen haben eine weiße Hautfarbe und entsprechen dem mitteleuropäischen Typ
- 5.2.6 Sowohl männliche als auch weibliche SchauspielerInnen präsentieren sich im Rahmen schon seit dem 18. etablierter Rollentypen
- 5.2.7 Wenn weibliche und männliche SchauspielerInnen sich auf einen Rollentyp in der Selbstrepräsentation festlegen, spielen sie auch primär die entsprechenden Rollen
- 5.3 Zusammenfassung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Ensemblezusammensetzung und Besetzungspraxis an überregional bekannten Theatern des südlichen deutschsprachigen Raums in Bezug auf Geschlecht und Rollenklischees. Die Zielsetzung ist es, den Einfluss des Rollenfachsystems auf die heutige Ensemblezusammensetzung und Besetzungspraxis zu untersuchen. Hierbei wird auch das Verhältnis von Theater und Gesellschaft sowie die Gleichzeitigkeit, beziehungsweise Gegenläufigkeit, von Entwicklungen in beiden Bereichen beleuchtet.
- Der Einfluss historischer Strukturen auf das Gegenwartstheater
- Diskriminierung von Frauen und anderen Gruppen im Theater
- Das Verhältnis von Theater und Gesellschaft
- Die Rolle des Rollenfachsystems in der Ensemblezusammensetzung
- Die Bedeutung von Gender und Rollenklischees im Theater
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Forschungsfrage sowie die Motivation der Autorin dar. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Rolle, sowohl historisch als auch im Kontext der soziologischen Rollentheorie. Hierbei werden die Entwicklung des Rollenbegriffs im Theater, die Bedeutung der sozialen Geschlechterrolle sowie die Grenzen der soziologischen Rollentheorie untersucht. Kapitel 3 widmet sich dem Rollenfachsystem, seiner Entstehung, Entwicklung und den Auswirkungen auf die Besetzungspraxis im Theater. Kapitel 4 beschreibt die Methodik des Vergleichs von Ensembles, die Forschungsfrage und die Hypothesen, die Grundgesamtheit und Stichprobe sowie die Untersuchungsmethode, das Design des Codebuchs, den Pretest und die Validität, Reliabilität und Objektivität. Das fünfte Kapitel zeigt die Ergebnisse der Auswertung, während Kapitel 6 ein Fazit bietet und die Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter (Keywords)
Ensemblezusammensetzung, Besetzungspraxis, Rollenklischees, Rollenfachsystem, Gender, Theater, Gesellschaft, Diskriminierung, Frauen, Rollenbegriff.
- Quote paper
- Sinja Marie Krüger (Author), 2011, Schauspielertypologien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175180