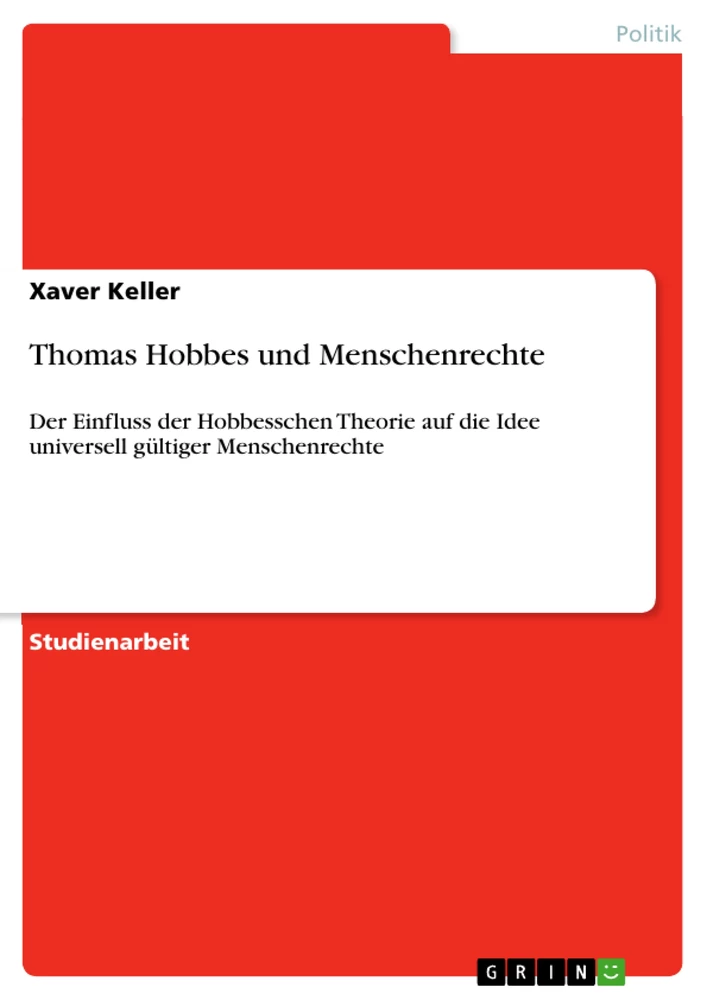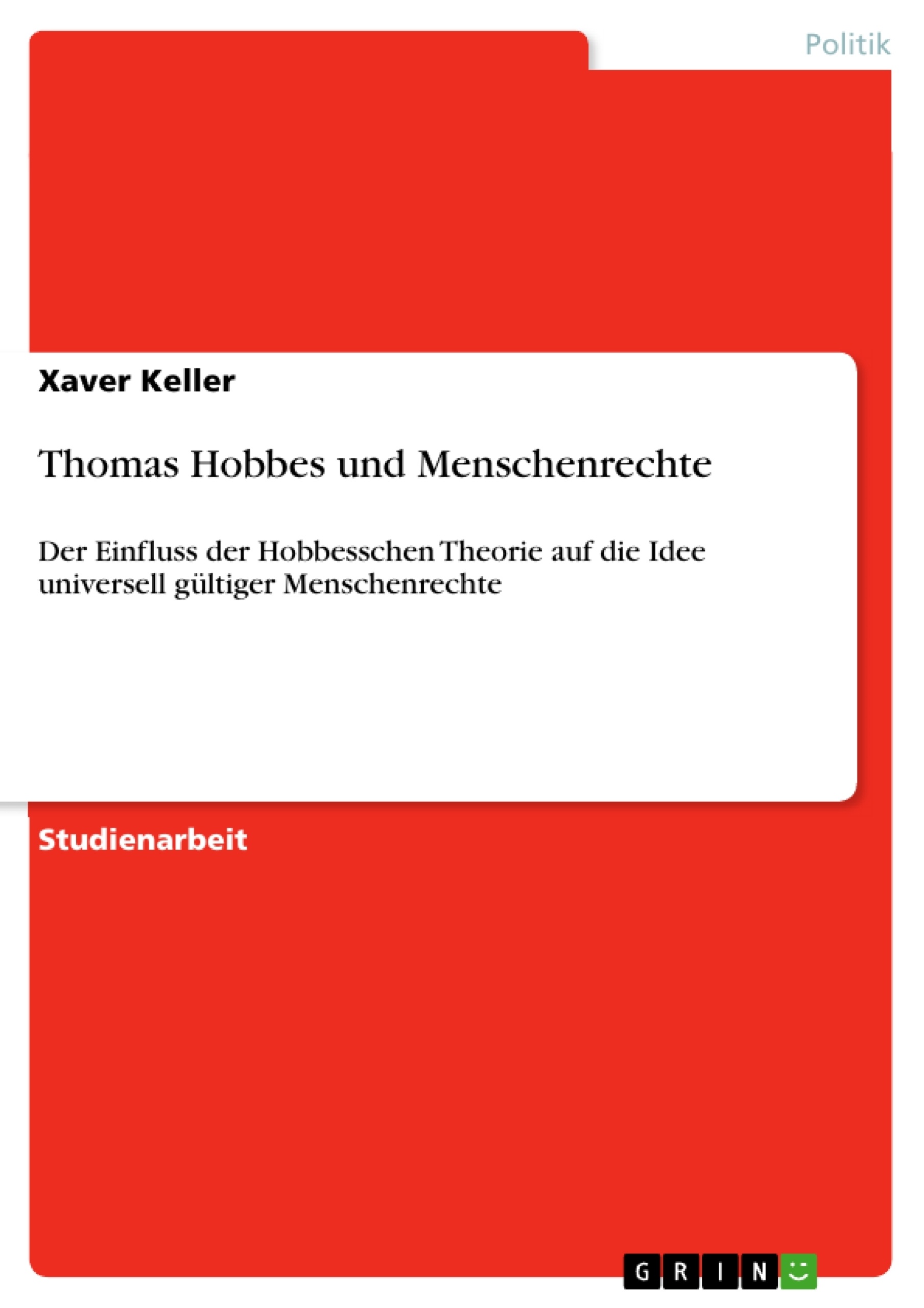Am 10. Dezember 1948 wurde die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der Ver-einten Nationen verabschiedet. Diese Erklärung trug entscheidend dazu bei, dass Men-schenrechte zu einem der bestimmenden Themen nationaler sowie internationaler Poli-tik wurden. Die weltweite Menschenrechtspolitik birgt jedoch Probleme. Einerseits zei-gen Krieg, Folter, Geschlechterungerechtigkeit, Einschränkung der Pressefreiheit oder Polizeiwillkür, um nur einige Menschenrechtsverletzungen zu nennen, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden, die Ziele der Allgemeinen Erklärung, weltweit noch immer in weiter Ferne liegen.
In der öffentlichen Debatte deutlich weniger präsent, aber von nicht minderer Wichtig-keit, ist ein weiterer gravierender Mangel in Bezug auf Menschenrechte: Trotz der weit-läufigen Anerkennung der Allgemeinen Erklärung fehlt eine allgemein anerkannte Be-gründung des darin vertretenen Menschenrechts-Konzepts. Dies bedeutet entweder, dass unsere Vorstellung von Menschenrechten auf „äußerst wackligen Beinen“ (Gosepath, Lohmann, 1998: S. 9) steht, oder dass ihr schweigend ein bestimmtes Kon-zept zugrunde liegt.
Diese Hausarbeit vertritt die These, dass es ein zugrundeliegendes Konzept gibt, das keineswegs das einzig mögliche ist. Es handelt sich dabei um das Modell individualisti-scher, liberalistischer Abwehrrechte, das in weiten Teilen auf John Locke zurückzufüh-ren ist. Dieses Modell entwarf Locke jedoch nicht aus dem Nichts. Den Boden für seine Überlegungen bereitete der etwa 50 Jahre früher lebende Thomas Hobbes, wenngleich dieser der Nachwelt vor allem als Theoretiker des Absolutismus und damit als entschie-dener Gegner der Menschenrechtsidee bekannt ist. Oftmals unbeachtet ist, dass Hobbes bei seiner Theorie von Grundannahmen über den Menschen ausgeht, die keineswegs als unumstritten und universell gültig angesehen werden können. Deshalb soll in dieser Hausarbeit zunächst aufgezeigt werden, inwiefern Hobbes einen Beitrag zur Entwick-lung des heutigen Menschenrechtsmodells geliefert hat. Abschließend soll kurz auf die Frage eingegangen werden, inwieweit ein solches Modell, das teilweise auf Hobbes auf-baut, universelle Gültigkeit beanspruchen kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. EINLEITUNG
- 2. GRUNDLEGENDE VERÄNDERUNGEN BEI HOBBES
- 2.1. NEUZEITLICHES DENKEN: DAS INDIVIDUUM WIRD ZUM BEZUGSPUNKT
- 2.2. DAS VERHÄLTNIS VON POSITIVEM UND ÜBERPOSITIVEM RECHT
- 3. HOBBES' WERK ALS GRUNDLAGE UNIVERSELLER MENSCHENRECHTE
- 3.1. INDIVIDUALISIERUNG UND INDIVIDUELLE MENSCHENRECHTE
- 3.2. GÜLTIGKEIT DES RECHTS
- 4. HISTORISCH-EMPIRISCHE BEDINGTHEIT UND UNIVERSALITÄTSANSPRUCH
- 4.1. HOBBES' THEORIE ALS SPIEGEL DER GESELLSCHAFT
- 4.2. AUSWIRKUNGEN AUF DIE UNIVERSELLE GÜLTIGKEIT VON MENSCHENRECHTEN
- 5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss von Thomas Hobbes auf die Idee universell gültiger Menschenrechte. Ziel ist es, aufzuzeigen, inwiefern Hobbes, trotz seiner bekannten These vom absoluten Souverän, einen Beitrag zur Entwicklung des heutigen Menschenrechtsmodells geleistet hat.
- Die Veränderung des Denkens durch Hobbes, die das Individuum in den Mittelpunkt stellt.
- Hobbes' Beitrag zur Begründung individueller Menschenrechte und die Frage nach der Gültigkeit des Rechts.
- Die historische und empirische Bedingtheit von Hobbes' Theorie und ihre Auswirkungen auf den Anspruch auf universelle Gültigkeit von Menschenrechten.
- Die Rolle von Hobbes' Theorie im Kontext des modernen Menschenrechtsmodells und die Grenzen seiner Anwendbarkeit.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel behandelt die Einführung in das Thema und stellt die These auf, dass Hobbes, trotz seiner Rolle als Absolutismus-Theoretiker, einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des modernen Menschenrechtsmodells geleistet hat. Das zweite Kapitel analysiert die grundlegenden Veränderungen, die Hobbes in der praktischen Philosophie einleitete. Es beleuchtet insbesondere die Abkehr vom stoizistischen/thomistischen Bild einer vorgegebenen Seinsordnung und die Hinwendung zum Individuum als Bezugspunkt. Zudem wird das Verhältnis von positivem und überpositivem Recht bei Hobbes untersucht.
Das dritte Kapitel geht auf Hobbes' Werk als Grundlage für die Idee universeller Menschenrechte ein. Es behandelt die Individualisierung und die Rolle individueller Menschenrechte in seiner Philosophie sowie die Frage der Gültigkeit des Rechts. Das vierte Kapitel befasst sich mit der historischen und empirischen Bedingtheit von Hobbes' Theorie und ihren Auswirkungen auf den Anspruch auf universelle Gültigkeit von Menschenrechten. Es analysiert Hobbes' Theorie als Spiegelbild seiner Zeit und untersucht, inwieweit sie auf unterschiedliche gesellschaftliche und politische Kontexte übertragen werden kann.
Schlüsselwörter (Keywords)
Thomas Hobbes, Menschenrechte, Individualismus, Naturzustand, Naturrecht, Gesellschaftsvertrag, Staat, Absolutismus, Universalität, Individualisierung, Empirische Bedingtheit, Politische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Thomas Hobbes als Begründer der Menschenrechte?
Traditionell gilt er als Theoretiker des Absolutismus, doch seine Philosophie legte den Grundstein, indem sie das Individuum zum neuen Bezugspunkt des Rechts machte.
Was ist der Unterschied zwischen Hobbes und Locke bei den Menschenrechten?
Locke entwickelte das Modell liberaler Abwehrrechte gegen den Staat, während Hobbes die Rechte des Individuums primär im Naturzustand verortete.
Wie begründet Hobbes die Notwendigkeit des Staates?
Durch den Naturzustand, in dem ohne Staat ein „Krieg aller gegen alle“ herrscht, was die Menschen zum Abschluss eines Gesellschaftsvertrags drängt.
Können Hobbes' Theorien einen Universalitätsanspruch erheben?
Die Hausarbeit diskutiert dies kritisch, da Hobbes' Annahmen stark von seiner historischen Zeit und dem englischen Bürgerkrieg geprägt waren.
Was bedeutet die Hinwendung zum Individuum in der praktischen Philosophie?
Es bedeutet, dass politische Ordnung nicht mehr als gottgegeben, sondern als vom Individuum und dessen Bedürfnissen (wie Sicherheit) ausgehend begründet wird.
- Quote paper
- Xaver Keller (Author), 2011, Thomas Hobbes und Menschenrechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175188