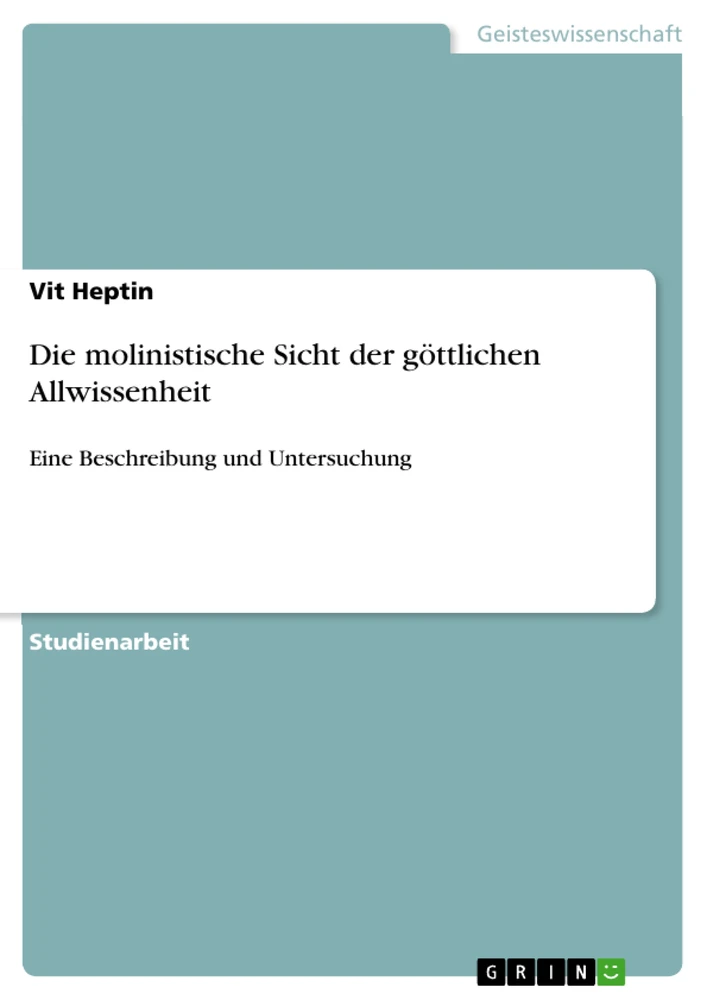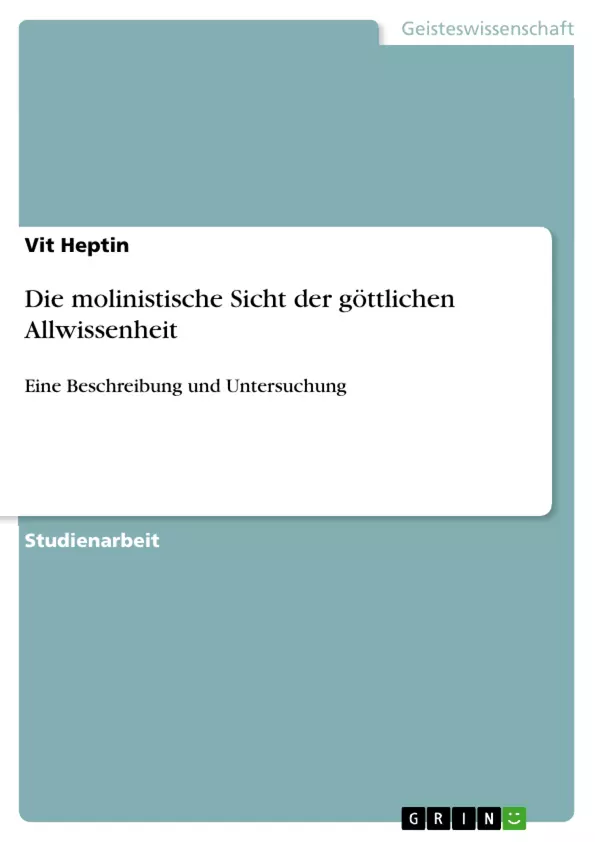Einleitung
Als der Geist von Christmas yet to come dem alten und unbarmherzigen Scrooge erschien und ihm furchtbare Bilder aus zukünftigen Weihnachtsfesten zeigte, fragte der Geizkragen: „Are these the shadows of the things that Will be, or are they shadows of things that may be, only?“ Der Geist antwortete nicht. Denn Dinge die sein werden, können nicht abgewendet werden. Auf der anderen Seite sind Dinge die sein könnten auch nicht so Furcht einflößend, da im Grunde alles eintreten könnte. Beide Male hätte Scrooge keinen überzeugenden Grund, sein Leben zu ändern. Aber der Geist antwortete nicht. Daher versucht Scrooge verzweifelt selbst eine Antwort zu schlussfolgern: „Men's courses will foreshadow certain ends, to which, if persevered in, they must lead [...] But if the courses be departed from, the ends will change.“ An den Bildern war beängstigend, dass sie zeigten was sein würde, würde Scrooge sich nicht ändern.
Gott ist allwissend. Das gehört zu seinem Wesen – sonst wäre er nicht Gott. Das scheint nachvollziehbar zu sein. Sobald man jedoch Allwissenheit definiert als: „Er weiß alles was es zu wissen gibt.“ fangen die Probleme an. Was gibt es zu wissen? Und was gibt es zu wissen über Dinge, die nie eintreffen werden (wie die schrecklichen Visionen Scrooges)? Es gibt viele Konzepte der Allwissenheit Gottes, die zurzeit in der Wissenschaft diskutiert werden. Eines von ihnen wird in dieser Hausarbeit vorgestellt. Dieses Konzept wird Molinismus genannt und hat einige beachtenswerte Ver¬treter wie William Lane Craig und Alvin Plantinga. Dabei sollen Kernbegriffe (wie mittleres Wissen) und die wichtigsten Implikationen (wie Vorsehung und Freiheit) des Molinismus erklärt werden. Zusätzlich sollen die relevantesten Fragen (wie die nach der Gültigkeit des Fatalismus und dem Wahrheitsgehalt von zukünftigen Kontrafaktualen) anhand mit der verfügbaren Literatur diskutiert werden. Zum Schluss soll ein Fazit folgen, dass die Leistungsfähigkeit bewerten und einige noch offene Fragen oder Probleme aufzeigen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Molinismus?
- Geschichtlicher Abriss
- Was ist mittleres Wissen?
- Implikationen des Molinismus
- Ist göttliches Vorwissen mit zukünftigen Kontingenten vereinbar?
- Was ist Fatalismus?
- Ist der Fatalismus schlüssig?
- Wie kennt Gott zukünftige Kontingente?
- Haben zukünftige Kontingente einen Wahrheitsgehalt?
- Wie erhält Gott sein Vorwissen?
- Was leistet das molinistische Konzept?
- Weitgehend naturalistische Geschichte
- Freiheit
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Molinismus, einem Konzept der göttlichen Allwissenheit, das von dem Jesuiten Louis de Molina entwickelt wurde. Ziel ist es, die Kernbegriffe des Molinismus, wie das mittlere Wissen, sowie seine Implikationen für die Vorsehung und die menschliche Freiheit zu erläutern.
- Das Konzept des mittleren Wissens und seine Rolle im Molinismus
- Die Vereinbarkeit von göttlichem Vorwissen und menschlicher Freiheit
- Die Implikationen des Molinismus für die Frage der Vorsehung
- Die Auseinandersetzung mit dem Fatalismus und seiner Schlüssigkeit
- Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von zukünftigen Kontingenten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Molinismus in den Kontext der Debatte um die göttliche Allwissenheit dar.
- Kapitel 2 erklärt die historische Entwicklung des Molinismus sowie das zentrale Konzept des mittleren Wissens. Außerdem werden die wichtigsten Implikationen des Molinismus für die Vorsehung und die menschliche Freiheit diskutiert.
- Kapitel 3 befasst sich mit der Frage, ob göttliches Vorwissen mit zukünftigen Kontingenten vereinbar ist. Dazu wird der Begriff des Fatalismus beleuchtet und seine Schlüssigkeit hinterfragt.
- Kapitel 4 untersucht, wie Gott zukünftige Kontingente kennen kann. Dazu wird die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von zukünftigen Kontingenten gestellt und die Frage, wie Gott sein Vorwissen erhält, diskutiert.
- Kapitel 5 untersucht die Leistung des molinistischen Konzepts, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit einer weitgehend naturalistischen Geschichte und der menschlichen Freiheit.
Schlüsselwörter
Molinismus, göttliche Allwissenheit, mittleres Wissen, Vorsehung, Freiheit, Fatalismus, zukünftige Kontingenten, mögliche Welten, Kontrafaktuale, naturalistische Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Molinismus?
Ein von Louis de Molina entwickeltes Konzept, das versucht, die göttliche Allwissenheit mit der menschlichen Willensfreiheit zu vereinbaren.
Was versteht man unter "mittlerem Wissen" (scientia media)?
Es ist Gottes Wissen darüber, was jedes freie Wesen in jeder denkbaren Situation tun würde (Wissen über Kontrafaktuale der Freiheit).
Wie löst der Molinismus das Problem der Vorsehung?
Gott nutzt sein mittleres Wissen, um eine Welt zu erschaffen, in der seine Ziele erreicht werden, ohne die freien Entscheidungen der Menschen zu determinieren.
Was ist Fatalismus und wie grenzt sich der Molinismus ab?
Fatalismus besagt, dass alles Unausweichliche eintreten muss. Der Molinismus argumentiert, dass Vorwissen nicht gleichbedeutend mit Zwang ist und Freiheit bestehen bleibt.
Wer sind moderne Vertreter des molinistischen Konzepts?
In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion wird der Molinismus unter anderem von William Lane Craig und Alvin Plantinga vertreten.
- Quote paper
- Vit Heptin (Author), 2009, Die molinistische Sicht der göttlichen Allwissenheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175189