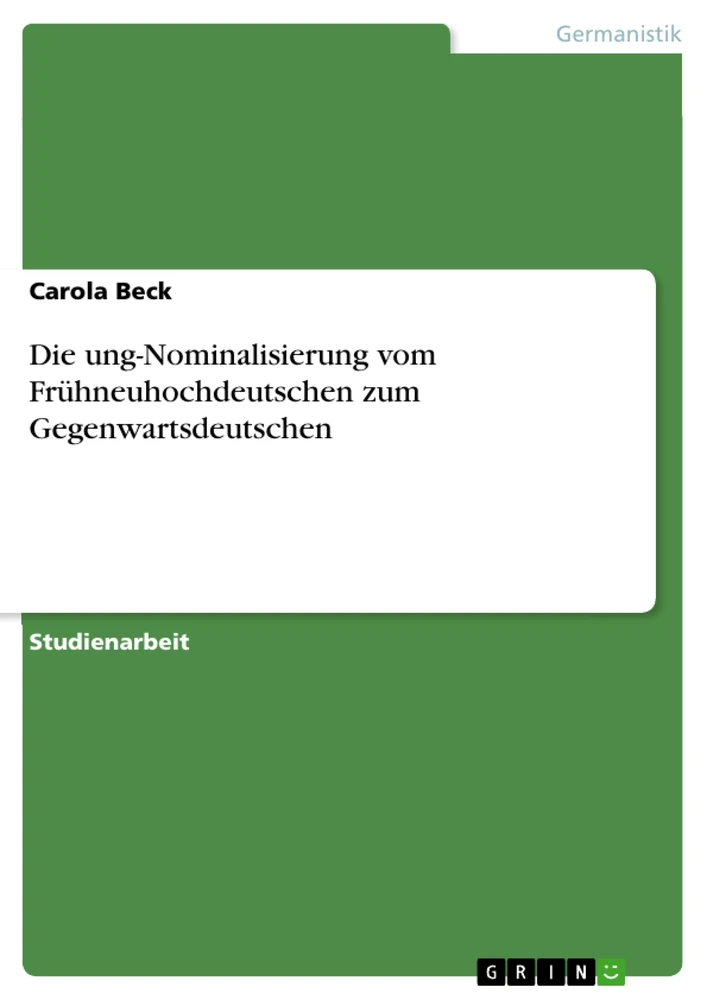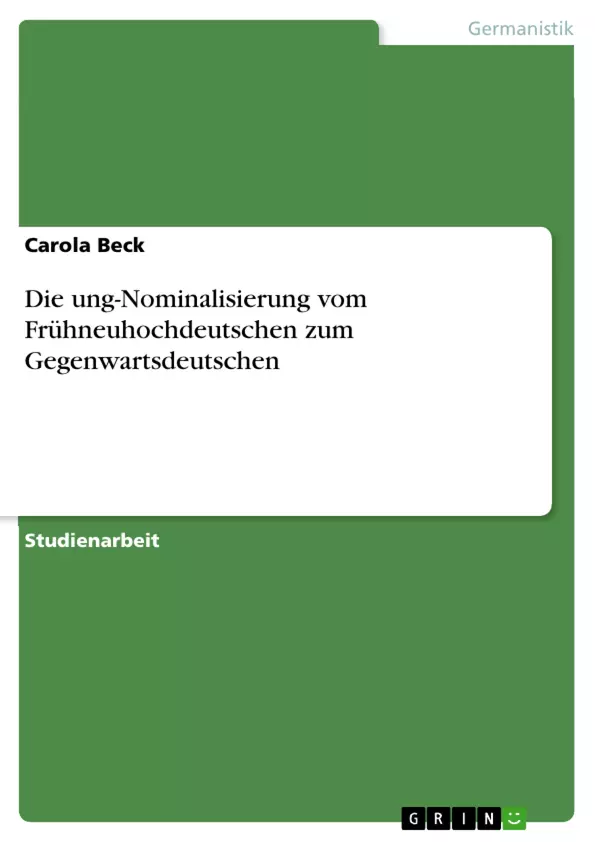Heutzutage werden Substantive, die mit Hilfe der Derivation mit –ung gebildet werden, nur noch in bestimmten semantischen Rahmen erzeugt und benutzt. Zwar gibt es auch hier Ausnahmen, doch sind diese aus früheren Sprachformen des Deutschen übernommen. Abgesehen von diesen Fällen, ist es nicht mehr so einfach wie im Frühneuhochdeutschen, Substantive mit –ung zu bilden. In der Literatur wird zwar rege über die Nominalisierung von Verben mit Hilfe des Suffixes –ung diskutiert, doch kann bis heute nicht klar festgelegt werden, weshalb und wie das Wortbildungspotential der ung-Nominalisierung eingeschränkt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Flexion und Derivation
- Flexion
- Derivation
- UNG-Nominalisierung im diachronen Überblick vom Frühneuhochdeutschen zum Gegenwartsdeutschen
- UNG-Derivate im Frühneuhochdeutschen
- UNG-Derivate im Gegenwartsdeutschen
- Was spielt eine Rolle bei der Realisierung von ung-Derivaten?
- Unterschiede zwischen frühneuhochdeutscher und gegenwartsdeutscher Nutzung von ung-Derivaten
- Das Lexikon
- Zusammenschau
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Flexionsmorphologie, genauer gesagt mit der Derivation mit -ung. Das Suffix -ung ist ein sehr produktives Mittel zur Bildung von Substantiven auf Basis von Verben. Die Arbeit untersucht, wie sich die Bildung und Verwendung von -ung-Derivaten vom Frühneuhochdeutschen bis zum Gegenwartsdeutschen entwickelt hat.
- Diachrone Entwicklung der -ung-Nominalisierung
- Produktivität und Einschränkungen der -ung-Derivation
- Semantische und morphologische Faktoren, die die Realisierung von -ung-Derivaten beeinflussen
- Vergleich der Verwendung von -ung-Derivaten im Frühneuhochdeutschen und Gegenwartsdeutschen
- Das Lexikon als Quelle für die Untersuchung der -ung-Nominalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Thema der Hausarbeit vor. Sie diskutiert die Bedeutung der -ung-Nominalisierung und die Besonderheiten ihrer Entwicklung vom Frühneuhochdeutschen zum Gegenwartsdeutschen.
- Im Kapitel "Flexion und Derivation" werden grundlegende morphologische Konzepte erklärt, um den Kontext für die Untersuchung der -ung-Nominalisierung zu schaffen. Hier werden die Unterschiede zwischen Flexion und Derivation sowie die Rolle von Affixen und Morphemen erläutert.
- Das Kapitel "UNG-Nominalisierung im diachronen Überblick vom Frühneuhochdeutschen zum Gegenwartsdeutschen" bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der -ung-Nominalisierung. Es werden die wichtigsten Veränderungen im Bereich der morphologischen Produktivität und semantischen Verwendung des Suffixes -ung im Laufe der Zeit dargestellt.
- Die Kapitel "UNG-Derivate im Frühneuhochdeutschen" und "UNG-Derivate im Gegenwartsdeutschen" analysieren die -ung-Derivate in den beiden Sprachperioden. Es werden Beispiele und Besonderheiten der Bildung und Verwendung von -ung-Derivaten in diesen Perioden untersucht.
- Das Kapitel "Was spielt eine Rolle bei der Realisierung von ung-Derivaten?" befasst sich mit den Faktoren, die die Realisierung von -ung-Derivaten beeinflussen. Es werden sowohl semantische als auch morphologische Faktoren betrachtet, die eine Rolle für die Bildung und Verwendung von -ung-Derivaten spielen.
- Das Kapitel "Unterschiede zwischen frühneuhochdeutscher und gegenwartsdeutscher Nutzung von ung-Derivaten" vergleicht die Verwendung von -ung-Derivaten in den beiden Sprachperioden. Es werden die Unterschiede in der Produktivität, der semantischen Bandbreite und der morphologischen Einschränkungen der -ung-Nominalisierung hervorgehoben.
- Das Kapitel "Das Lexikon" beschäftigt sich mit der Rolle des Lexikons für die Untersuchung der -ung-Nominalisierung. Es werden die Erkenntnisse aus dem Lexikon für die Analyse der -ung-Derivate und deren historischen Entwicklung genutzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Flexionsmorphologie, Derivation, -ung-Nominalisierung, Frühneuhochdeutsch, Gegenwartsdeutsch, morphologische Produktivität, semantische Entwicklung, Wortbildungsregel, Lexikon, diachrone Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Suffix -ung in der deutschen Sprache?
Das Suffix -ung ist ein produktives Mittel zur Derivation, mit dem aus Verben Substantive gebildet werden (z. B. „Bildung“ von „bilden“).
Wie hat sich die Produktivität der -ung-Nominalisierung verändert?
Während im Frühneuhochdeutschen die Bildung von -ung-Derivaten sehr flexibel war, ist sie im Gegenwartsdeutschen auf bestimmte semantische Rahmen eingeschränkt.
Was ist der Unterschied zwischen Flexion und Derivation?
Flexion verändert die grammatische Form eines Wortes (z. B. Konjugation), während Derivation neue Wörter mit einer neuen Bedeutung oder Wortart schafft.
Welche Faktoren beeinflussen die Bildung von -ung-Derivaten?
Sowohl morphologische Regeln als auch semantische Faktoren (Bedeutung des Verbs) spielen eine Rolle dabei, ob ein -ung-Substantiv als natürlich empfunden wird.
Warum sind manche -ung-Bildungen heute nicht mehr gebräuchlich?
Das Wortbildungspotential hat sich im Laufe der Zeit gewandelt; viele alte Formen existieren nur noch als lexikalisierte Ausnahmen aus früheren Sprachperioden.
Welche Sprachperioden vergleicht die Hausarbeit?
Die Untersuchung zieht einen diachronen Vergleich zwischen dem Frühneuhochdeutschen und dem heutigen Gegenwartsdeutschen.
- Quote paper
- Carola Beck (Author), 2008, Die ung-Nominalisierung vom Frühneuhochdeutschen zum Gegenwartsdeutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175301