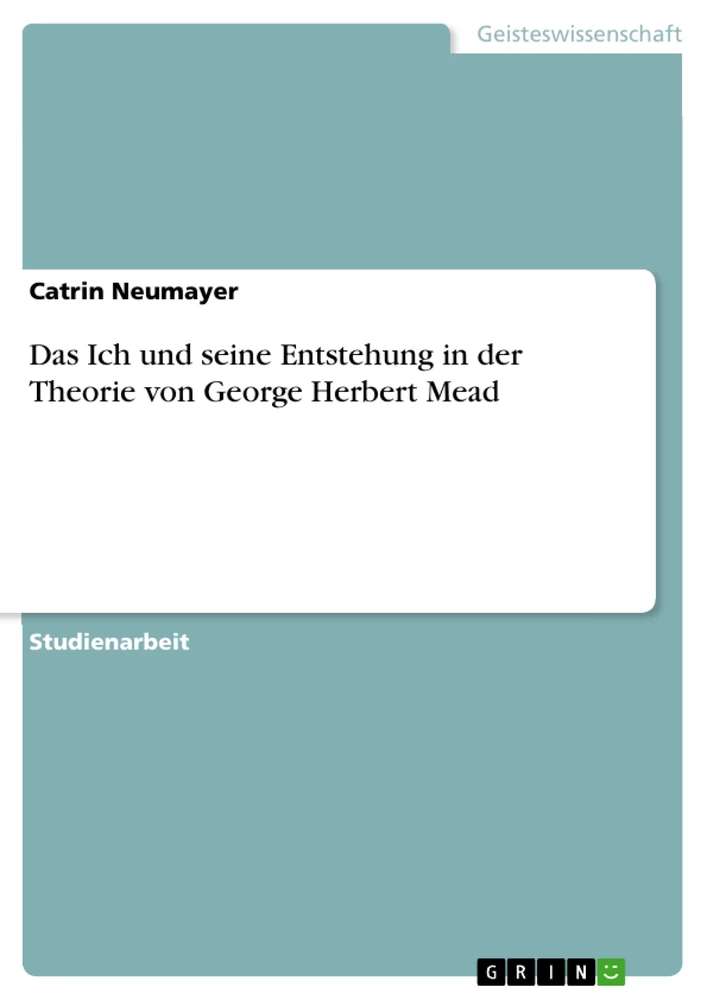2. Zielsetzung
Ziel dieser Arbeit ist es, die von George Herbert Mead, einem der wichtigsten
Vertreter und Mitbegründer des amerikanischen Pragmatismus, gelieferten
Ansichten zur Entstehung des Ich, welche in der gleichnamigen Publikation
thematisiert wird, zu hinterfragen. Demnach sucht diese Arbeit die von Mead
entwickelte Theorie zur Entwicklung des Ichs und die dafür nötigen (kindlichen)
Entwicklungsschritte, die sich Mead durch unterschiedliche Formen des Spiels
erklärt, durch welche das Kind in Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner
Umgebung Sozialisierungstendenzen entwickelt, die zur Entstehung einer Identität
führen. Folglich soll nach der Beschreibung der Person und des Lebenslauf Meads,
eine Hinwendung zur Thmematik durch Definition der für die Arbeit konstitutiven
Begriffe getroffen werden.
Des Weiteren soll die Entstehung der Identität aus der Sicht Meads geklärt werden,
worauf auf die unterschiedlichen, in Meads Sichtweise dafür notwendigen Schritte
der Entwicklungen eigengegangen werden soll. Aus diesem Verständnis heraus soll
das entstandene Ich, hinterfragt werden, was zu einer kritischen Hinterfragung der
Theorie Meads vor allem im Hinblick auf die komplexen Unterscheidungen von I &
ME führen soll, aus der eine (mögliche) Kritik an Meads Theorie entwickelt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Zur Person Herbert Mead
- Hinwendung zur Thematik
- Definition Kommunikation
- Definition soziale Interaktion
- Definition Gebärden und Gesten
- Die Entstehung der Identität
- Play & Game
- Play
- imaginäres Spiel
- Rollenspiel
- Das Signifikante Andere
- Game
- Das Generalisierte Andere
- Play
- Play & Game
- Das Ich in der Theorie von George Herbert Mead
- I
- Me
- Self
- Problematisierungspotenziale durch die Unterscheidung von I & ME
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht George Herbert Meads Theorie zur Entstehung des Ichs. Sie analysiert Meads Konzept der Ich-Entwicklung durch verschiedene Spielformen und die daraus resultierende Sozialisierung, die zur Herausbildung einer Identität führt. Die Arbeit beleuchtet zudem die zentralen Begriffe von Meads Theorie und hinterfragt kritisch die Unterscheidung zwischen "I" und "Me".
- Entstehung des Ichs nach Mead
- Rollenspiel und die Entwicklung des Selbst
- Das signifikante und das generalisierte Andere
- Die Bedeutung sozialer Interaktion für die Identitätsbildung
- Kritische Auseinandersetzung mit Meads "I" und "Me"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der meadschen Handlungs- und Interaktionstheorie ein und hebt die zentrale Bedeutung des Satzes "Wir müssen andere sein, um wir selbst sein zu können" hervor. Sie präsentiert Mead als wichtigen Vertreter des Sozialbehaviourismus und dessen Einfluss auf die moderne Soziologie. Der Fokus liegt auf der Relevanz von Meads Werk und der Notwendigkeit, seine Theorie zur Ich-Entwicklung zu untersuchen.
2. Zielsetzung: Dieses Kapitel beschreibt das Ziel der Arbeit: die kritische Auseinandersetzung mit Meads Theorie zur Entstehung des Ichs. Es skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse von Meads Konzept der kindlichen Entwicklungsschritte durch verschiedene Spielformen umfasst, und kündigt die Beschreibung von Meads Biographie und die Definition wichtiger Begriffe an. Das Kapitel betont die anschließende kritische Hinterfragung von Meads Theorie, insbesondere der Unterscheidung zwischen "I" und "Me".
3. Zur Person Herbert Mead: Leben & Werk: Dieses Kapitel bietet eine Biografie von George Herbert Mead, die seine akademischen Tätigkeiten, seinen Einfluss auf den Pragmatismus und seine Verbindung zur "Chicagoer Schule" beleuchtet. Es beschreibt Meads intellektuelle Entwicklung, seine Studien in den USA und Deutschland, und seinen Beitrag zur Entwicklung des Pragmatismus als philosophische Strömung. Der Abschnitt betont Meads Einfluss auf die Soziologie und Sozialpsychologie.
4. Hinwendung zur Thematik: Dieses Kapitel definiert grundlegende Begriffe wie soziale Interaktion, um die weitere Auseinandersetzung mit Meads Theorie zu ermöglichen. Die Definitionen legen den Fokus auf die wechselseitige Orientierung von Individuen im Handlungsprozess und den situativen Charakter von Interaktionen. Es stellt die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel dar.
Schlüsselwörter
George Herbert Mead, Ich-Entwicklung, Sozialbehaviourismus, Pragmatismus, soziale Interaktion, Identität, Rollenspiel, signifikantes Anderes, generalisiertes Anderes, I, Me, Self.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: George Herbert Meads Theorie der Ich-Entwicklung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über George Herbert Meads Theorie der Ich-Entwicklung. Sie beinhaltet eine Einleitung, die Zielsetzung, eine Biografie Meads, Definitionen wichtiger Begriffe (Kommunikation, soziale Interaktion, Gesten), eine detaillierte Erklärung von Meads Konzept des „Play“ und „Game“ mit den Begriffen des „signifikanten“ und „generalisierten Anderen“, eine Analyse des „I“, „Me“ und „Self“, sowie eine Schlussfolgerung. Die Arbeit analysiert kritisch die Unterscheidung zwischen „I“ und „Me“ und untersucht die Bedeutung sozialer Interaktion für die Identitätsbildung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entstehung des Ichs nach Mead, das Rollenspiel und die Entwicklung des Selbst, das signifikante und generalisierte Andere, die Bedeutung sozialer Interaktion für die Identitätsbildung und eine kritische Auseinandersetzung mit Meads „I“ und „Me“.
Wer war George Herbert Mead?
Die Arbeit enthält einen Abschnitt über die Biografie von George Herbert Mead, der seine akademischen Tätigkeiten, seinen Einfluss auf den Pragmatismus und seine Verbindung zur „Chicagoer Schule“ beleuchtet. Sein Beitrag zur Entwicklung des Pragmatismus und sein Einfluss auf Soziologie und Sozialpsychologie werden hervorgehoben.
Wie definiert Mead wichtige Begriffe wie Kommunikation und soziale Interaktion?
Die Arbeit bietet Definitionen für soziale Interaktion, Kommunikation und Gesten. Der Fokus liegt auf der wechselseitigen Orientierung von Individuen im Handlungsprozess und dem situativen Charakter von Interaktionen. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis von Meads Theorie.
Was sind „Play“ und „Game“ in Meads Theorie?
Meads „Play“-Phase beschreibt das imaginäre Rollenspiel des Kindes, wo es einzelne Rollen einnimmt (z.B. Mutter, Vater). Das „Game“ hingegen erfordert die Berücksichtigung mehrerer Rollen gleichzeitig und die Perspektive des „generalisierten Anderen“. Hier entwickelt sich das Verständnis von Regeln und sozialen Erwartungen.
Was bedeuten „signifikantes Anderes“ und „generalisiertes Anderes“?
Das „signifikante Andere“ bezieht sich auf wichtige Bezugspersonen im Leben eines Kindes, deren Perspektiven und Erwartungen es im Rollenspiel internalisiert. Das „generalisierte Andere“ repräsentiert die Gesamtheit der gesellschaftlichen Erwartungen und Normen, die das Individuum im „Game“ verinnerlicht.
Was ist der Unterschied zwischen „I“, „Me“ und „Self“ in Meads Theorie?
Das „I“ ist der impulsive, spontane und kreative Aspekt des Selbst. Das „Me“ repräsentiert die internalisierten sozialen Erwartungen und Normen. Das „Self“ ist die Einheit aus „I“ und „Me“, die das reflektierende Bewusstsein und die Identität des Individuums darstellt. Die Arbeit analysiert kritisch die Problematik der Unterscheidung zwischen „I“ und „Me“.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse der Analyse von Meads Theorie zusammen und bewertet deren Bedeutung für das Verständnis von Ich-Entwicklung und Sozialisation. Sie könnte auch offene Fragen oder zukünftige Forschungsansätze benennen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: George Herbert Mead, Ich-Entwicklung, Sozialbehaviourismus, Pragmatismus, soziale Interaktion, Identität, Rollenspiel, signifikantes Anderes, generalisiertes Anderes, I, Me, Self.
- Arbeit zitieren
- Catrin Neumayer (Autor:in), 2010, Das Ich und seine Entstehung in der Theorie von George Herbert Mead, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175728