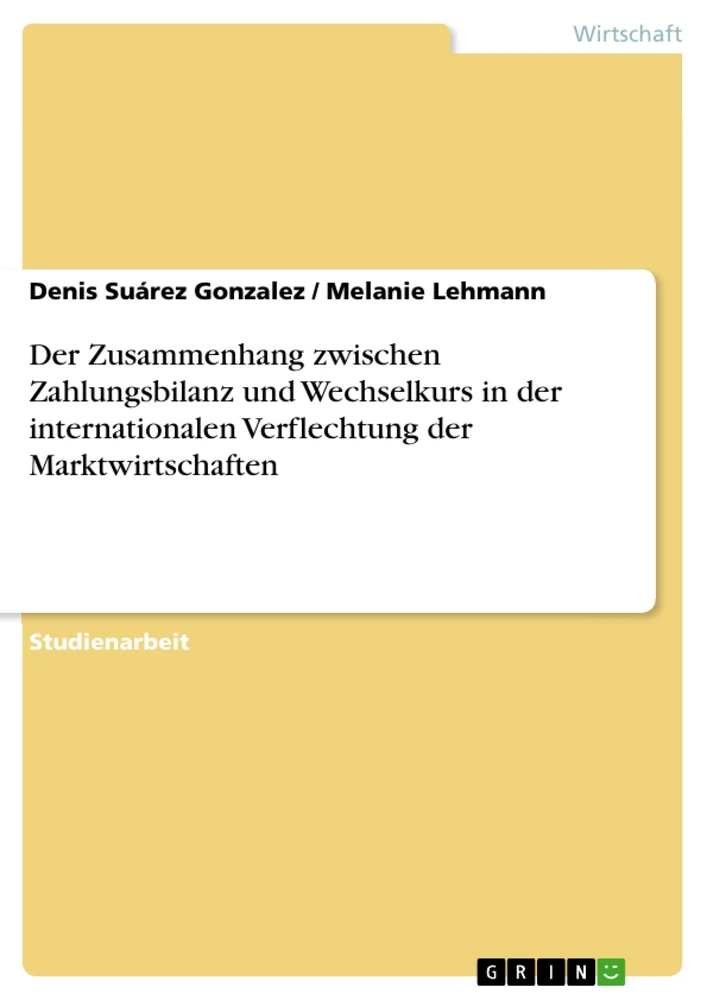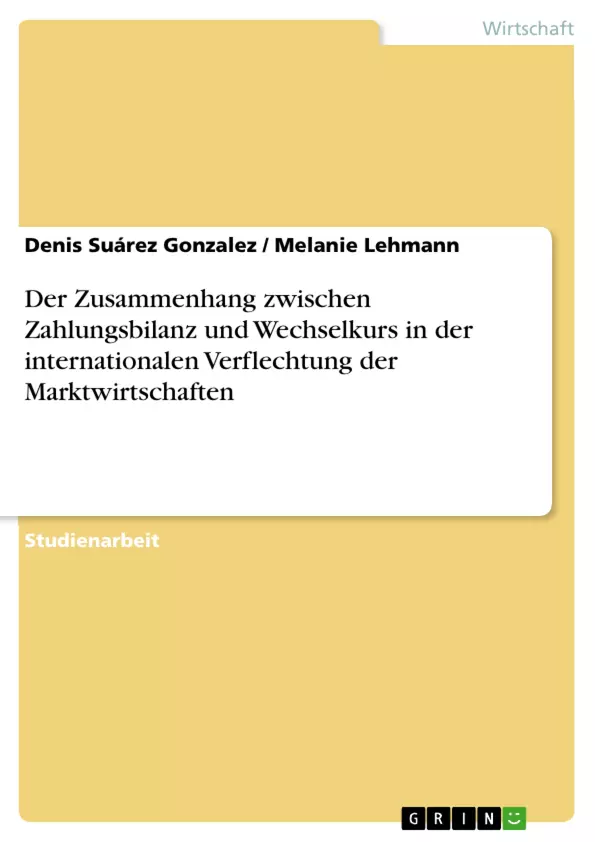Einführung in die Thematik
„Wechselkursänderungen werden in der Regel als eine bedeutende Bestimmungsgröße internationaler Preiswettbewerbsfähigkeit betrachtet.“ In einer Welt zunehmender internationaler Verflechtung ist es wichtig zu begreifen, welche Mechanismen die Tauschverhältnisse gegenwärtig tangieren. Doch nur wenige Menschen sind sich bewusst, wie und warum Geld entstand und welche Funktionen oder Vorteile sich aus seinem Gebrauch für alle Akteure ergeben. Es scheint heute selbstverständlich Sach- oder Dienstleistungen gegen Geld in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen erwerben oder veräußern zu können. Im Zuge der zunehmenden internationalen Verflechtung ist wurde es möglich, diese auch aus dem Ausland zu beziehen. Die damit einhergehende Verflechtung hat bisweilen eine Komplexität erreicht, welche sowohl auf institutioneller, als auch wissenschaftlicher Ebene an Aufmerksamkeit gewann. So ging man dazu über, ähnlich der betrieblichen Buchführung alle Transaktionen einer Volkswirtschaft zu erfassen und auszuwerten. Die theoretische und empirische Auseinandersetzung lieferte eine stetig weiterentwickelte Systematik, die Rückschlüsse auf Ursache und Wirkung der mittlerweile vielfältigen Handelsbeziehungen erlauben und den Zusammenhang zwischen Zahlungsbilanzen einzelner Volkswirtschaften und den Wechselkursen ihrer Währungen beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung in die Thematik
- 1.2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Thematischer Grundriss
- 2.1. Geld, Währung, Sorten und Devisen
- 2.2. Devisen und Wechselkurse im thematischen Kontext
- 2.3. Währungen und Wechselkurse in historischen Währungssystemen
- 2.3.1. Der klassische Goldstandard
- 2.3.2. Der Gold-Devisen-Standard
- 2.3.4. Das Bretton-Woods-System
- 2.3.5. Das Floating: Beginn der Ära flexibler Wechselkurse
- 2.4. Globalisierung: Die Verflechtung der Marktwirtschaften
- 3. Der Zusammenhang von Zahlungsbilanz und Wechselkursbildung
- 3.1. Leistungsbilanz und Wechselkurs
- 3.2. Kapitalbilanz im engeren Sinn
- 3.3. Devisenbilanz - Bestandteil der Kapitalbilanz im weiteren Sinn
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs in international verflochtenen Marktwirtschaften. Ziel ist es, die komplexen Wechselwirkungen zwischen diesen beiden ökonomischen Größen zu beleuchten und verschiedene historische Währungssysteme im Kontext ihrer Auswirkungen auf Wechselkursentwicklungen zu analysieren.
- Der Einfluss verschiedener Währungssysteme (Goldstandard, Bretton Woods, Floating) auf Wechselkurse
- Die Beziehung zwischen Leistungsbilanz und Wechselkurs
- Die Rolle der Kapitalbilanz und Devisenbilanz in der Wechselkursbildung
- Die Bedeutung der Globalisierung für die internationalen Beziehungen zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs
- Theoretische Modelle und deren Anwendung auf empirische Beobachtungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Zusammenhangs zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs ein und beschreibt die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Es skizziert den thematischen Rahmen und die Forschungsfrage.
2. Thematischer Grundriss: Dieser Abschnitt legt die Grundlagen für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge. Es werden die Konzepte von Geld, Währung, Sorten und Devisen erläutert, sowie der Bezug zu Wechselkursen hergestellt. Die historischen Währungssysteme (klassischer Goldstandard, Gold-Devisen-Standard, Bretton-Woods-System und das System flexibler Wechselkurse) werden im Detail vorgestellt und ihre jeweiligen Auswirkungen auf Wechselkurse analysiert. Die Globalisierung und deren Einfluss auf die Verflechtung der Marktwirtschaften wird ebenfalls beleuchtet, um den Kontext für die spätere Analyse des Zusammenhangs zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs zu schaffen.
3. Der Zusammenhang von Zahlungsbilanz und Wechselkursbildung: Das Kernkapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkursbildung. Es untersucht detailliert die Beziehung zwischen Leistungsbilanz und Wechselkurs, wobei sowohl die theoretischen Grundlagen als auch empirische Aspekte berücksichtigt werden. Weiterhin wird die Rolle der Kapitalbilanz im engeren und weiteren Sinne (inklusive Devisenbilanz) bei der Wechselkursbildung untersucht. Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Komponenten der Zahlungsbilanz und deren Einfluss auf den Wechselkurs werden systematisch dargestellt und erläutert.
Schlüsselwörter
Zahlungsbilanz, Wechselkurs, Währungssystem, Goldstandard, Bretton-Woods-System, Floating, Leistungsbilanz, Kapitalbilanz, Devisenbilanz, Globalisierung, Marktwirtschaft, internationale Verflechtung, ökonomische Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Zahlungsbilanz und Wechselkurs
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs in international verflochtenen Marktwirtschaften. Sie analysiert die Wechselwirkungen zwischen diesen beiden ökonomischen Größen und betrachtet verschiedene historische Währungssysteme im Kontext ihrer Auswirkungen auf Wechselkursentwicklungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Einfluss verschiedener Währungssysteme (Goldstandard, Bretton Woods, Floating) auf Wechselkurse; die Beziehung zwischen Leistungsbilanz und Wechselkurs; die Rolle der Kapitalbilanz und Devisenbilanz in der Wechselkursbildung; die Bedeutung der Globalisierung für die internationalen Beziehungen zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs; sowie theoretische Modelle und deren Anwendung auf empirische Beobachtungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau. Kapitel 2 (Thematischer Grundriss) legt die Grundlagen, erklärt Konzepte wie Geld, Währung und Devisen und beschreibt historische Währungssysteme. Kapitel 3 (Zusammenhang von Zahlungsbilanz und Wechselkursbildung) analysiert den Kernzusammenhang, untersucht die Beziehung zwischen Leistungsbilanz und Wechselkurs und die Rolle der Kapital- und Devisenbilanz. Kapitel 4 (Zusammenfassung und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche historischen Währungssysteme werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den klassischen Goldstandard, den Gold-Devisen-Standard, das Bretton-Woods-System und das System flexibler Wechselkurse (Floating) und deren Auswirkungen auf die Wechselkursentwicklung.
Welche Rolle spielt die Globalisierung in der Arbeit?
Die Globalisierung und ihr Einfluss auf die Verflechtung der Marktwirtschaften wird als Kontext für die Analyse des Zusammenhangs zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zahlungsbilanz, Wechselkurs, Währungssystem, Goldstandard, Bretton-Woods-System, Floating, Leistungsbilanz, Kapitalbilanz, Devisenbilanz, Globalisierung, Marktwirtschaft, internationale Verflechtung, ökonomische Beziehungen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs zu beleuchten und die Auswirkungen verschiedener historischer Währungssysteme auf die Wechselkursentwicklungen zu analysieren.
- Quote paper
- B. Sc. Denis Suárez Gonzalez (Author), Melanie Lehmann (Author), 2011, Der Zusammenhang zwischen Zahlungsbilanz und Wechselkurs in der internationalen Verflechtung der Marktwirtschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175851