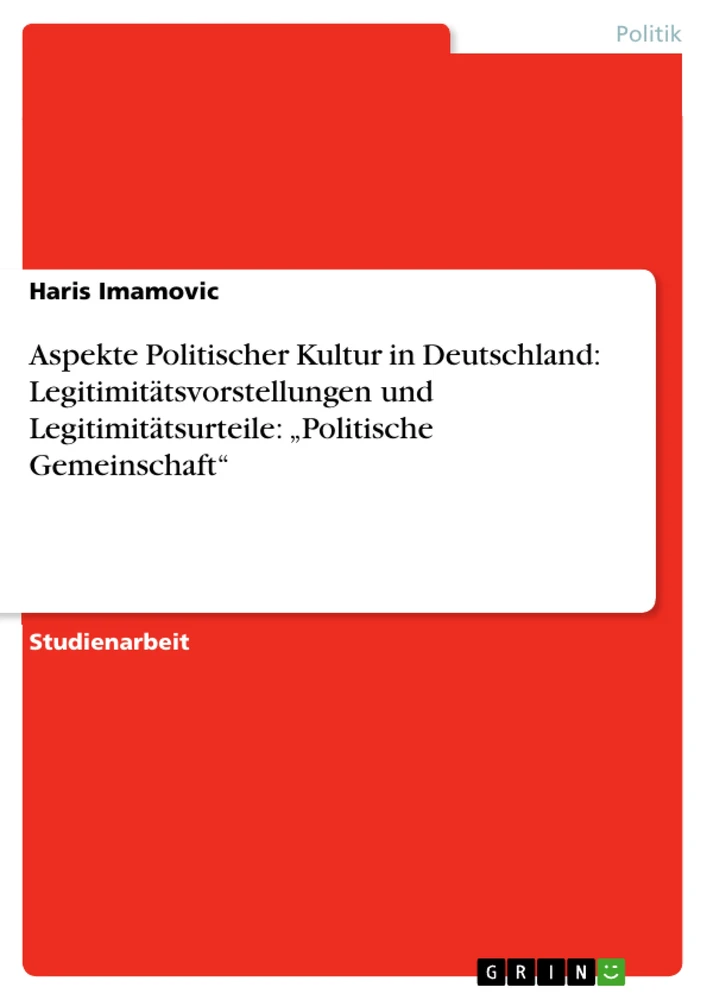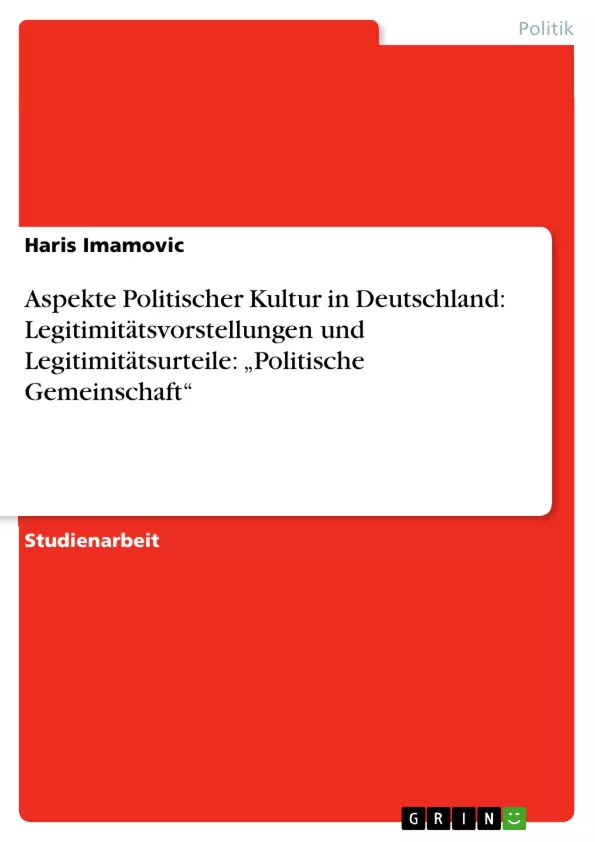1. Einleitung
Schon seit längerer Zeit wird die Entwicklung, der Orientierung der Deutschen gegenüber der politischen Gemeinschaft, in Deutschland thematisiert. Neller behauptet das der historische Hintergrund Deutschlands ausreichend Inhalte liefert, die als Vorlage für politische Diskussionen dienen. Vor allem die Frage der nationalen Identität ist durch die Ereignisse im Dritten Reich negativ vorbelastet. Seit der Wiedervereinigung stehen sich zwei verschiedene Bevölkerungsteile gegenüber, die eine politische Gemeinschaft bilden sollen, obwohl beide völlig anderen politischen Erfahrungen ausgesetzt waren.
Trotz großer Skepsis, vor allem durch amerikanische Wissenschaftler , erholt sich Westdeutschland sehr schnell von den Folgen des zweiten Weltkriegs. Die Demokratie sorgt für einen raschen Wandel politischer Einstellungen und auch für die Stabilität im jungen Staat. Das politische System konnte sich seit den fünfziger Jahren bis heute halten. Die Demokratie in der BRD zählt heute zu den stabilsten Demokratien der westlichen Welt. Auch die Wiedervereinigung hat am politischen System nichts verändern können. Die Bürger in der ehemaligen DDR lebten währenddessen in einem totalitären Staat weiter. Obrigkeitsstaatliche Traditionen wurden durch die Staatsbürokratie und durch die SED-Herrschaft noch weiter verstärkt. Politikwissenschaftler vermuten, dass in mancher Hinsicht sich das politische Bewusstsein der Ostdeutschen sich wie auf dem Stand der frühen 60er Jahre in Westdeutschland befindet.
Dieser kleine Exkurs reicht dabei schon aus um zu zeigen, dass sich Unterschiede gegenüber der politischen Gemeinschaft zwischen Ost und West auftun. Die Frage der Orientierung gegenüber der politischen Gemeinschaft in Deutschland bleibt auch zentral in dieser Hausarbeit. Anhand von Grafiken und durchgeführten Umfragen soll dargestellt werden wie unterschiedlich die demokratischen Vorstellungen zwischen Ost und West sind. Vor allem der Indikator der nationalen Identität soll genauer untersucht und dargestellt werden. Des Weiteren soll auch der Begriff der politischen Kultur, als Teildisziplin der Politikwissenschaft, definiert und erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Die Politische Kultur
- 3. Aspekte Politische Kultur in Deutschland
- 3.1. Die nationale Identität
- 4. Orientierung gegenüber der politischen Gemeinschaft
- 4.1. Die Politische Gemeinschaft
- 4.2. Orientierung gegenüber der politischen Gemeinschaft in der BRD bis 1990
- 4.3. Orientierung gegenüber der politischen Gemeinschaft seit der Wiedervereinigung
- 5. Der Fazit
- 6. Anhang
- 6.1. Literaturverzeichnis
- 6.2. Internetquellen
- 6.3. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Orientierung der Deutschen gegenüber der politischen Gemeinschaft in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung von Unterschieden in der demokratischen Vorstellungswelt zwischen Ost- und Westdeutschland, insbesondere im Hinblick auf die nationale Identität. Die Arbeit greift dabei auf empirische Untersuchungen und Grafiken zurück, um die unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
- Definition und Klärung des Begriffs der politischen Kultur
- Untersuchung der nationalen Identität als Indikator für die Orientierung gegenüber der politischen Gemeinschaft
- Analyse der politischen Kultur in Deutschland vor und nach der Wiedervereinigung
- Vergleich der demokratischen Vorstellungen in Ost- und Westdeutschland
- Bedeutung der Legitimität des politischen Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in das Thema ein und beleuchtet die historische Entwicklung der Orientierung der Deutschen gegenüber der politischen Gemeinschaft. Es werden insbesondere die Herausforderungen durch die Ereignisse des Dritten Reichs und die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung aufgezeigt.
Das zweite Kapitel definiert und erläutert den Begriff der politischen Kultur. Es werden die verschiedenen Perspektiven und Definitionen des Begriffs betrachtet und die Bedeutung der subjektiven Seite der Politik in Bezug auf die politische Orientierung einer Bevölkerung dargestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Aspekt der nationalen Identität in Deutschland. Es wird untersucht, wie die Debatte um die nationale Identität politisch beeinflusst wurde und welche Rolle der Nationalstolz in der politischen Kultur spielt.
Schlüsselwörter
Politische Kultur, Orientierung gegenüber der politischen Gemeinschaft, nationale Identität, Legitimität, Demokratie, Deutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland, Wiedervereinigung, empirische Untersuchungen, Grafiken, Umfragen.
- Quote paper
- Haris Imamovic (Author), 2011, Aspekte Politischer Kultur in Deutschland: Legitimitätsvorstellungen und Legitimitätsurteile: „Politische Gemeinschaft“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176213