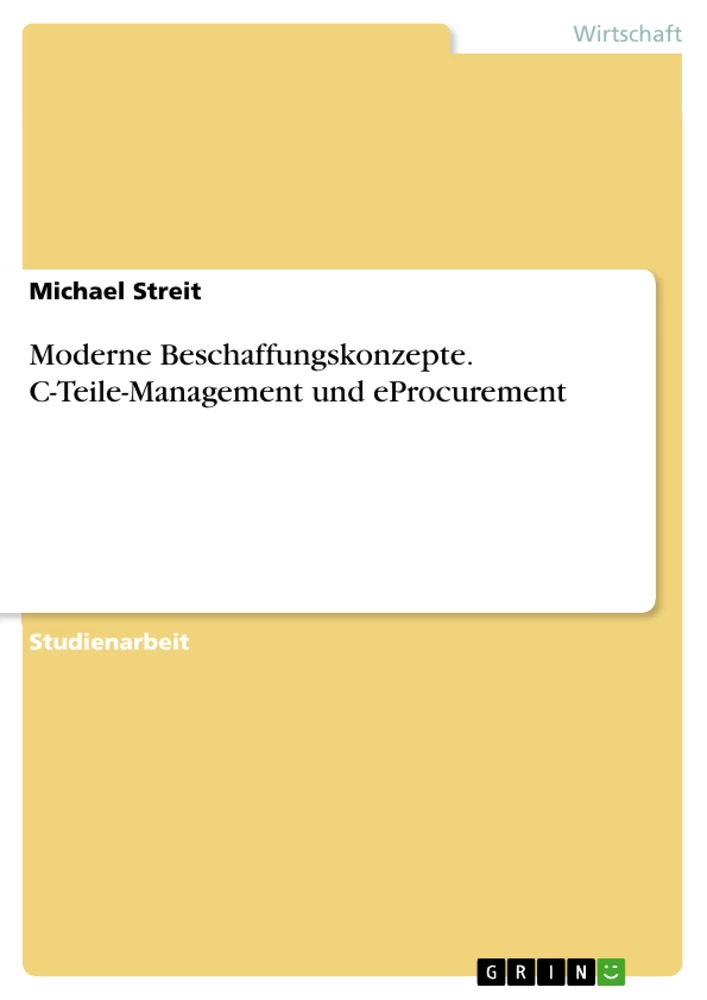Mit der vorliegenden Arbeit sollen zwei moderne Konzepte der Beschaffungslogistik, namentlich das C-Teile-Management und die elektronische Beschaffung (eProcurement) vorgestellt werden. Die Wichtigkeit beide Konzepte hat in den vergangenen Jahren deutlich
zugenommen. Dabei werden zum Verständnis dieser Arbeit gewisse Kenntnisse auf dem Gebiet der Beschaffungslogistik vorausgesetzt.
Im Kapitel „C-Teile-Management“ wird zunächst auf die ABC-Analyse, welche als Grundlage des Konzepts anzusehen ist, eingegangen. Anschließend werden die Eigenschaften von C-Teilen beschrieben. Weiterhin wird das bisherige Vorgehen im C-Teile-Management anhand einer grafischen Darstellung näher beleuchtet. Das Kapitel wird durch die Auflistung von Optimierungsansätzen abgeschlossen.
Da viele dieser Ansätze durch elektronische Beschaffung erzielt werden können, wird auch ein eigener Abschnitt „eProcurement“ eingefügt. Dieser klärt zunächst, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Anschließend werden zwei Anwendungsfälle, nämlich der elektronische Marktplatz sowie der elektronische Katalog, näher beschrieben. Zum Schluss werden noch die Erfolgspotenziale der elektronischen Beschaffung genannt.
Das vierte Kapitel zeigt ein sog. „Desktop Purchasing System“ als übergreifendes Praxisbeispiel. Hier wird das C-Teile-Management anhand eines eProcurement-Tools durchgeführt.
Ein weiterer Anwendungsfall ist das Outsourcing des C-Teile-Management, d.h. die Beschaffung der entsprechenden Güter über Dienstleister. Dieser wird im fünften Abschnittbeschrieben. Da dieses Beispiel vor allem für KMU relevant ist, wurde es in die vorliegende Arbeit aufgenommen, um den Praxisbezug dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem Studiengang „Innovation im Mittelstand“ an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt zu erhöhen.
Das sechste und letzte Kapitel befasst sich mit einem optimierten Bestellprozess für C-Teile nach Kämpf und Boivin. Dieser verbindet Informationen aus den vorherigen Abschnitten, namentlich zu den Themen Desktop Purchasing und Outsourcing des C-Teile-Managements in einem Ansatz.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Problemstellung und Vorgehensweise
2. C-Teile-Management
2.1 Grundlage: ABC-Analyse
2.2 Eigenschaften C-Teile, Beschaffungsprobleme und Definition C-Teile-Management
2.3 Bisheriges Vorgehen im C-Teile-Management
2.4 Optimierungsansätze im C-Teile-Management
3. eProcurement
3.1 Definition eProcurement
3.2 Anwendungsbeispiele
3.2.1 Elektronische Marktplätze
3.2.2 Elektronische Kataloge
3.2.3 Vor- und Nachteile der Anwendungsbeispiele
3.3 Vorteile und Erfolgspotenziale von eProcurement
4. Übergreifender Anwendungsfall 1: Desktop Purchasing System
5. Übergreifender Anwendungsfall 2: C-Teile-Beschaffung via Dienstleister
6. Optimierter Bestellprozess nach Kämpf und Boivin
Literaturverzeichnis
-
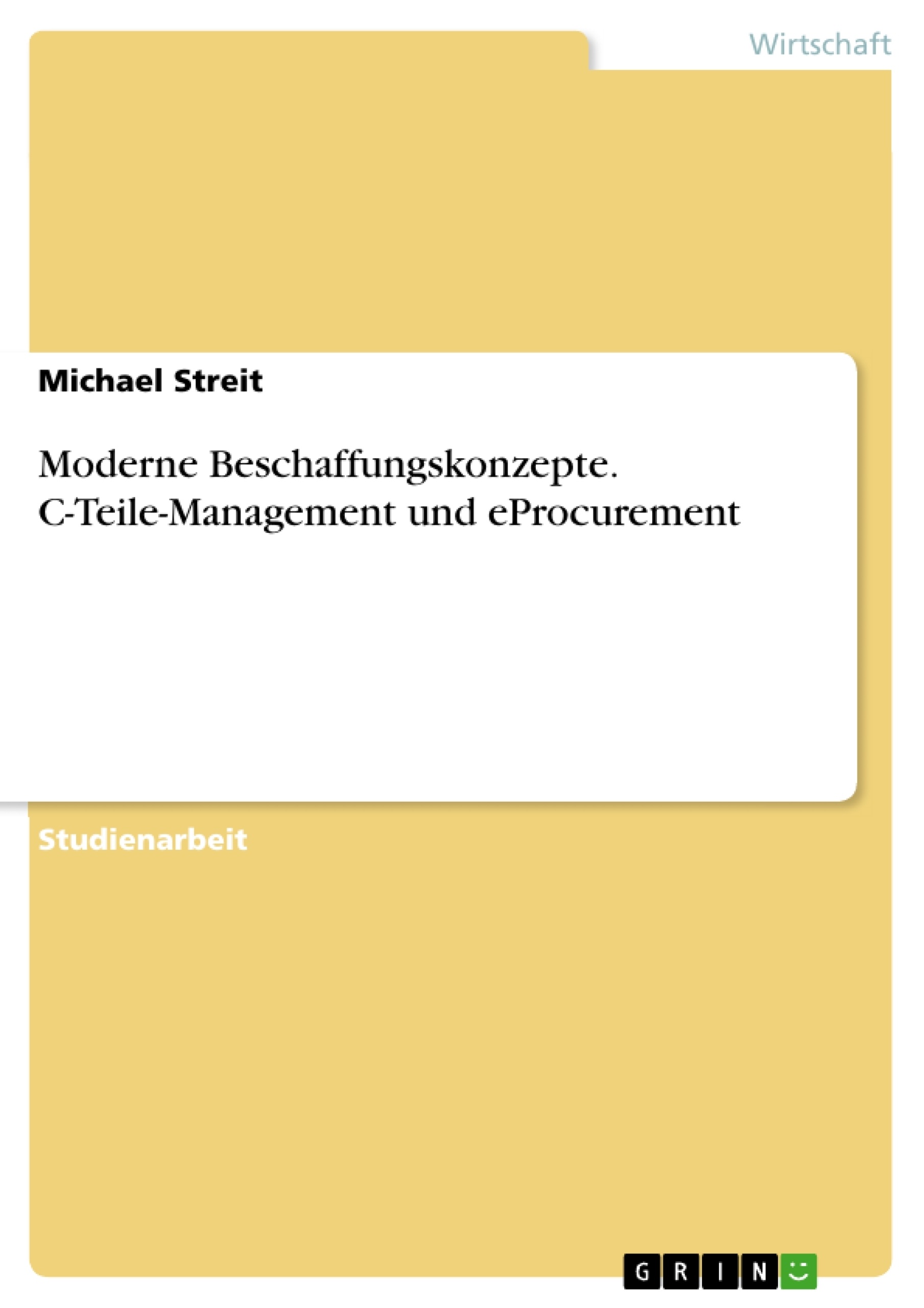
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.