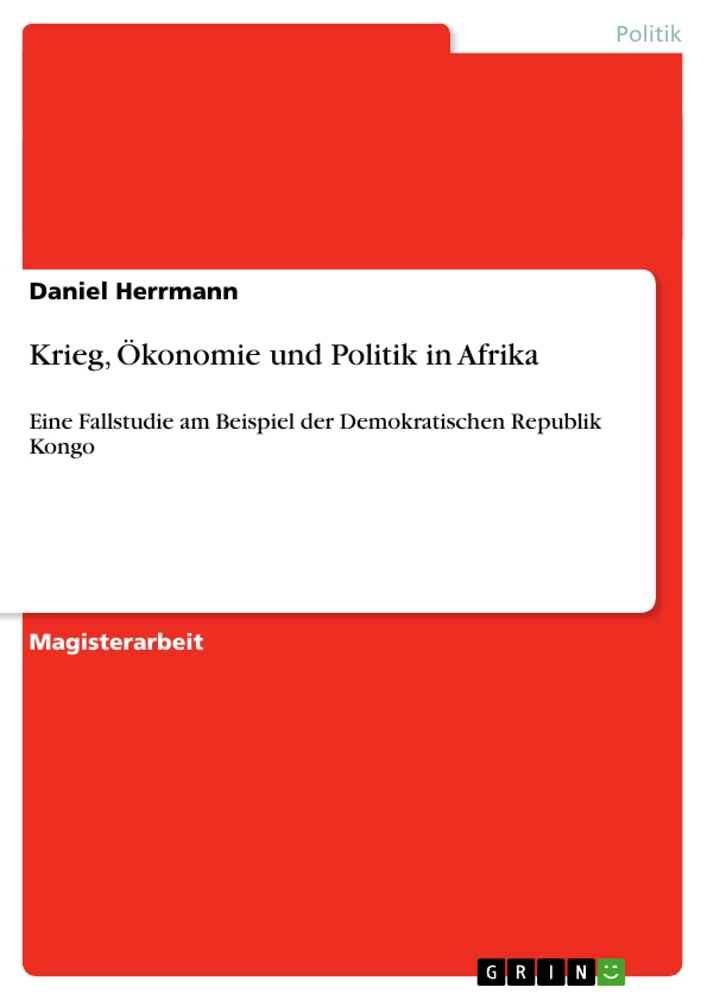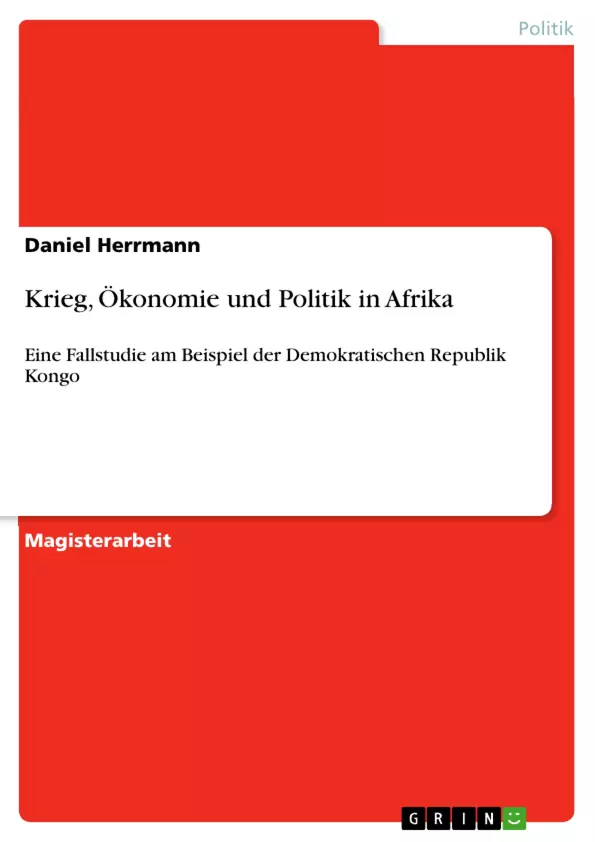Anhand der Demokratischen Republik Kongo werden die Theorien von William Reno und Robert I. Rotberg et al auf ihre Anwendbarkeit und den Grad des Zutreffens im heutigen Afrika analysiert.
Die Arbeit stellt zunächst die polito-ökonomische Lage in der DRC dar. Hierauf folgt die Analyse der theoretischen Erwartungen von Reno/Rotberg sowie ein komparativer Ansatz zur Überprüfung auf die zuvor ermittelten Umstände in der DRC hin.
Abschließend folgt ein theoretischer Teil, an welchen Ansätzen die Theorie verbessert werden könnte, dies ist jedoch Gegenstand einer hier nicht veröffentlichten Dissertation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1
- 1.1 Geographische Lage und Rahmendaten des Kongo
- 1.2 Historische Rahmendaten
- 1.2.1 Von der Kolonie zur Unabhängigkeit
- 1.2.2 Die drei Epochen der Ära Mobutu
- 1.3 Allgemeine Konfliktursachen in Afrika
- 1.3.1 die Patronage
- 1.3.2 Historische und neue Ursachen für Konflikte in Afrika
- 1.3.3 die aktuelle Gefährdungslage an den „Great Lakes“
- Kapitel 2
- 2.1 Auswahl der Theorie
- 2.2 Eingrenzungen des untersuchten Rahmens
- 2.3 Die Theorie der „state failure\"
- 2.3.1 Die politischen Güter
- 2.3.2 Die Unterscheidung von Staaten
- 2.3.2.1 Starke Staaten
- 2.3.2.2 Schwache Staaten
- 2.3.2.3 Failed states und ihre Steigerung
- 2.3.3 Indikatoren für „state failure"
- 2.3.4 Die Ziele dieser Theorie
- Kapitel 3
- Die Demokratische Republik Kongo zwischen 1997 und 2004
- Vorbemerkungen
- 3.1 Der Zerfall des Staates von 1997 - 2003
- 3.1.1 Der Erste Kongo Krieg
- 3.1.2 15 Monate Frieden
- 3.1.3 Der Zweite Krieg
- 3.2 Die beteiligten Akteure
- 3.2.1 Die nationalen Akteure
- 3.2.2 Die internationalen Akteure
- 3.2.3 Die multinationalen Akteure
- 3.3 Die politischen Ziele der nationalen Akteure
- 3.4 Die politischen Ziele der internationalen Akteure
- 3.5 Die Mai Mai von Katanga
- 3.5.1 Die Provinz Katanga
- 3.5.2 Die Entstehung der Mai Mai in Nord-Katanga
- 3.5.3 Die MONUC Berichterstatter zur Rolle der Mai Mai
- 3.6 Die Ökonomie im Kongo Krieg
- 3.6.1 Die Ausgangssituation in der DRC Anfang der 1990er Jahre
- 3.6.2 Die ökonomischen Aspekte als Kriegsfolge und –funktion
- 3.6.3 Die ökonomischen Ziele der nationalen Akteure
- 3.6.4 Die ökonomischen Ziele der internationalen Akteure
- Kapitel 4
- 4.1 Analyse
- 4.1.1 Die Ursachen
- 4.1.2 Die Analyse
- 4.1.3. die Ursachen des Staatszerfalls – Betrachtung und Kommentar
- 4.2 Fazit
- 4.1 Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo zwischen 1997 und 2004 und untersucht, ob dieser Staat in diesem Zeitraum als „failed state“ klassifiziert werden kann. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Auswirkungen des Konflikts und beleuchtet die Rolle der verschiedenen Akteure – national, international und multinational – im Kontext der politischen und ökonomischen Dimensionen des Krieges.
- Die Auswirkungen von Kolonialismus und Nachkriegspolitik auf die politische Stabilität des Kongo
- Die Rolle von Patronage-Netzwerken und korrupten Eliten in der Konfliktentstehung
- Die Bedeutung von Ressourcenkonflikten und der Ausbeutung von Bodenschätzen für die Kriegsfinanzierung
- Der Einfluss von internationalen Akteuren und ihre Interventionsstrategien im Kongo-Konflikt
- Die Frage, inwiefern die Theorie des „state failure“ zur Erklärung des Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo herangezogen werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik und die Leitfrage der Arbeit vor und beleuchtet die Aktualität des Themas im Kontext der internationalen Debatte über die Rolle der Staatengemeinschaft in Konfliktregionen. Sie skizziert den Forschungsstand und die Methodik der Arbeit.
- Kapitel 1: Dieses Kapitel liefert grundlegende Informationen über die geografische Lage und die historische Entwicklung des Kongo. Es beleuchtet die Hintergründe der Kolonie bis zur Unabhängigkeit und analysiert die drei Epochen der Ära Mobutu. Des Weiteren werden allgemeine Konfliktursachen in Afrika, insbesondere die Patronage, betrachtet.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird die Theorie des „state failure“ als analytisches Instrumentarium vorgestellt. Es werden die wichtigsten Elemente der Theorie, die Unterscheidung zwischen starken, schwachen und gescheiterten Staaten sowie die Indikatoren für „state failure“ erläutert. Darüber hinaus werden die Ziele dieser Theorie für die Analyse des Kongo-Konflikts aufgezeigt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beleuchtet den Zerfall des Staates im Kongo von 1997 bis 2003. Es analysiert den Verlauf des Ersten und Zweiten Kongo-Krieges und untersucht die politischen und ökonomischen Ziele der beteiligten Akteure, sowohl national als auch international. Außerdem wird die Rolle der Mai Mai von Katanga im Konfliktkontext untersucht.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen und Auswirkungen des Staatszerfalls im Kongo, insbesondere aus der Perspektive der „state failure“-Theorie. Es betrachtet die gewonnenen Erkenntnisse im Kontext der Rahmendaten und zieht abschließende Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Krieg, Ökonomie und Politik in Afrika, insbesondere am Fallbeispiel der Demokratischen Republik Kongo. Die zentralen Begriffe sind: „state failure“, Konflikte in Afrika, Patronage, Ressourcenkonflikte, Kriegswirtschaft, internationale Intervention, Mai Mai von Katanga, politische Instabilität, Staatszerfall, und die Analyse der politischen und ökonomischen Dimensionen des Konflikts.
Häufig gestellte Fragen
Wann gilt ein Staat als „failed state“?
Ein Staat wird als „failed state“ bezeichnet, wenn er grundlegende politische Güter wie Sicherheit, Rechtssicherheit und Infrastruktur nicht mehr für seine Bürger gewährleisten kann und das Gewaltmonopol verloren hat.
Was waren die Hauptursachen für den Zerfall der DR Kongo?
Zu den Ursachen zählen das Erbe des Kolonialismus, die jahrzehntelange Korruption unter Mobutu, Patronage-Netzwerke sowie der Kampf um die Kontrolle über wertvolle Bodenschätze.
Welche Rolle spielten Ressourcen im Kongo-Krieg?
Bodenschätze dienten sowohl als Kriegsursache als auch zur Finanzierung bewaffneter Gruppen. Ökonomische Ziele nationaler und internationaler Akteure überlagerten oft die politischen Motive.
Wer sind die Mai Mai in Katanga?
Die Mai Mai sind lokale Milizen, die ursprünglich zur Selbstverteidigung entstanden, aber im Verlauf des Konflikts oft eigene politische und ökonomische Interessen verfolgten.
Welchen Einfluss hatte die Ära Mobutu auf die heutige Lage?
Die Ära Mobutu war durch Kleptokratie und den Aufbau von Patronage-Systemen geprägt, was die staatlichen Institutionen aushölte und den späteren Staatszerfall vorbereitete.
Welche internationalen Akteure waren am Konflikt beteiligt?
Neben Nachbarstaaten wie Ruanda und Uganda spielten auch multinationale Unternehmen und die UN-Mission MONUC eine entscheidende Rolle im komplexen Konfliktgefüge.
- Citation du texte
- M.A. Daniel Herrmann (Auteur), 2007, Krieg, Ökonomie und Politik in Afrika , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177153