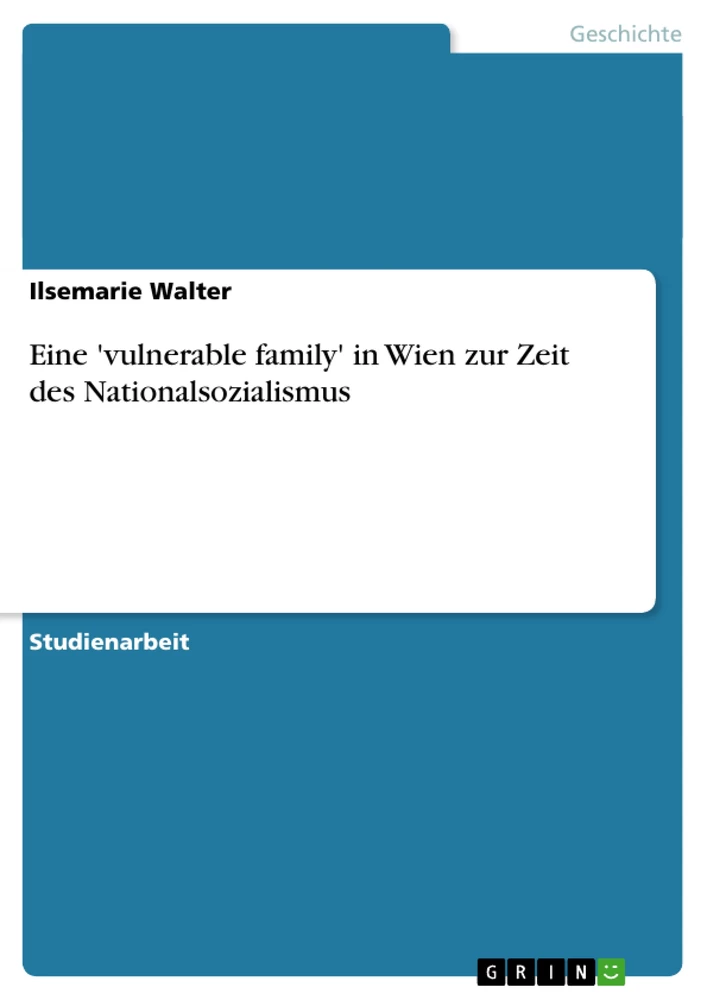Unter den vielen, mit der Methode der „oral history“ aufgezeichneten Zeitzeugenberichten finden sich kaum solche, die von GegnerInnen des Nationalsozialismus aus dem katholischen Milieu in Österreich stammen. Einer der Gründe für diese Forschungslücke mag sein, dass es kaum möglich ist, sich mit diesem Thema zu befassen, ohne auch das vorangegangene katholisch-autoritäre (oder in anderer Diktion faschistische) Regime in den Blick zu nehmen. Gespräche oder Diskussionen über diesen Zeitraum (1933 – 1938) sind in Österreich jedoch noch immer weitgehend tabu.
In der vorliegenden Arbeit wird ein Interview mit einer überzeugten Katholikin aus Wien dargestellt und analysiert, in dem der Schwerpunkt auf der Zeit von 1933 bis ungefähr 1946 liegt. Dieser Interviewpartnerin, einer 80jährigen, eindrucksvoll erzählenden und auch selbst die Ereignisse reflektierenden Dame, die ihre Zustimmung zur Veröffentlichung dieser Arbeit gegeben hat, soll an dieser Stelle herzlichst gedankt werden.
In dem ungefähr zwei Stunden dauernden Gespräch werden viele Facetten des an dramatischen Ereignissen reichen Zeitraums deutlich, wie sie sich im Erleben beteiligter Personen widergespiegelt haben. Da es sich um ein einzelnes Interview handelt, waren Vergleiche mit anderen Interviews nicht möglich, es konnte nur die spärlich vorhandene Literatur zu einzelnen Punkten herangezogen werden. Viele über das einzelne Leben hinausgehenden Fragen mussten offen bleiben. Dazu gehört unter anderem die Frage, ob das in diesem Bericht deutlich werdende offensichtlich vorhandene Widerstandspotential gerade junger katholischer Menschen nicht zum politischen Widerstand gegen das unmenschliche nationalsozialistische Regime und seine unmenschliche Ideologie hätte genützt werden können.
Die Arbeit enthält auch forschungsmethodologische Reflexionen, in denen Passagen aus der Methodenliteratur zur „oral history“ aufgegriffen und auf das konkrete Interview angewendet werden. Das Interview selbst wird dabei als Prozess betrachtet, in dem die beiden Gesprächspartnerinnen bestimmte Rollen einnehmen und die Beziehung zueinander von Bedeutung ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Interview
- ,,Das hat mich zuinnerst empört”
- Zweimal das gleiche Motiv
- ,,Dort bin ich, dort bleibe ich”
- Überwintern
- ,, dass das nicht in Frage kommt, und dass ich so was nicht mach”
- Kompromisslosigkeit und Kompromisse
- ,,Mein Vater hat sie nie aus den Augen gelassen”
- Eine „vulnerable family”
- ,,für uns war's wie ein Gerücht über die Konzentrationslager”
- Zwischen Nichtwissen und Wissen
- ,,Ich habe nie verstanden, dass man nicht das österreichische Heer in Bewegung bringt”
- Ein ungenütztes Widerstandspotential?
- ,, Uns hat es nicht gestört, denn es war ja unsere Richtung”
- Der österreichische „Ständestaat“ / „Austrofaschismus”
- ,, alle haben gewusst, wer wer ist”
- Die eigene Gruppe und die anderen
- ,,Da hab' ich gewusst, jetzt muss ich in die Pfarrgruppe gehen”
- Brüche
- ,,Ich fahr' bestimmt nicht mit mit dem Schiff”
- Das Fremde für mich
- 2. Weitere Überlegungen
- 1. Ein,,Widerspruchspotential gegenüber verkürzten Generalisierungen“?
- 2.,,Gewaltfreie Kommunikation“?
- 3. Sprache und Stil
- 4. Das Interview als Prozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebensgeschichte von Frau F. L. in Wien während der Zeit des Nationalsozialismus. Sie analysiert, wie die Zeit des Nationalsozialismus in ihrem damaligen Milieu erlebt wurde und wie sie sich als Einzelperson in dieser Zeit positioniert hat. Die Arbeit betrachtet auch die Rolle von Familie, Glaube und persönlicher Moral im Angesicht des politischen Wandels.
- Die Erfahrung des Nationalsozialismus in Wien aus der Perspektive einer jungen Frau.
- Die Rolle von Familie und Glaube in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
- Die Auswirkungen politischer Ereignisse auf die individuelle Lebensgeschichte.
- Der Umgang mit Konflikten und moralischen Dilemmata in Zeiten des Umbruchs.
- Die Bedeutung von individuellem Widerstand und Anpassung in einer autoritären Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt das Interview mit Frau F. L. und schildert wichtige Ereignisse aus ihrem Leben während der Zeit des Nationalsozialismus. Das Interview beleuchtet verschiedene Aspekte ihrer Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus, wie zum Beispiel ihre Abneigung gegen Bespitzelung, ihre kompromisslose Haltung gegenüber den Vorgaben der katholischen Kirche und ihre Entscheidung, in Wien zu bleiben.
Das zweite Kapitel geht auf weitere Überlegungen ein und stellt verschiedene Denkansätze zur Interpretation der Lebensgeschichte von Frau F. L. vor. Es befasst sich mit Themen wie dem Widerstandspotential gegen verkürzte Generalisierungen, der Gewaltfreien Kommunikation sowie der Rolle von Sprache und Stil im Interview als Prozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Nationalsozialismus, Widerstand, Familie, Glaube, individuelle Lebensgeschichte, Wien, Österreich, und die Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Zeitzeugen-Interviews?
Das Interview beleuchtet das Leben einer überzeugten Katholikin in Wien während der Zeit des Nationalsozialismus und des Austrofaschismus (1933–1946).
Warum wird die Familie als "vulnerable family" bezeichnet?
Die Familie war aufgrund ihrer katholisch-religiösen Überzeugung und ihrer Ablehnung der NS-Ideologie potenziell gefährdet und musste Strategien zum "Überwintern" im Regime finden.
Welche Rolle spielt die Methode "Oral History" in der Arbeit?
Die Arbeit nutzt Oral History, um subjektive Erfahrungen festzuhalten, und reflektiert gleichzeitig methodisch über den Interviewprozess und die Beziehung zwischen Interviewer und Zeitzeuge.
Wie positionierte sich die Interviewte zum Nationalsozialismus?
Sie zeigte eine kompromisslose Haltung gegenüber NS-Vorgaben, die ihrem Glauben widersprachen, und empfand eine tiefe Empörung über das Regime, was ein gewisses Widerstandspotenzial verdeutlicht.
Was wird über das Wissen von Konzentrationslagern gesagt?
Das Interview thematisiert das Spannungsfeld zwischen Wissen und Nichtwissen; Informationen über die Lager wurden oft nur als vage "Gerüchte" wahrgenommen.
Warum sind Berichte aus dem katholischen Milieu in der Forschung selten?
Ein Grund ist das Tabu um den vorangegangenen "Ständestaat" (Austrofaschismus), da eine Auseinandersetzung mit dem katholischen Widerstand oft auch die Bewertung dieses autoritären Regimes erfordert.
- Arbeit zitieren
- Ilsemarie Walter (Autor:in), 2001, Eine 'vulnerable family' in Wien zur Zeit des Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17781