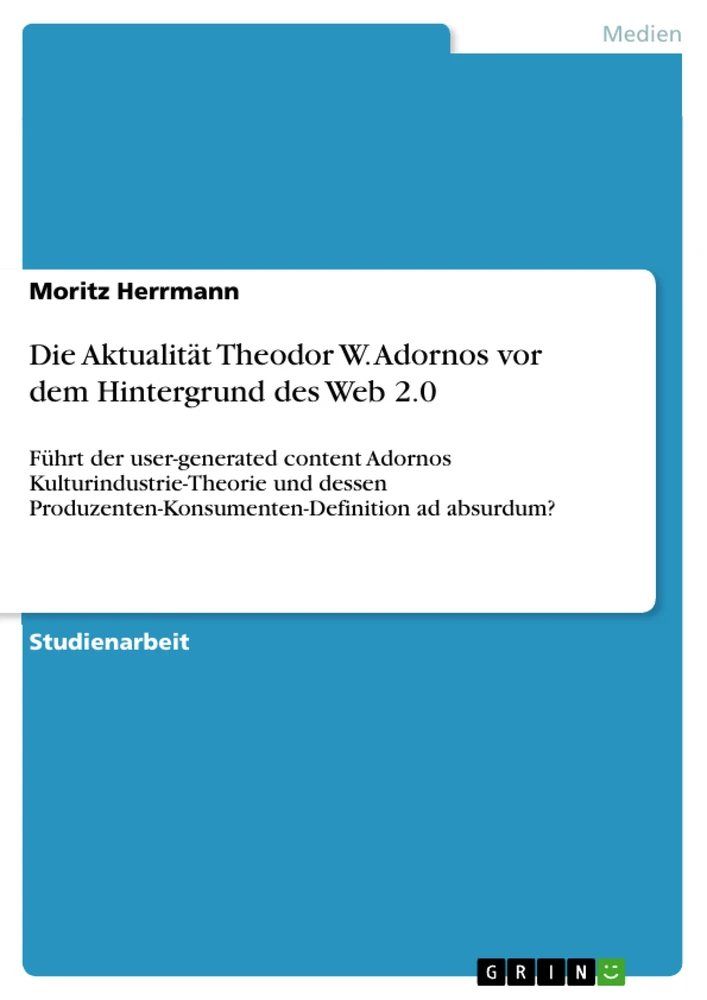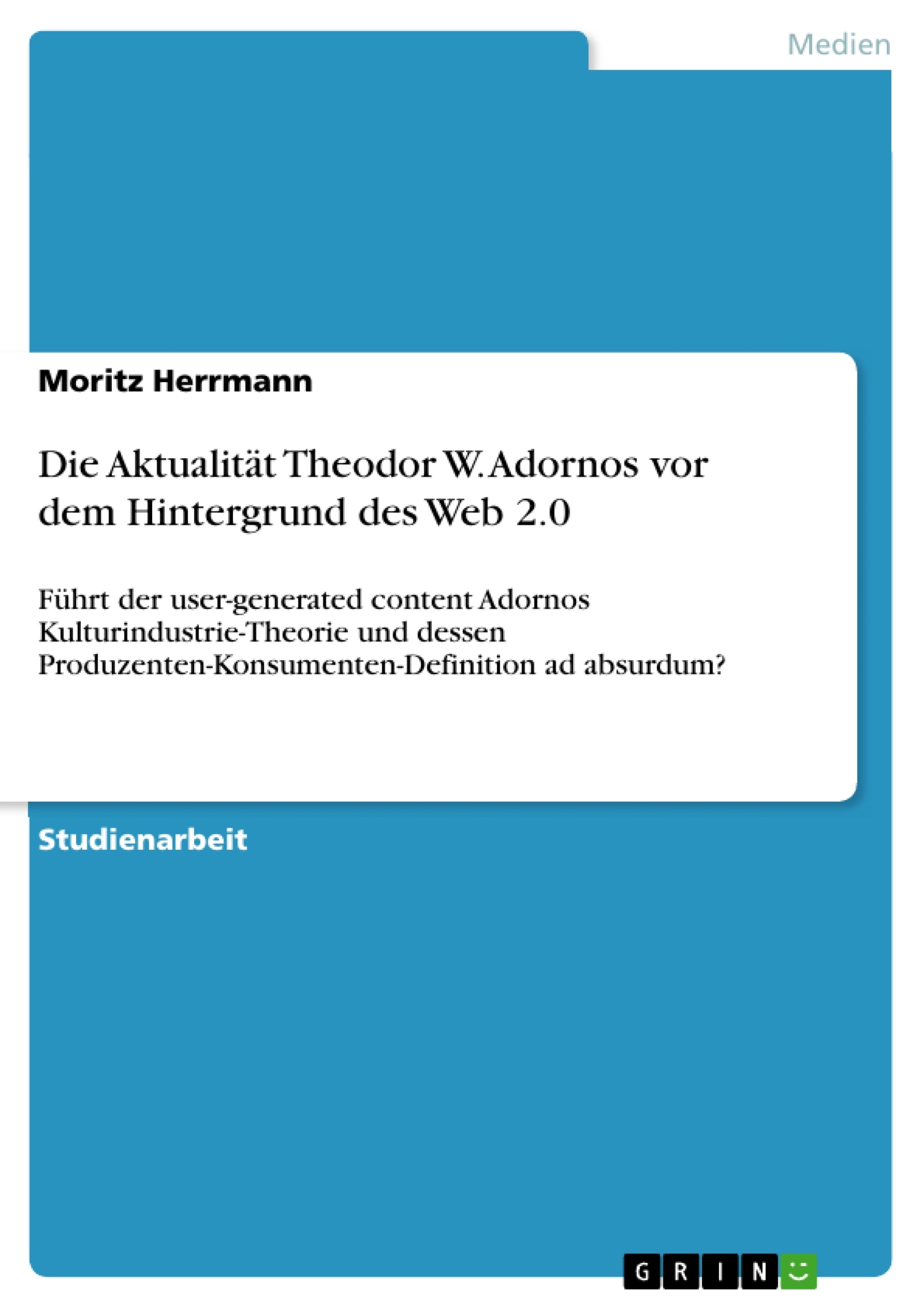Jürgen Habermas, Vertreter der Frankfurter Schule, feierte das Web auf einer Dresdener Soziologentagung 2006 als Ort, an dem die „Wurzeln einer egalitären Öffentlichkeit von Autoren und Lesern reaktiviert“ (Stöcker 2006, Internet) würden. Sollte sich diese Euphorie bewahrheiten, hielte mit dem Web 2.0 womöglich der grundsätzliche Wandel Einzug, den Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in ihrer „Dialektik der Aufklärung“ als einzig möglichen Umsturz der Kulturindustrie erachten. Gleichwohl äußerte Habermas auch die Befürchtung, „Online-Debatten könnten zu einer Fragmentierung des Massenpublikums in eine Vielzahl themenspezifischer Teilöffentlichkeiten führen“ (ebd.). Welche Tendenz zeichnet sich heute, 2009, ab?
Ich will mich der Frage widmen, ob Adornos Kulturindustrie-Theorie angesichts der – stellvertretend von Jürgen Habermas geäußerten – Hoffnungen und Ängste zum Web 2.0 besonders aktuell oder aber besonders überholt scheint. Adorno und Horkheimer haben ihre Kulturkritik unter den Eindrücken des deutschen Faschismus und der Massenmedien Radio, Fernsehen, Film (Kino), Print und Kunst entworfen. Die mediale und ökonomische Herrschaft letzterer war bis in die 90er-Jahre ungebrochen. Erst das Web 2.0 markiert einen Schnitt.
Meine These lautet: Der user-generated content führt die Theorie und Kritik der Kulturindustrie ad absurdum, weil Adornos Warencharakterbegriff und seine Produzenten-Konsumenten-Definition für das Web 2.0 nicht mehr zutreffend sind.
Um diese These zu be- bzw. widerlegen, werde ich vor allem Weblogs analysieren. Blogs als zu untersuchende Kategorie erscheinen besonders geeignet, weil die Anzahl 1999, 2001 und 2004 sprunghaft angestiegen ist (vgl. Ebersbach/Glaser/Heigl 2008: 59) und seither mitunter als Konkurrenz oder gar Wachablösung zu den etablierten Medien gehandelt wird. Die Diskussion, ob und wann Blogs Journalismus sind, ist meinem Thema zwar verwandt, wird hier aber nur am Rande behandelt. Gleichsam beziehen die Überlegungen zu Kommunikationsstruktur und –inhalt Adorno nur selten (direkt) ein und verweisen vielmehr auf Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann und Marshall McLuhan. Diese Lücke gilt es mit vorliegender Hausarbeit zu füllen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kulturindustrie - Aufklärung als Massenbetrug
- 3. Web 2.0 und Blogosphäre
- 4. Relevanz der Kulturindustrie-Theorie von Adorno für das Web 2.0 und umgekehrt
- 4.1 Form: Ästhetik oder Effekt?
- 4.2 Inhalt: Kunst oder Kulturware?
- 4.3 Rollenverständnis und -verhältnis: Prosumer oder Produser?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Aktualität der Kulturindustrie-Theorie von Theodor W. Adorno im Kontext des Web 2.0. Sie untersucht, ob Adornos Kritik an der Massenmedien-Herrschaft im digitalen Zeitalter angesichts des user-generated content noch relevant ist oder ob sie ad absurdum geführt wird.
- Analyse der Kulturindustrie-Theorie von Adorno und Horkheimer
- Untersuchung der Merkmale und Entwicklung des Web 2.0 und der Blogosphäre
- Bewertung der Relevanz der Kulturindustrie-Theorie im Kontext des Web 2.0
- Analyse der Form, des Inhalts und des Rollenverständnisses in Blogs
- Abschließende Bewertung der Aktualität von Adornos Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Aktualität der Kulturindustrie-Theorie im Kontext des Web 2.0. Es präsentiert die These, dass der user-generated content Adornos Theorie ad absurdum führt. Die Bedeutung von Weblogs als Untersuchungsobjekt wird hervorgehoben.
Kapitel zwei erläutert die Grundzüge der Kulturindustrie-Theorie von Adorno und Horkheimer. Es beleuchtet die Kritik an der „Vermassung von Kulturträgern“ und dem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Konsumenten und Kulturindustrie.
Kapitel drei definiert das Web 2.0 und die Blogosphäre aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive. Die Bedeutung von Blogs als partizipative Elemente im Web 2.0 wird hervorgehoben.
Kapitel vier analysiert die Relevanz von Adornos Ausführungen für das Web 2.0 und umgekehrt. Es untersucht Form, Inhalt und Rollenverständnis von bzw. in Blogs.
Schlüsselwörter
Kulturindustrie, Aufklärung, Massenbetrug, Web 2.0, Blogosphäre, user-generated content, Partizipation, Produser, Konsument, Kunst, Kulturware, Kritik, Aktualität.
Häufig gestellte Fragen
Wie aktuell ist Adornos Kulturindustrie-Theorie im Zeitalter des Web 2.0?
Die Arbeit untersucht, ob Adornos Kritik an der Massenmanipulation durch das Internet und user-generated content überholt ist oder eine neue Relevanz erfährt.
Was ist die zentrale These der Arbeit bezüglich user-generated content?
Die These lautet, dass user-generated content die Theorie der Kulturindustrie ad absurdum führt, da Adornos Definitionen von Produzent und Konsument im Web 2.0 verschwimmen.
Welche Rolle spielen Blogs (Weblogs) in dieser Untersuchung?
Blogs werden als Untersuchungsobjekt genutzt, um zu prüfen, ob sie eine "egalitäre Öffentlichkeit" schaffen oder lediglich neue Formen der Kulturware darstellen.
Was versteht Adorno unter „Kulturindustrie“?
Es ist die Kritik an einer kommerzialisierten Kultur, die Menschen zu passiven Konsumenten degradiert und Individualität durch standardisierte Massenware ersetzt.
Welche Befürchtungen äußerte Jürgen Habermas zum Internet?
Habermas befürchtete eine Fragmentierung des Massenpublikums in viele themenspezifische Teilöffentlichkeiten, was den Diskurs erschweren könnte.
Was bedeuten die Begriffe „Prosumer“ oder „Produser“?
Diese Begriffe beschreiben das neue Rollenverhältnis im Web 2.0, bei dem Nutzer gleichzeitig Produzenten und Konsumenten von Inhalten sind.
- Citation du texte
- Moritz Herrmann (Auteur), 2009, Die Aktualität Theodor W. Adornos vor dem Hintergrund des Web 2.0, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178241