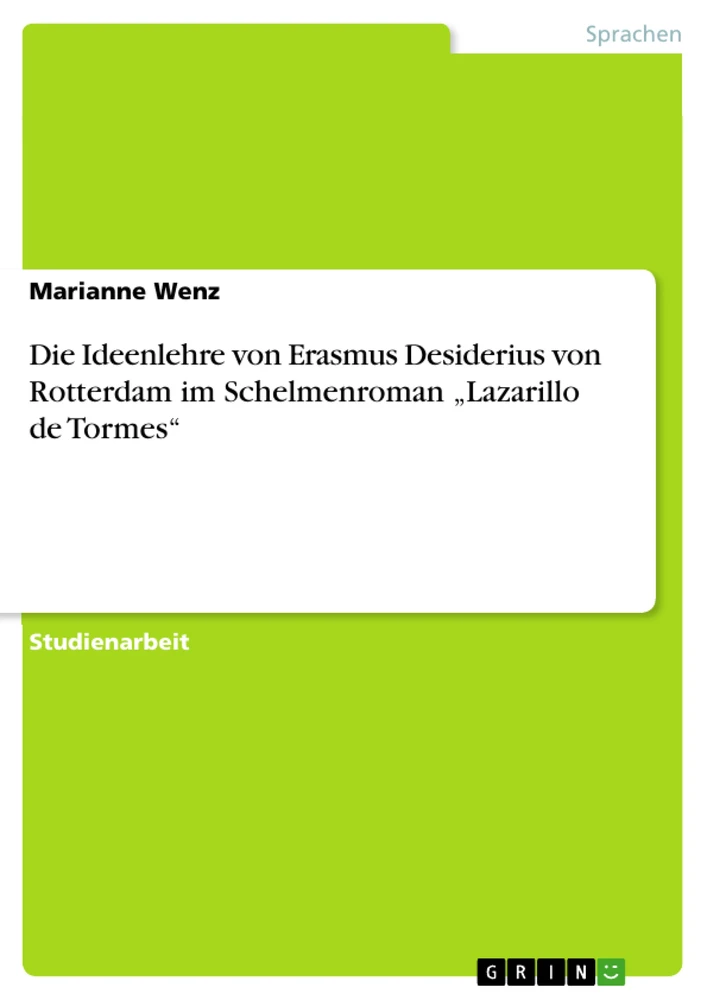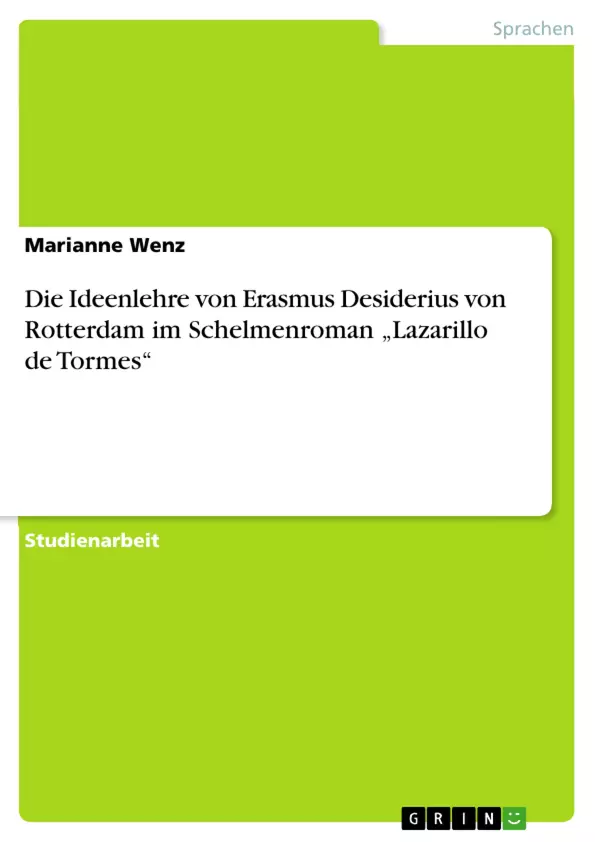1 Einleitung
Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Parallelen im Schelmenroman „Lazarillo de Tormes“ zu dem Werk von Erasmus Desiderius von Rotterdam.
Es gilt die Frage zu klären, ob der Autor von „Lazarillo de Tormes“ ein Befürworter von Ideen von Erasmus gewesen ist und ob er diese bewusst in sein Werk miteingeflochten hat oder inwiefern er unabhängig von Erasmus geschrieben hat.
Es soll zunächst der historische Hintergrund beleuchtet werden. Dabei werden zwei Epochen angesprochen, nämlich die Regierungszeit von Karl I. und von Philipp II.
Die Analyse wird ferner anhand eines Vergleichs der Schrift von Erasmus „Encomium moriae“ mit dem Roman „Lazarillo de Tormes“ vorgenommen. Die Frage nach der Intertextualität soll geprüft und die eventuellen Gemeinsamkeiten untersucht werden.
Neben der möglichen inhaltlichen Affinität des Romans mit der Lehre von Erasmus, halte ich die Beobachtung der Gattungsspezifik und die Untersuchung des Sprachstils beider Autoren für relevant. Dies wird im Kapitel „Zu der Form- und Schreibstilähnlichkeit“ unternommen.
2 Die allgemeinhistorische Sicht: Der Einfluss des Werks von Erasmus auf den Roman „Lazarillo de Tormes“
2.1 Im Zeitalter des Karl I. von Spanien
Während der Regierungszeit des Carlos I. von Spanien genoss die Ideenlehre von Erasmus von Rotterdam eine breite Befürwortung. Der Pazifismus von Erasmus und die Frage nach dem Krieg und Frieden lösten in Spanien eine deutliche Sympathie für Erasmus aus. Die Schriften von Erasmus wurden ins Spanische übersetzt und verbreitet. (Vgl. Bataillon 1983: 638) Der Einfluss der Ideologie von Erasmus betraf insbesondere die spanische Geistlichkeit, ferner hatte Erasmus im Umgang mit der Moral Wirkung auf die profane spanische Literatur ausgeübt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die allgemeinhistorische Sicht: Der Einfluss des Werks von Erasmus auf den Roman „Lazarillo de Tormes“
- Im Zeitalter des Carlos I. von Spanien
- In Bezug auf die Verfolgung der Ideen von Erasmus und den Index Librorum Prohibitorum
- Die ideelle Perspektive: Die Haltung des Erzählers in „Lazarillo de Tormes“ und die Ansichten von Erasmus
- Die kritische Betrachtung des Klerus
- Aus dem humanistischen Blickwinkel
- Am Beispiel der Primärtexte: Die Gegenüberstellung zu „Encomium Moriae“
- Auf der persönlichen Ebene: die „glückliche“ Ehe
- Auf der sozialen Ebene: das Ansehen in der Gesellschaft
- Die Idee der Ehre
- Lazaros Aufstieg: homo novus
- Zu der Form- und Schreibstilähnlichkeit
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Parallelen zwischen dem Schelmenroman „Lazarillo de Tormes“ und dem Werk von Erasmus Desiderius von Rotterdam. Sie untersucht, ob der Autor von „Lazarillo de Tormes“ die Ideen von Erasmus bewusst in sein Werk einbezogen hat oder ob er unabhängig von Erasmus geschrieben hat.
- Der Einfluss der Ideen von Erasmus auf die spanische Literatur im Zeitalter von Karl I. und Philipp II.
- Die kritische Betrachtung des Klerus und der „falschen Gottseligkeit“ in „Lazarillo de Tormes“ und im Werk von Erasmus
- Der Vergleich der Gedankenwelt und der Schreibstile von Erasmus und dem Autor von „Lazarillo de Tormes“ anhand von „Encomium Moriae“
- Die Frage nach der Intertextualität zwischen „Lazarillo de Tormes“ und dem Werk von Erasmus.
- Die Entstehung des Schelmenromans als Reaktion auf die Kritik am Ritterroman.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage und erläutert die methodische Vorgehensweise. Die Arbeit untersucht die Parallelen zwischen dem Schelmenroman „Lazarillo de Tormes“ und dem Werk von Erasmus Desiderius von Rotterdam.
- Die allgemeinhistorische Sicht: Der Einfluss des Werks von Erasmus auf den Roman „Lazarillo de Tormes“: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund des Werkes im Kontext der spanischen Geschichte. Der Einfluss der Ideen von Erasmus auf die spanische Literatur und Geistlichkeit während der Regierungszeiten von Karl I. und Philipp II. wird erörtert. Erasmus’ Spruchdichtung Adagia und die Reaktion darauf werden ebenfalls behandelt.
- Die ideelle Perspektive: Die Haltung des Erzählers in „Lazarillo de Tormes“ und die Ansichten von Erasmus: Dieses Kapitel betrachtet die ideellen Gemeinsamkeiten zwischen Erasmus und dem Autor von „Lazarillo de Tormes“. Die Kritik an der Kirche und am „falschen Glauben“ sowie der Fokus auf den humanistischen Gedanken werden anhand von Beispielen aus dem Roman beleuchtet.
- Am Beispiel der Primärtexte: Die Gegenüberstellung zu „Encomium Moriae“: Dieses Kapitel setzt die Analyse der Gemeinsamkeiten zwischen „Lazarillo de Tormes“ und Erasmus’ Werk fort, indem es die beiden Primärtexte „Encomium Moriae“ und „Lazarillo de Tormes“ direkt miteinander vergleicht. Es werden die Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Kritik an der Kirche, das Leben in der Gesellschaft und die Bedeutung von Ehre aufgezeigt.
- Zu der Form- und Schreibstilähnlichkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den formalen und stilistischen Parallelen zwischen den Werken von Erasmus und dem Autor von „Lazarillo de Tormes“.
Schlüsselwörter
Erasmus Desiderius von Rotterdam, „Lazarillo de Tormes“, Schelmenroman, novela picaresca, „Encomium Moriae“, Antiklerikalismus, humanistische Weltanschauung, moralische Werte, Index Librorum Prohibitorum, Intertextualität, spanische Literaturgeschichte, Gattungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Erasmus von Rotterdam auf den "Lazarillo de Tormes"?
Die Arbeit untersucht, ob der anonyme Autor des Schelmenromans bewusst Ideen von Erasmus, wie die Kritik am Klerus und humanistische Werte, integriert hat.
Was ist das Hauptthema des Vergleichs mit "Encomium moriae"?
Es wird analysiert, wie beide Werke die Scheinheiligkeit der Gesellschaft, die Idee der Ehre und den sozialen Aufstieg (homo novus) kritisch beleuchten.
In welchem historischen Kontext entstand der "Lazarillo de Tormes"?
Der Roman entstand im Zeitalter von Karl I. und Philipp II. von Spanien, einer Zeit, in der erasmische Ideen zunächst populär waren, später aber durch die Inquisition verfolgt wurden.
Warum wird der Roman als Reaktion auf Ritterromane gesehen?
Der Schelmenroman (novela picaresca) stellt einen Gegenentwurf zur idealisierten Welt der Ritterromane dar und fokussiert stattdessen auf die harte Realität und das Überleben der Unterschicht.
Was bedeutet Intertextualität in dieser Arbeit?
Es wird geprüft, inwieweit der Text des "Lazarillo" direkte oder indirekte Bezüge zu den Schriften von Erasmus aufweist.
- Quote paper
- Marianne Wenz (Author), 2006, Die Ideenlehre von Erasmus Desiderius von Rotterdam im Schelmenroman „Lazarillo de Tormes“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178317