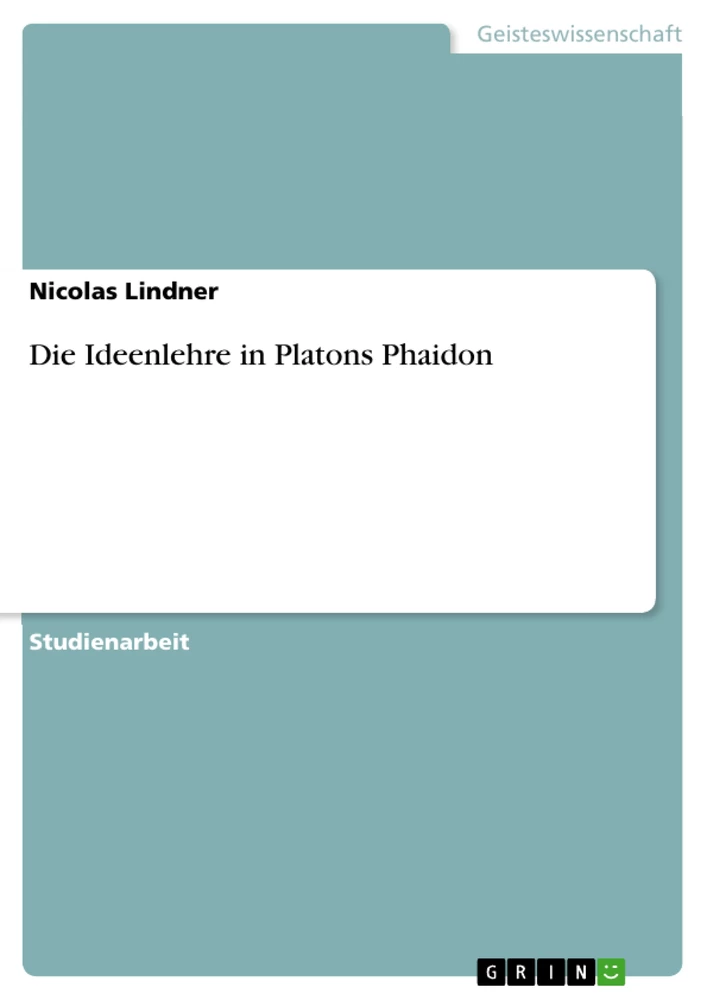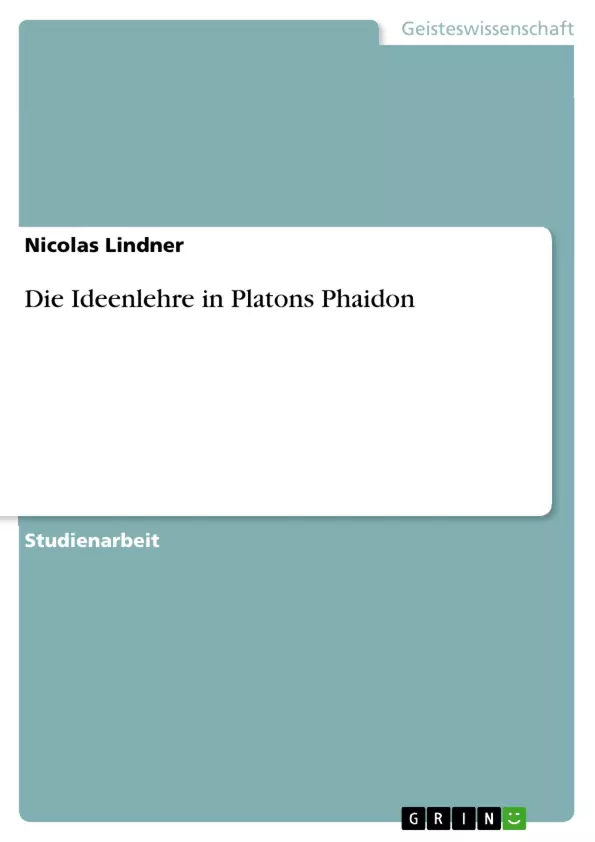Im Mittelpunkt des Dialoges "Phaidon" stehen die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele. Im Zuge der betreffenden Argumentation behandelt Platon jedoch auch wesentliche weitere Elemente seiner Philosophie. Neben der Anamnesislehre beschäftigt er sich im Dialog ausführlich mit der Ideenlehre. In keinem anderen Dialog früheren Datums nimmt die platonische Theorie der Ideen einen derartigen Stellenwert ein. Die hohe Vielfalt und Dichte der philosophischen Fragestellungen und Argumentationen im Phaidon führt zu der Frage, welches das eigentlich zentrale Thema des Dialoges ist. Zwar ist der größte Teil des Textes dem Versuch gewidmet, die Unsterblichkeit der Seele nachzuweisen, jedoch steht bei diesem Unterfangen die Ideenlehre fast durchgehend im Hintergrund. Ziel dieser Arbeit ist es demzufolge, darzulegen, dass die platonische Theorie der Ideen das zentrale Thema des Phaidon darstellt. Im Zuge der Untersuchung möchte ich daher zunächst darlegen, dass im Dialog bereits alle wesentlichen Elemente der Ideenlehre angeführt werden. Ferner werde ich anhand der Darstellung dieser Kernelemente nachweisen, dass auch die Unsterblichkeitsbeweise im Phaidon zu weiten Teilen auf die Ideenlehre zurückgreifen und auf diese angewiesen sind.
Zunächst werde ich auf die Bezeichnungen eingehen, welche Platon für die Ideen wählt, sowie darlegen, welche Eigenschaften er den Ideen zuspricht und welche Typen derselben er einführt. In einem weiteren Schritt werde ich der Frage nachgehen, inwieweit im Phaidon bereits die so genannte Zweiweltenlehre, die ontologische Trennung von Ideen und Einzeldingen, vorausgesetzt wird. Im letzten Schritt möchte ich klären, welche spezifische Erklärungsleistung die platonische Ideenlehre im Dialog erbringt. Im Rahmen dessen werde ich mich mit dem Verhältnis von Ideen und sinnlich erfahrbaren Gegenständen, vor allem aber auch mit den so genannten immanenten Eigenschaften auseinandersetzen. Im Fazit werde ich nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse auf die Frage eingehen, inwieweit es berechtigt ist, die Ideenlehre als Hauptthema des Dialoges zu qualifizieren. Dabei wird vor allem zu prüfen sein, ob Platon im Phaidon bereits eine voll entwickelte Version der Theorie vorbringt und inwiefern die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele auf diese rekurrieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ideenlehre in Platons Phaidon
- Bezeichnungen von Ideen
- Eigenschaften und Typen von Ideen
- Transzendenz der Ideen — Zweiweltenlehre
- Erklärungsleistung der Ideenlehre
- Ideen als Ursache von Eigenschaften
- Das Verhältnis zwischen Ideen und Gegenständen
- Immanente Eigenschaften
- Zusammenfassung / Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Ideenlehre in Platons Phaidon und untersucht deren zentrale Rolle im Dialog. Die Arbeit zeigt, dass die Ideenlehre nicht nur ein wichtiges Element, sondern das zentrale Thema des Phaidon darstellt. Dabei werden die wesentlichen Elemente der Ideenlehre sowie ihre Bedeutung für die Beweisführung der Unsterblichkeit der Seele im Phaidon herausgearbeitet.
- Die Bedeutung der Ideenlehre für die Argumentation im Phaidon
- Die Eigenschaften und Typen von Ideen in Platons Phaidon
- Die Transzendenz der Ideen und die Zweiweltenlehre
- Die Erklärungsleistung der Ideenlehre, insbesondere in Bezug auf das Verhältnis von Ideen und sinnlich erfahrbaren Gegenständen
- Die Rolle der immanenten Eigenschaften in der Ideenlehre und ihre Bedeutung für die Beweisführung der Unsterblichkeit der Seele
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Phaidon als eines der wichtigsten Werke Platons dar. Sie skizziert die zentralen Themen des Dialogs, insbesondere die Beweisführung der Unsterblichkeit der Seele und die Bedeutung der Ideenlehre in diesem Zusammenhang. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Ideenlehre als zentrales Thema des Phaidon zu etablieren.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Ideenlehre in Platons Phaidon. Es werden die Bezeichnungen von Ideen, ihre Eigenschaften und Typen sowie die Frage nach ihrer Transzendenz und der Zweiweltenlehre untersucht. Darüber hinaus wird die Erklärungsleistung der Ideenlehre im Phaidon analysiert, insbesondere in Bezug auf das Verhältnis von Ideen und sinnlich erfahrbaren Gegenständen sowie die Rolle der immanenten Eigenschaften.
Das dritte Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und bewertet die These, dass die Ideenlehre das zentrale Thema des Phaidon darstellt. Es wird argumentiert, dass die Ideenlehre nicht nur ein wichtiges Element, sondern die Grundlage für die Beweisführung der Unsterblichkeit der Seele im Phaidon ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ideenlehre, Platons Phaidon, Unsterblichkeit der Seele, Transzendenz der Ideen, Zweiweltenlehre, Teilhabe, Immanente Eigenschaften, Erklärungsleistung, Wesensmäßige Eigenschaften, Anamnesislehre, Affinitätsargument.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Platons „Phaidon“?
Die Arbeit legt dar, dass entgegen der oberflächlichen Ansicht nicht nur die Unsterblichkeit der Seele, sondern die Ideenlehre das eigentliche Fundament des Dialogs bildet.
Was besagt die Zweiweltenlehre im „Phaidon“?
Sie beschreibt die ontologische Trennung zwischen der Welt der unveränderlichen Ideen und der Welt der vergänglichen, sinnlich erfahrbaren Einzeldinge.
Wie hängen Ideenlehre und Unsterblichkeitsbeweise zusammen?
Die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele (z.B. das Affinitätsargument) rekurrieren auf die Existenz der Ideen als ewige Wahrheiten.
Was sind „immanente Eigenschaften“?
Es handelt sich um Eigenschaften, die Gegenständen innewohnen, weil sie an einer bestimmten Idee teilhaben, was im Dialog zur Erklärung von Ursachen genutzt wird.
Welche Rolle spielt die Anamnesislehre im Dialog?
Die Lehre von der Wiedererinnerung besagt, dass die Seele vor ihrer Verkörperung die Ideen geschaut hat und sich im Leben an dieses Wissen erinnert.
- Arbeit zitieren
- B.A. Nicolas Lindner (Autor:in), 2011, Die Ideenlehre in Platons Phaidon, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178606