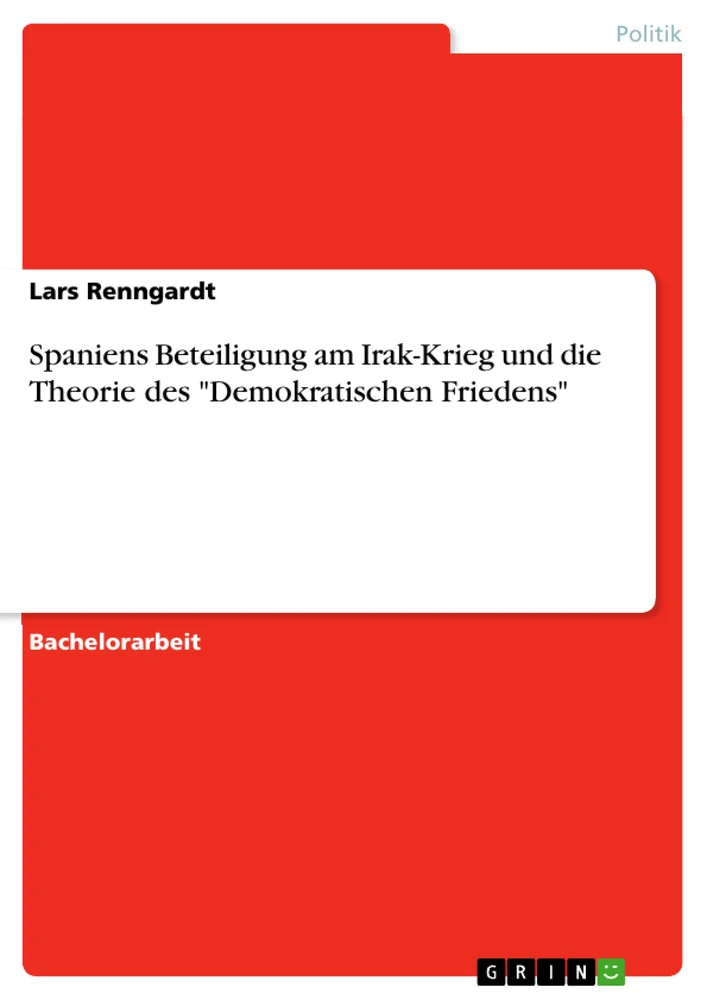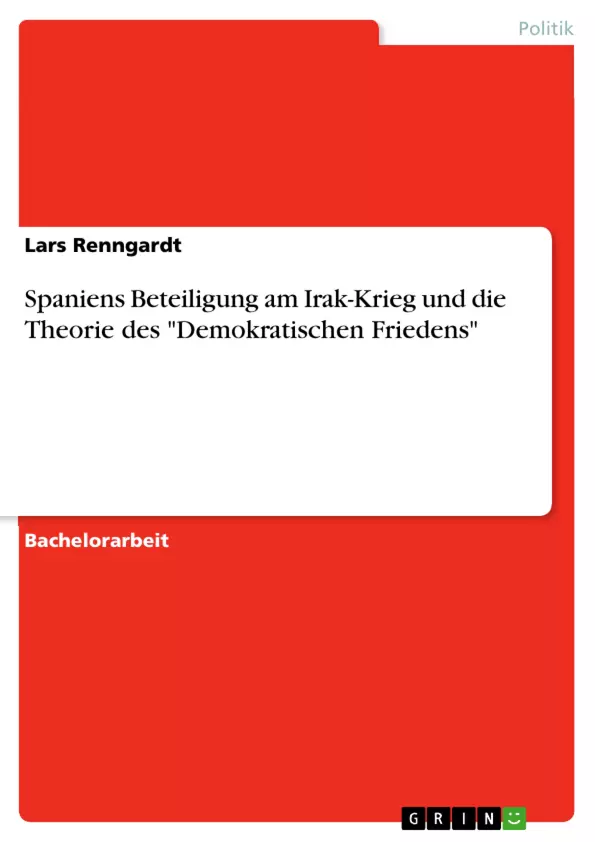Das Interesse dieser Arbeit liegt also auf den Gründen, die zu einer Unfriedlichkeit von Demokratien – in unserem Fall am Beispiel Spanien und dessen Beteiligung am Irak – Krieg – führen. Geklärt werden soll, ob jenes militante Außenverhalten von Demokratien gegenüber Autokratien mit Hilfe der gleichen Gründe hergeleitet werden kann, die auch herangezogen werden, um jene „friedfertigere“ Art und Weise von Demokratien gegenüber Autokratien zu erklären.
Dem Einstieg in die eigentliche Debatte soll das Theorem des „Demokratischen Friedens“ an sich vorgeschoben werden. Hierbei soll nur sehr kurz auf große Namen wie „Immanuel Kant“ oder „Jean Jaques Rousseau“ eingegangen werden, das Hauptaugenmerk ist auf die Theorie des „Demokratischen Friedens“ an sich gerichtet, vor allen Dingen auf dessen monadische Variante. Im Zuge dessen wird es auch zu einzelnen Erläuterungen von Begrifflichkeiten wie Demokratie, Autokratie und Krieg kommen, um sowohl den Irak als auch Spanien zu klassifizieren.
Im Anschluss hieran soll dann das Phänomen des „Demokratischen Krieges“ näher beleuchtet werden, also jene militante Verhaltensweise von Demokratien gegenüber Autokratien, um dann auf Spanien und dessen Haltung im Irak – Krieg zu kommen. Geklärt werden soll unter anderem, in welcher Form sich Spanien am Irak – Krieg beteiligt hat. Desweiteren werden als Reaktion dessen die verschiedenen Konfliktlinien, jene zwischen der spanischen Bevölkerung und der spanischen Regierung, aber auch die innerhalb der spanischen Regierung, anhand verschiedener Analysen vorgestellt, wobei hier fallende Zahlen hauptsächlich auf Erkenntnisse aus dem Eurobarometer zurück zu führen sind.
Nachdem nun Grundlagen dargestellt und erläutert wurden, widmet sich diese Arbeit der eigentlichen Fragestellung: Kann jene Unfriedlichkeit Spaniens anhand der gleichen Gründe erklärt werden, welche auch zur Klärung von einem friedlichen Verhalten von Demokratien im Sinne der Theorie des „Demokratischen Friedens“ herangezogen wird? Hierbei sollen also verschiedene Erklärungsansätze zu Tragen kommen, darunter jene Utilitaristische Betrachtungsweise, die Institutionelle Betrachtungsweise wie letztlich auch die Normativ – Kulturelle Betrachtungsweise. Der im Anschluss folgende Schluss dieser hier vorliegenden Arbeit soll auf der einen Seite dann einer kurzen Zusammenfassung dienen, auf der anderen Seite aber auch Raum für einen Ausblick bereit halten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemdarstellung
- 1.2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Hauptteil
- 2.1. Die Theorie des „Demokratischen Friedens“
- 2.2. Die Theorie des „Demokratischen Krieges“
- 2.3. Spanien und dessen Haltung im Irak-Krieg
- 2.4. Gründe für die Unfriedlichkeit von Demokratien am Beispiel Spaniens
- 2.4.1. Utilitaristische Gründe
- 2.4.2. Institutionelle Gründe
- 2.4.3. Normativ – Kulturelle Gründe
- 3. Fazit und Ausblick
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Spaniens Beteiligung am Irak-Krieg im Lichte der „Demokratischen Friedens“ Theorie. Sie untersucht die Gründe für das militante Außenverhalten von Demokratien gegenüber Autokratien, besonders im Kontext von Spanien und seiner Rolle im Irak-Krieg. Die Arbeit beleuchtet die Diskrepanz zwischen der Theorie des „Demokratischen Friedens“, die friedfertige Interaktionen zwischen Demokratien postuliert, und den realen Ereignissen im Irak-Krieg.
- Die Theorie des „Demokratischen Friedens“ und ihre Kritikpunkte
- Spaniens Entscheidung, am Irak-Krieg teilzunehmen, trotz innerer und internationaler Kritik
- Die verschiedenen Argumente, die Spaniens Beteiligung am Irak-Krieg erklären, wie utilitaristische, institutionelle und normativ-kulturelle Gründe
- Die Spannungen zwischen der spanischen Regierung und der Bevölkerung im Kontext des Irak-Krieges
- Die Auswirkungen des Irak-Krieges auf Spaniens Rolle im internationalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Irakkrieges und Spaniens Beteiligung daran vor, die im Kontext der „Demokratischen Friedens“ Theorie analysiert wird. Im Hauptteil wird zunächst die „Demokratische Friedens“ Theorie vorgestellt, bevor die „Demokratische Krieges“ Theorie behandelt wird. In Kapitel 2.3 wird Spaniens Haltung zum Irakkrieg beleuchtet und in Kapitel 2.4 werden die Gründe für die Unfriedlichkeit von Demokratien am Beispiel Spaniens analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Konzepte des „Demokratischen Friedens“ und des „Demokratischen Krieges“, untersucht Spaniens Rolle im Irakkrieg und analysiert die verschiedenen Faktoren, die Spaniens Entscheidung beeinflusst haben. Zentrale Themen sind die Außenpolitik Spaniens, der Irak-Krieg, die Theorie des „Demokratischen Friedens“, die „Friedfertigkeit“ von Demokratien und die Gründe für das militante Auftreten von Demokratien gegenüber Autokratien.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des "Demokratischen Friedens"?
Die Theorie postuliert, dass Demokratien untereinander keine Kriege führen, da sie Konflikte durch Verhandlungen und geteilte Normen lösen.
Warum beteiligte sich Spanien am Irak-Krieg?
Die Arbeit untersucht utilitaristische, institutionelle und normativ-kulturelle Gründe. Trotz massiver Proteste der Bevölkerung sah die damalige Regierung strategische Vorteile in der Allianz mit den USA.
Was versteht man unter dem "Demokratischen Krieg"?
Dies beschreibt das Phänomen, dass Demokratien zwar untereinander friedlich sind, aber durchaus bereit sind, militärische Gewalt gegen autokratische Regime anzuwenden.
Wie reagierte die spanische Bevölkerung auf den Kriegseintritt?
Es gab eine tiefe Kluft zwischen Regierung und Volk. Analysen des Eurobarometers zeigten eine überwältigende Ablehnung des Krieges in der spanischen Gesellschaft.
Welche Erklärungsansätze für Spaniens Verhalten werden analysiert?
Die Arbeit nutzt die utilitaristische Betrachtung (Nutzen-Kosten), die institutionelle Betrachtung (politische Strukturen) und die normativ-kulturelle Betrachtung (Werte und Identität).
- Quote paper
- Lars Renngardt (Author), 2011, Spaniens Beteiligung am Irak-Krieg und die Theorie des "Demokratischen Friedens", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178717