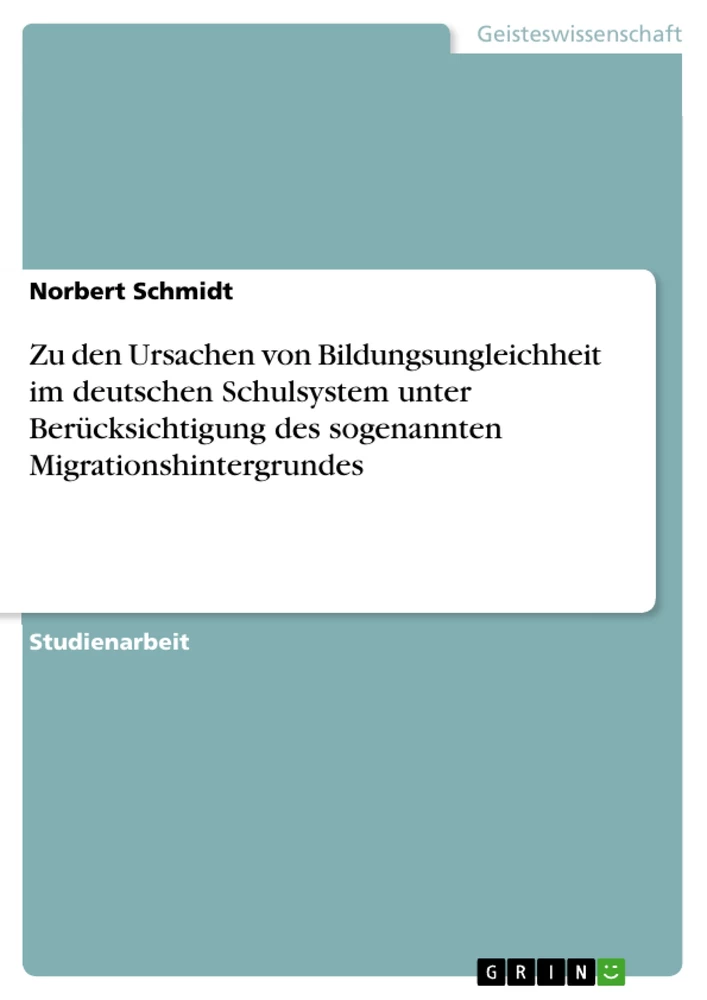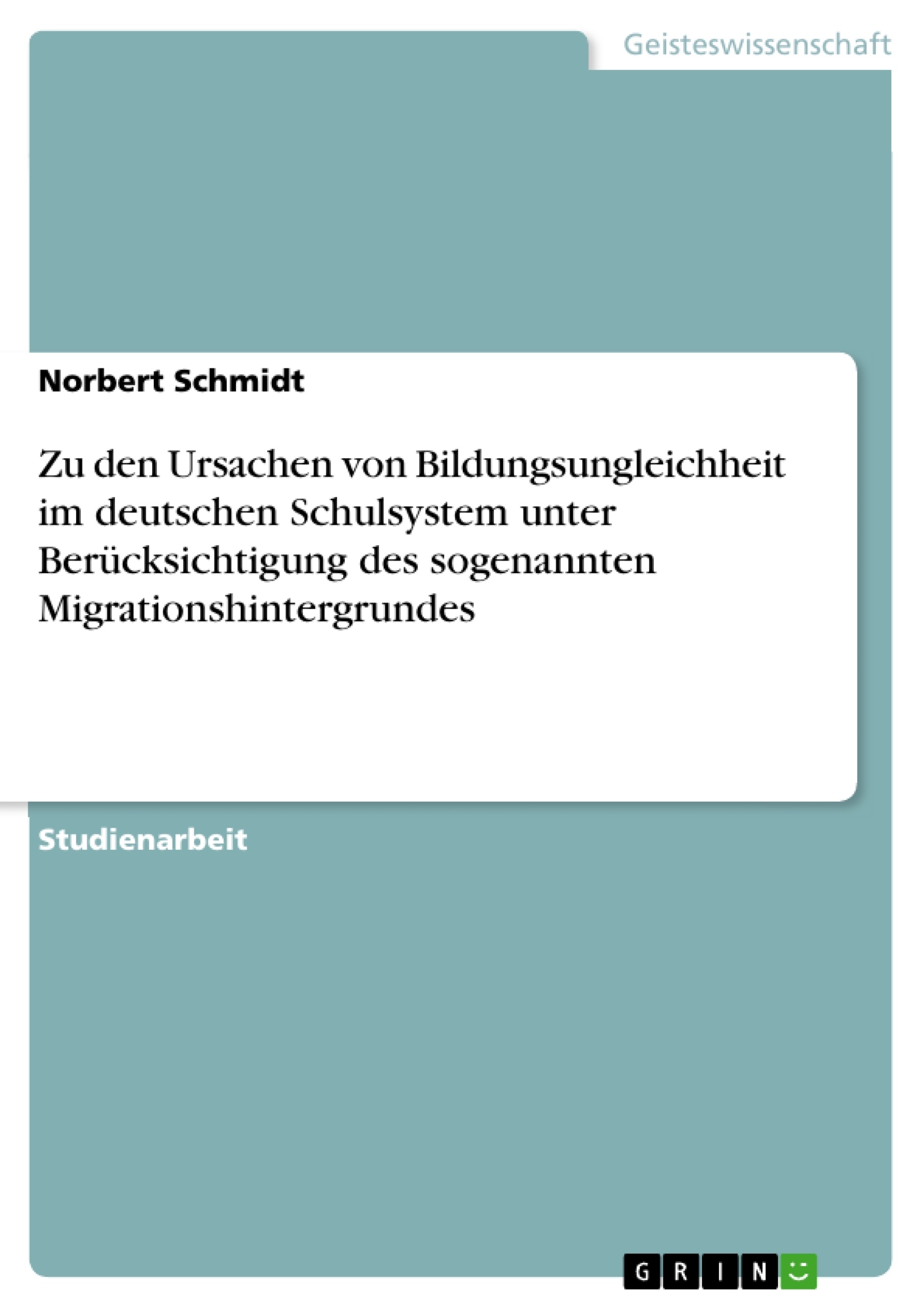1 Einleitung
Das Seminar widmete sich einem Thema, dessen Breite - zumindest für einen Nicht-Soziologen wie mich - erst bei genauerer Betrachtung deutlich wurde. Bereits im Titel eröffneten sich Subthemenkreise, die, für sich genommen, während des gesamten Seminars für anregende Diskussionen sorgten. Hierbei stach hervor, dass insbesondere eine möglichst genaue Definition der verwendeten Begriffe von Nöten ist, um sich einerseits ein Urteil über die Ist-Situation bilden zu können und sich andererseits argumentativ gestützt einer Handlungsperspektive anschließen zu können.
Insofern nehme ich diese Arbeit als willkommenen Anlass, mir selbst einen Weg durch den Dschungel der Thematik zu schlagen, der auch auf der Ebene des Forschungsstandes viele Verästelungen aufweist und das nicht nur vor dem Hintergrund der zeitlichen Abfolge seines Entstehens. Gleichwohl scheint sich in der Forschung ein Weg oder eher ein Wegweiser abzuzeichnen, der - auch für mich als Lehramtskandidaten - einen nicht nur bewusstseinsschärfenden, sondern darüber hinaus handlungsorientierenden Effekt haben sollte. Von Interesse ist für mich dabei auch die Tauglichkeit des Begriffs „Migrationshintergrund“ in der Debatte um Bildungsungleichheit.
Dazu bedarf es zunächst einer Klärung der wichtigsten Begriffe und der Beleuchtung der Verknüpfungen zwischen diesen Begriffen. Basierend auf der Vorstellung der Ursachen der Bildungsungleichheit werde ich meinen Blick auf die Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Akteure werfen.
Inhalt
1 Einleitung
2 Begriffe
2.1 Migrationshintergrund
2.2 Bildung, Bildungserfolg
2.3 Bildungsbenachteiligung, Bildungsungleichheit
3 Repräsentationen von Bildungsungleichheit
4 Ursachen der Bildungsungleichheit
4.1 Institutionelle Benachteiligung
4.2 Auf Herkunft basierende Bildungsbenachteiligung
4.2.1 Migrationshintergund vs. soziale Herkunft
4.2.2 Repräsentationen von Bildungsbenachteiligung aufgrund der Herkunft
5 Perspektiven - statt eines Schlusses
6 Literatur
- Quote paper
- Norbert Schmidt (Author), 2011, Zu den Ursachen von Bildungsungleichheit im deutschen Schulsystem unter Berücksichtigung des sogenannten Migrationshintergrundes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179700