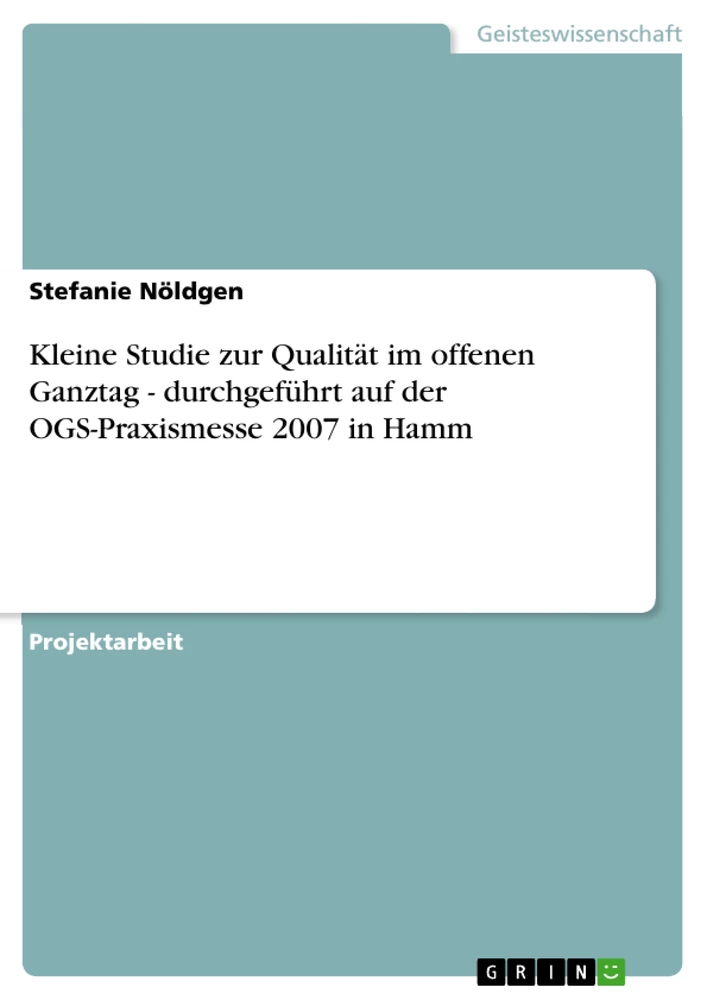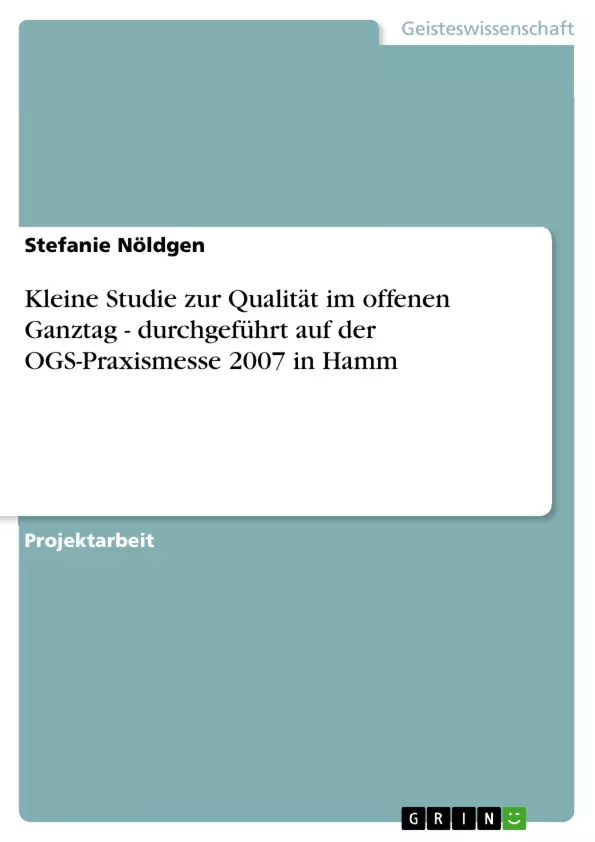Über 1.400 Besucher/-innen folgten der Einladung der Serviceagentur „Ganztägig lernen in Nordrhein-Westfalen“ und besuchten die Praxismesse „Qualität im offenen Ganztag“, die am 18. April 2007 ihre Pforten öffnete. Aus ganz NRW kamen Interessierte nach Hamm und nutzten den Tag, um sich an den Messeständen sowie in den zahlreichen Foren und bei Präsentationen zu informieren und auszutauschen. Diese große Resonanz machte deutlich: Die Messe hat mit ihrem Motto „Qualität im offenen Ganztag“ ein zentrales Thema aufgegriffen. Darüber hinaus spiegele sich in dem Motto auch ein gewachsenes Selbstvertrauen aller an der offenen Ganztagsgrundschule Beteiligten, denn es gehe beim Thema OGS nun „nicht mehr um das OB, sondern um das WIE“, so Dr. Erwin Jordan vom Institut für soziale Arbeit e. V. bei der Eröffnung der Messe. Doch die Frage nach dem „wie“ ist oft gar nicht so leicht zu beantworten. Da die Schulen individuell seien, könne es keine einheitlichen Vorgaben geben, so Ministerin Sommer bei der Eröffnung der Messe. Jede Schule müsse ihre eigene Qualität entwickeln, passgenau zu den Bedingungen vor Ort und abgestimmt auf ihre einzigartige Schülerschaft, denn „der Charme des Ganzen ist ja, dass so viele bunte Blumen blühen dürfen.“
Ich habe die Messe genutzt, um heraus zu finden, wie es um die OGS steht, was gut läuft und wo es noch Entwicklungsbdarfe gibt. Dazu habe ich unterschiedliche Akteure (pädagogische Leitung, Schulleitung, Schulträger, Trägervertreter, Berater im Ganztag) befragt, die aus ihrem jeweiligen Blickwinkel antworteten. So ist ein facettenreicher Einblick in das System OGS mit seinen Chancen und Entwicklungsbedarfen sowie in den Alltag an Offenen Ganztagsschulen entstanden.
Inhaltsverzeichnis
- Über 1.400 Besucher/-innen folgten der Einladung der Serviceagentur „Ganztägig lernen in Nordrhein-Westfalen“ und besuchten die Praxismesse „Qualität im offenen Ganztag“, die am 18. April 2007 ihre Pforten öffnete.
- Aus ganz NRW kamen Interessierte nach Hamm und nutzten den Tag, um sich an den Messeständen sowie in den zahlreichen Foren und bei Präsentationen zu informieren und auszutauschen.
- Diese große Resonanz machte deutlich: Die Messe hat mit ihrem Motto „Qualität im offenen Ganztag\" ein zentrales Thema aufgegriffen.
- Darüber hinaus spiegele sich in dem Motto auch ein gewachsenes Selbstvertrauen aller an der offenen Ganztagsgrundschule Beteiligten, denn es gehe beim Thema OGS nun „nicht mehr um das OB, sondern um das WIE\", so Dr. Erwin Jordan vom Institut für soziale Arbeit e. V. bei der Eröffnung der Messe.
- Dies scheinen auch die aktuellen Zahlen zu belegen, die Ministerin Barbara Sommer (MSW) und Minister Armin Laschet (MGFFI) zur Messeröffnung mitbrachten: 375 von 396 Gemeinden in NRW haben offene Ganztagsschulen im Primarbereich, 164.500 Plätze in 2.881 Schulen sind eingerichtet.
- Die Frage nach dem „ob“ verliert somit an Bedeutung, doch die Frage nach dem „wie“ ist oft gar nicht so leicht zu beantworten.
- Da die Schulen individuell seien, könne es keine einheitlichen Vorgaben geben, so Ministerin Sommer bei der Eröffnung der Messe.
- Jede Schule müsse ihre eigene Qualität entwickeln, passgenau zu den Bedingungen vor Ort und abgestimmt auf ihre einzigartige Schülerschaft, denn „der Charme des Ganzen ist ja, dass so viele bunte Blumen blühen dürfen.“
- Die Marschrichtung jedoch ist klar: „Das Kind in einen ganzheitlichen Blick zu nehmen den ganzen Tag, das ist etwas, was in der offenen Ganztagsschule ganz besonders gelingt“, machte Minister Laschet deutlich.
- Er regte an, die Kooperation von Jugendhilfe und Schule auszubauen und auch auf andere Bereiche auszuweiten, denn das komme den Kindern zugute.
- Ob an den Ständen, in Foren oder beim Mittagessen, überall kamen die unterschiedlichsten Menschen miteinander ins Gespräch, und schon bald erweckte die Messehalle den Eindruck, ein riesiger, brummender Bienenstock zu sein.
- „Was läuft denn bei euch so richtig gut?\" war eine oft gestellte Frage, auf die jeder und jede eine eigene Antwort hatte: Richtig gut läuft an unseren Schulen „die Entwicklung, dass Jugendhilfe und Schule sich aufeinander zu bewegen.
- Und dass da, wo beide Seiten bereit sind zusammenzuarbeiten, auch was richtig Gutes entsteht, wo man das Gefühl hat: Das ist mehr als eine reine Betreuung oder Kinderverwahrung, hier kommt ein qualitativer Aspekt zum tragen, der deutlich über das hinausgeht, was Schule alleine oder Jugendhilfe alleine jemals leisten könnten“, erzählte ein Trägervertreter.
- „Richtig vorbildlich finde ich die Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung und mir als Vertreterin des Teams des offenen Ganztages.
- Da ist ganz viel Informationsfluss gegeben“, berichtete eine pädagogische Leiterin.
- „Wir ziehen in ein gemeinsames Haus ein.
- Es entsteht ein Neubau mit fünf neuen Gruppenräumen, den wir gemeinsam planen, so dass wir wirklich in ein Haus einziehen, das gemeinsam gedacht, entwickelt und mit Leben gefüllt wird.
- Das ist was anderes, als wenn wir da hinein platziert werden und gesagt wird:,So, jetzt belegt es mal'.\" Auch die Kooperation zwischen dem Ganztagsteam und dem Lehrerkollegium ist an dieser Schule nach ihren Worten auf einem guten Weg: „Es entsteht.
- Es ist einfach auch schön zu beobachten.
- Ein großer Vorteil ist, dass ich sehr präsent bin“, erzählte die pädagogische Leiterin weiter.
- „Dadurch, dass ich täglich sichtbar bin für die Lehrerinnen, sinkt die Schwelle.
- Das heißt, es finden immer Gespräche über einzelne Kinder, über Fragen, Ideen und Vorschläge statt.
- Es ist ein stetiger Austausch gewährleistet.
- Ein weiterer Punkt sind gemeinsame Fortbildungen, die besucht werden - und dass in einer Evaluation wirklich ganz klar gesagt wird, dass es schön ist, in den Schuhen des anderen zu gehen, dass Sachen, von denen man gedacht hat, dass sie am Vormittag ganz anders sind, entweder ganz genauso sind oder halt doch wirklich ganz anders.“
- „Was richtig gut läuft ist, dass die Stimmung in den Gruppen für die Kinder sehr gut ist.
- Was gemacht wird, hat Hand und Fuß, man kann immer was verbessern, das ist klar.
- Aber die Leute haben in der Regel ein hohes Engagement“, berichtete ein Schulleiter, der darüber hinaus Berater im Ganztag und Vorsitzender eines Trägervereins ist.
- „Was auch gut läuft an vielen Schulen ist der Versuch Eltern einzubinden.
- Das kann noch ausgeweitet werden, aber das ist ein generelles Thema von Schule.\" Eine Schulleiterin erzählte: „Wir haben einen Elternabend angeboten für die Ganztagseltern.
- Da waren drei Eltern da und da schließen wir draus, dass die Eltern ganz zufrieden sind mit dem was wir machen, denn sonst wären sie gekommen und hätten geschimpft.
- Das zeigt die Resonanz, wenn Eltern die Kinder abholen, persönliche Gespräche; sie sagen uns auch sofort, wenn sie meinen, etwas müsste anders sein und fragen uns, warum wir das so und nicht anders machen.
- Ich glaube, die Eltern sind damit zufrieden.
- Ihre Kinder sind zufrieden, sind ausgeglichen und kommen in der Schule gut zurecht.
- Damit haben wir sie überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
- Und ich denke, gerade von Seiten der Jugendhilfe ist das der richtige Weg - es geht eben nicht darum nachmittags Schule zu machen.
- Und das haben wir als Schule gelernt von der Jugendhilfe.“
- „Das wird super von den Eltern angenommen, weil die ihre Kinder da gut betreut wissen“, schilderte eine Beraterin im Ganztag die Situation an den von ihr betreuten Schulen.
- „Auch schon vor der Schule, weil sie dann eben problemloser arbeiten gehen können und zum Teil auch, weil sie sich selbst nicht so kompetent fühlen.
- Ich hab ein paar Brennpunktschulen in der Beratung und da ist eben das Kompetenzproblem der Eltern oft ein Grund, warum das Angebot gut angenommen wird.“
- Eine andere Beraterin im Ganztag ergänzte: „Das kann ich auch für die Hauptschule bestätigen.
- Wir haben oft Kinder aus Brennpunktfamilien.
- Bei uns wird die ganze Versorgung sehr gut angenommen, das Losgelöstsein von zu Hause und so weiter.\" Die Kinder „kommen gerne.
- Wenn sie einmal angemeldet sind, bleiben sie“, erzählte eine Schulleiterin.
- „Sie kommen auch in die Ferienbetreuung gerne und nehmen immer mal einen Freund mit, der nicht angemeldet ist.
- Der soll dann mal mitgehen nachmittags und deshalb denke ich, dass ihnen das gut gefällt.
- Aber ich glaube, es gefällt ihnen auch deshalb gut, weil wir halt den Nachmittag so gestalten, wie die Kinder ihn eigentlich zu Hause haben sollten.
- Nämlich viel Spielzeit, viel Freizeit und keinen Nachmittag, der durchgeplant ist wie der Vormittag.
- Uns ist wichtig, dass die Kinder nachmittags sehr viel eigenen Spielraum haben und ihre Zeit selbst bestimmt verwalten können.“
- Bei uns werden die Hausaufgaben „von den Mitarbeiterinnen betreut, die die Kinder den ganzen Nachmittag begleiten“, berichtete eine pädagogische Leiterin, denn „das ist ein ganz wichtiger Punkt, der die Kinder gerne im offenen Ganztag bleiben lässt: die Bezugspersonen, die sozialen Beziehungen und ihre Freunde, die da sind.”
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die kleine Studie untersucht die Qualität des offenen Ganztags an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen und beleuchtet die Erfahrungen und Perspektiven der Beteiligten.
- Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Qualität des offenen Ganztags
- Strukturierung und Rhythmisierung des Ganztags
- Entwicklungsbedarfe im offenen Ganztag
- Belastung des Betreuungspersonals
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beschreibt die Praxismesse „Qualität im offenen Ganztag“, die im April 2007 in Hamm stattfand und von der Serviceagentur „Ganztägig lernen in Nordrhein-Westfalen“ organisiert wurde. Die Messe bot Gelegenheit, sich über die Qualität des offenen Ganztags zu informieren und auszutauschen.
Der Text beleuchtet die verschiedenen Aspekte des offenen Ganztags, insbesondere die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule, die Strukturierung des Ganztags und die Herausforderungen, die sich für das Betreuungspersonal ergeben.
Schlüsselwörter
Offener Ganztag, Qualität, Kooperation, Jugendhilfe, Schule, Strukturierung, Rhythmisierung, Entwicklungsbedarfe, Belastung, Betreuungspersonal, Praxismesse, Nordrhein-Westfalen
Häufig gestellte Fragen
Was macht die Qualität im Offenen Ganztag (OGS) aus?
Qualität entsteht durch die enge Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe, einen ganzheitlichen Blick auf das Kind und eine individuelle Anpassung an die Bedingungen vor Ort.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Erziehern?
Ein stetiger Informationsfluss, gemeinsame Fortbildungen und eine hohe Präsenz des pädagogischen Personals im Schulalltag senken die Hemmschwellen und verbessern den Austausch über die Kinder.
Welche Rolle spielen Hausaufgaben in der OGS?
Hausaufgaben werden oft von Bezugspersonen betreut, die die Kinder den ganzen Tag begleiten, was für Kontinuität und stabile soziale Beziehungen sorgt.
Warum ist Spielzeit im Ganztag so wichtig?
Nachmittage sollten nicht so durchgeplant sein wie der Vormittag. Viel Spielraum und selbstbestimmte Freizeit sind entscheidend, damit sich die Kinder in der OGS wohlfühlen.
Wie werden Eltern in den Offenen Ganztag eingebunden?
Durch Elternabende und persönliche Gespräche beim Abholen wird Vertrauen aufgebaut. Eine hohe Zufriedenheit der Eltern zeigt sich oft in einer stabilen Nachfrage nach den Plätzen.
- Quote paper
- Stefanie Nöldgen (Author), 2007, Kleine Studie zur Qualität im offenen Ganztag - durchgeführt auf der OGS-Praxismesse 2007 in Hamm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179921