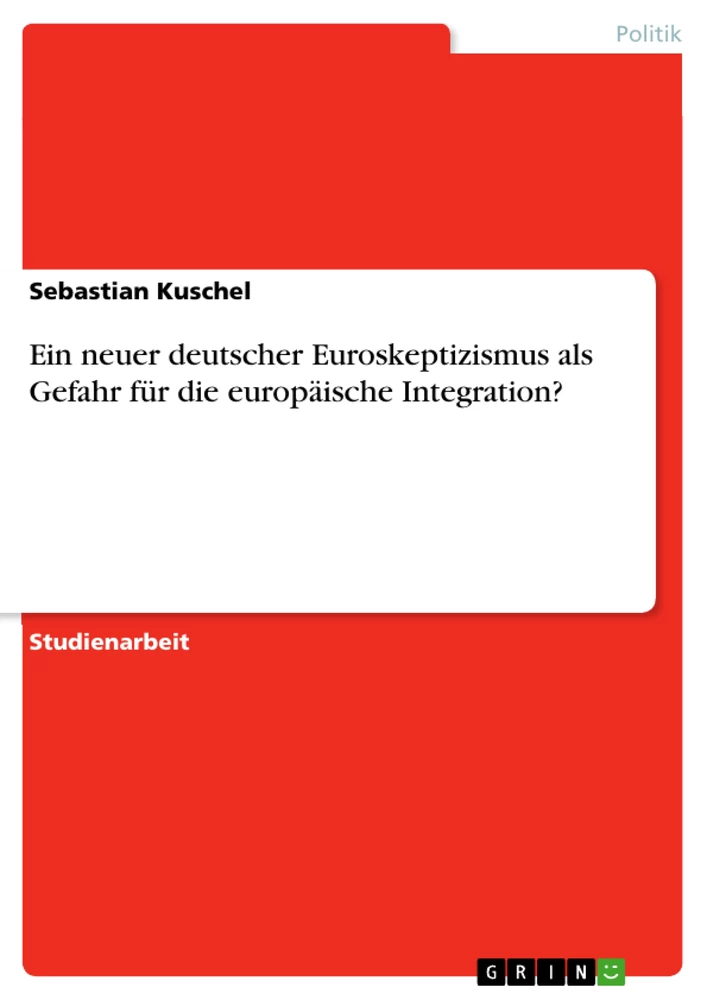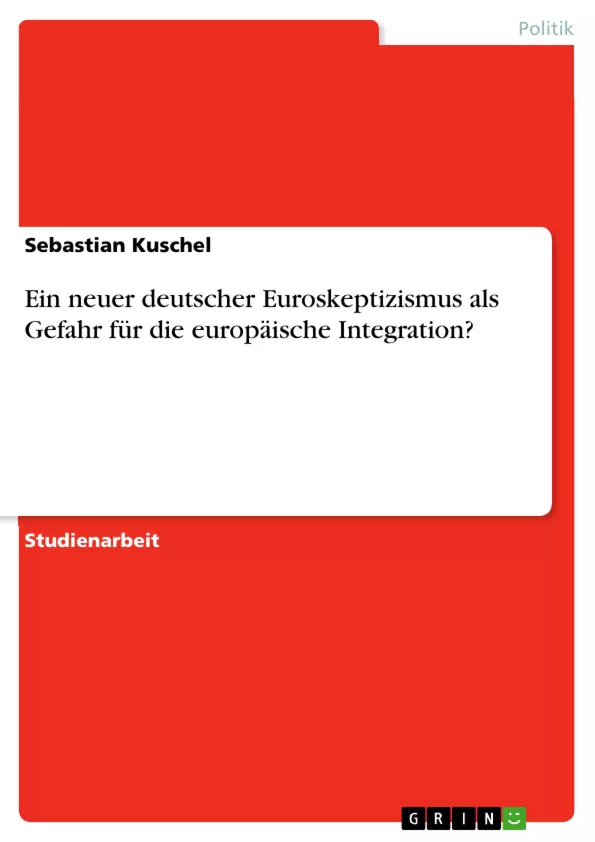Diese Arbeit soll aufzeigen, ob und inwiefern ein aktueller Euroskeptizismus in Deutschland auszumachen ist, welche Gründe hierfür verantwortlich sein könnten und ob aufgrund dessen eine Gefahr für die Zukunft der europäischen Integration besteht. Dazu ist es zunächst notwendig, den theoretischen Begriff des Euroskeptizismus und die dazugehörigen Schemata zu definieren, um eine Einteilung möglich zu machen. Daraufhin werden analytisch die Einstellungen der Bevölkerung und der Euroskeptizismus der Eliten untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- A Kein „Musterknabe“ mehr? - Die BRD nach der Wiedervereinigung.
- B Ein neuer deutscher Euroskeptizismus als Gefahr für die europäische Integration?
- I. Grundlagen zur empirischen Analyse – Das theoretische Konstrukt des Euroskeptizismus und die angewandte Methodik
- II. Analyse: Einstellungen zur europäischen Integration in der öffentlichen Meinung und den politischen Eliten der BRD
- II.1 Die öffentliche Meinung zur europäischen Integration in der BRD
- II.2 Das Handeln der Bundesregierung in der Staatsschuldenkrise
- C Zusammenfassung und Ausblick
- D Anhang.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob und inwiefern in Deutschland ein aktueller Euroskeptizismus existiert, welche Ursachen dafür verantwortlich sind und ob dieser eine Gefahr für die Zukunft der europäischen Integration darstellt.
- Entwicklung des Euroskeptizismus in Deutschland im Kontext der europäischen Integration
- Theoretische Definition und Analyse des Euroskeptizismus
- Einstellungen zur europäischen Integration in der deutschen Bevölkerung und den politischen Eliten
- Die Rolle Deutschlands in der europäischen Staatsschuldenkrise
- Die potenziellen Folgen des Euroskeptizismus für die europäische Integration
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A beleuchtet die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland als "Musterknabe" der Europäischen Union und die Veränderungen nach der Wiedervereinigung, die zu ersten euroskeptischen Stimmen führten.
- Kapitel B.I definiert das theoretische Konstrukt des Euroskeptizismus und die angewandte Methodik der empirischen Analyse.
- Kapitel B.II analysiert die Einstellungen zur europäischen Integration in der deutschen Bevölkerung und den politischen Eliten, wobei die Staatsschuldenkrise im Euro-Raum und das Handeln der Bundesregierung im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Euroskeptizismus, Europäische Integration, deutsche öffentliche Meinung, politische Eliten, Staatsschuldenkrise, Euro-Raum, Bundesrepublik Deutschland, Wiedervereinigung, empirische Analyse, theoretisches Konstrukt, Methodik
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff Euroskeptizismus?
Euroskeptizismus bezeichnet eine ablehnende oder kritische Haltung gegenüber der Europäischen Union und dem Prozess der europäischen Integration.
Gibt es einen neuen Euroskeptizismus in Deutschland?
Die Arbeit untersucht, ob sich die traditionell pro-europäische Haltung in Deutschland gewandelt hat, insbesondere nach der Wiedervereinigung und während der Staatsschuldenkrise.
Welche Rolle spielte die Staatsschuldenkrise für die EU-Kritik?
Die Krise im Euro-Raum und das Handeln der Bundesregierung führten zu verstärkten Debatten über die finanzielle Belastung und die Souveränität Deutschlands innerhalb der EU.
Unterscheiden sich Eliten und Bevölkerung in ihrer EU-Einstellung?
Die empirische Analyse vergleicht die öffentliche Meinung mit dem Handeln der politischen Eliten, um Diskrepanzen in der Integrationsbereitschaft aufzuzeigen.
Ist die europäische Integration durch den deutschen Skeptizismus gefährdet?
Da Deutschland lange als "Musterknabe" der Integration galt, könnte ein wachsender Skeptizismus die Stabilität und Zukunft der gesamten EU maßgeblich beeinflussen.
- Citar trabajo
- Sebastian Kuschel (Autor), 2011, Ein neuer deutscher Euroskeptizismus als Gefahr für die europäische Integration?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180302