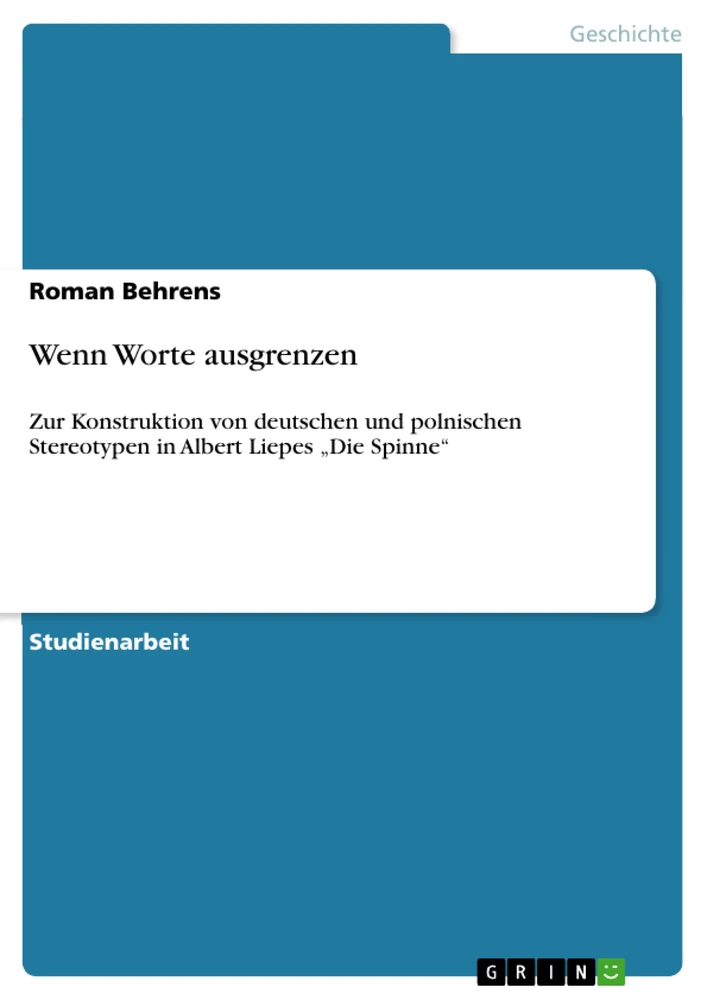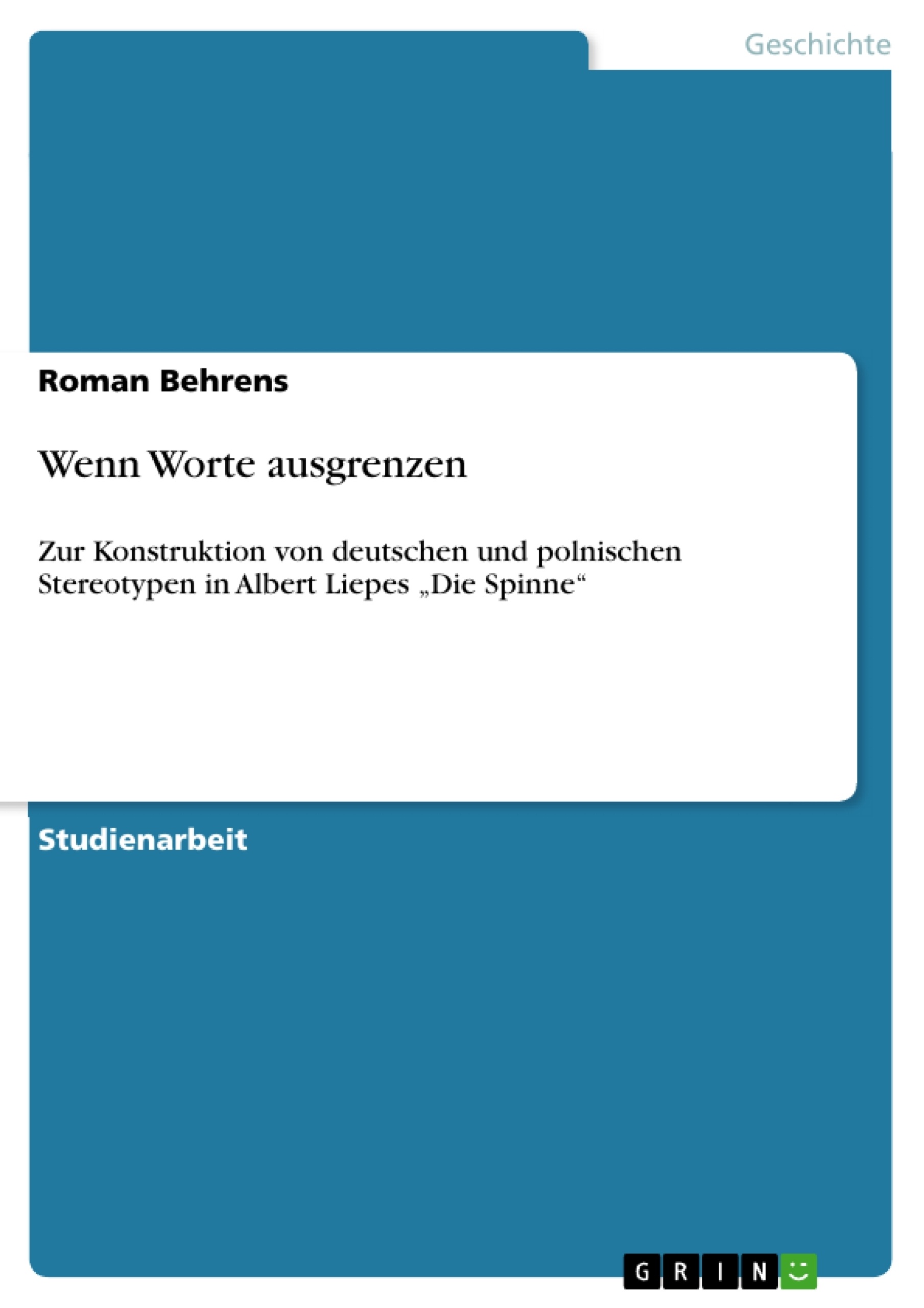„Dem Polenthum ist kein Mittel zu niederträchtig, wenn es geeignet ist, seine Herrschaft auszudehnen und zu befestigen.“
Im Roman „Die Spinne“ von Albert Liepe steht diese Mahnung eines Mitgliedes des Ostmarkenvereins an die im Rahmen einer Versammlung ebenfalls anwesenden Personen exemplarisch für eine Vielzahl von im Roman skizzierten Stereotypen zwischen Polen und Deutschen in der Ostmark während des Übergangs zum 20.Jahrhundert. Die Ostmark, die das Gebiet rund um Posen im heutigen Polen bezeichnet und im
Roman unter preußischer Regierung steht, bildet das Siedlungsziel der Hauptfigur Karl von Steinmann. Das Werk aus dem Jahr 1902 mit dem Untertitel „Roman aus den gegenwärtigen Kämpfen des Polentums wider das Deutschtum in der deutschen Ostmark“ beschreibt verschiedene Eindrücke und Erlebnisse, die er als Ansiedler erlebt, als er in das Dorf Stanislawo kommt und dort mit Hilfe seines Vetters das väterliche und heruntergekommene Gut wieder in bessere Zeiten führen will. Während der nachfolgenden Schilderungen erfährt der Leser ein Vielfaches über das fiktive Zusammenleben zwischen Polen und Deutschen. „Die Spinne“ beschränkt sich dabei nicht nur auf
objektive und sachliche Schilderungen, sondern versucht anhand mehr oder weniger sichtbarer pejorativer Wertungen ein gewisses Bild der beiden Völker zu skizzieren. Dabei kommt den benutzten Stereotypen eine besondere Rolle zu, da Liepe sich ihrer in vielfältiger Art und Weise bedient. Doch was zeichnet Stereotypen aus und inwiefern
können Sie benutzt werden, um wie im Fall des Romans ein bestimmtes Bild von Deutschen und Polen in der Ostmark zu erzeugen? Welche Funktionen sind an den dargestellten Stereotypen evtl. erkennbar? Verbirgt sich dahinter vielleicht eine spezielle Intention?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Stereotypen (de-)konstruktion
- Zur Dekonstruktion von Stereotypen im Roman „Die Spinne“
- Das Heterostereotyp - der listige und fanatische Pole
- Das Autostereotyp - der Vetter Heinrich Schröter
- Der polnische Raum als Ziel deutscher Kultivierungsbestrebungen
- Die Funktion der dargestellten Stereotypen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Roman „Die Spinne“ von Albert Liepe, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielt, und untersucht, wie der Roman Stereotype zwischen Polen und Deutschen in der Ostmark konstruiert. Der Fokus liegt dabei auf der Dekonstruktion der verwendeten Stereotypen und ihrer Funktion innerhalb der Erzählung.
- Die Konstruktion von Stereotypen zwischen Polen und Deutschen in der Ostmark
- Die Dekonstruktion von Stereotypen im Roman „Die Spinne“
- Die Funktion der dargestellten Stereotypen und ihre Wirkung auf den Leser
- Die Darstellung des polnischen Raums im Roman und seine Bedeutung für die Stereotypenbildung
- Die Rolle der Stereotypen in der kulturgeschichtlichen und mentalitätsgeschichtlichen Darstellung der Beziehungen zwischen Polen und Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Roman „Die Spinne“ von Albert Liepe als Analyseobjekt vor. Sie erläutert die Relevanz des Romans für die Erforschung von Stereotypen und die Bedeutung des polnischen Raums in der Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und Deutschen. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Stereotypenforschung und trennt dabei den Begriff des Stereotyps vom Vorurteil.
Das dritte Kapitel widmet sich der Dekonstruktion der im Roman „Die Spinne“ verwendeten Stereotypen. Es werden das Autostereotyp und das Heterostereotyp anhand ausgewählter Figuren des Romans analysiert. Des Weiteren wird der polnische Raum als Ziel deutscher Kultivierungsbestrebungen beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Funktion der dargestellten Stereotypen im Kontext des Romans und analysiert ihre Wirkung auf den Leser. Es wird die Frage gestellt, welche Intentionen hinter der Verwendung von Stereotypen stecken könnten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind Stereotypen, Stereotypenforschung, Autostereotyp, Heterostereotyp, „Die Spinne“, Albert Liepe, Ostmark, Polen, Deutsche, Kulturgeschichte, Mentalitätsgeschichte, Dekonstruktion, Funktion, Wirkung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Roman „Die Spinne“ von Albert Liepe?
Der Roman aus dem Jahr 1902 thematisiert das Zusammenleben und die Konflikte zwischen Polen und Deutschen in der Ostmark während des Übergangs zum 20. Jahrhundert.
Was ist ein Heterostereotyp im Kontext dieser Analyse?
In der Arbeit wird das Heterostereotyp am Beispiel des Bildes vom „listigen und fanatischen Polen“ untersucht, wie es im Roman konstruiert wird.
Was ist ein Autostereotyp?
Das Autostereotyp bezieht sich auf das Selbstbild einer Gruppe; hier wird es am Beispiel der deutschen Figur des Vetters Heinrich Schröter analysiert.
Welche Funktion haben Stereotypen in der Erzählung?
Stereotypen dienen dazu, ein bestimmtes Bild der Völker zu skizzieren, pejorative (abwertende) Wertungen zu transportieren und politische Intentionen wie Kultivierungsbestrebungen zu untermauern.
Was bedeutet die Dekonstruktion von Stereotypen?
Die Dekonstruktion umfasst die kritische Zerlegung und Analyse der Entstehung und Wirkung dieser festgefahrenen Vorstellungen innerhalb des literarischen Textes.
- Quote paper
- Roman Behrens (Author), 2011, Wenn Worte ausgrenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180463