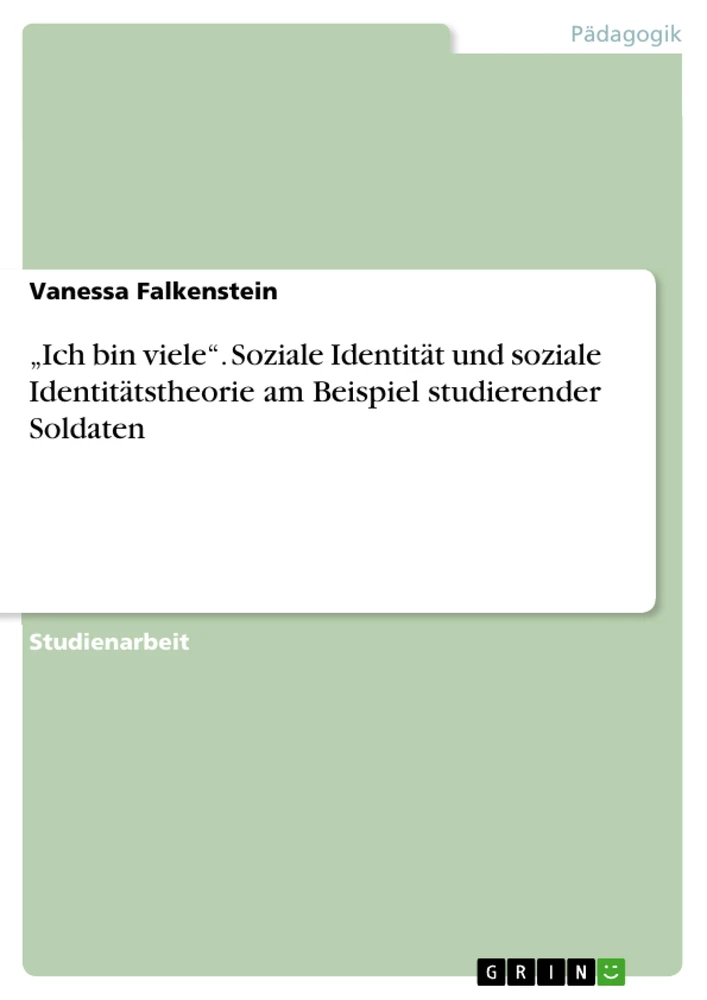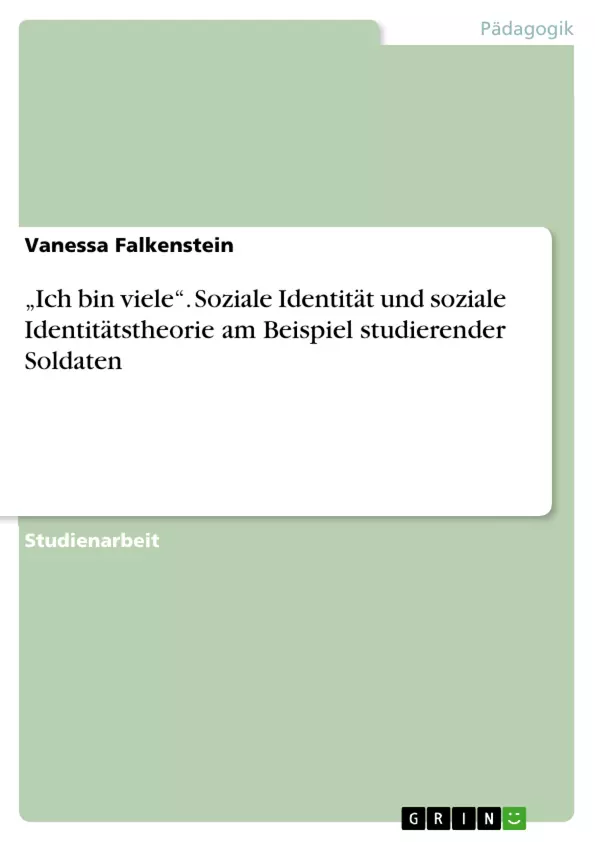Identität ist allgegenwärtig. Diskussionen über nationale, ethnische oder sexuelle Identität füllen viele Seiten der Tages- und Wochenzeitungen. Auch in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Neurowissenschaften, Medizin werden Themen der persönlichen und sozialen Identität beleuchtet. Denn das Verhalten von Menschen zueinander wird von diversen Faktoren beeinflusst: von frühkindlichen bis hin zu aktuellen Erfahrungen, von Bedürfnissen, Wünschen und Ängsten. Diese Elemente bedingen, wie sich ein Mensch zu einem anderen Menschen gibt und verhält. Die Person an sich steht dabei nie alleine, sie ist nie nur von sich selbst geprägt. Die Entwicklung des Menschen ist die Entwicklung von Gruppen auf deren Basis erst das Individuum entstehen konnte. So bestimmt die jeweilige Gruppe oder auch mehrere Gruppen der die Einzelperson angehört, zu einem gewissen Grade, wie sie handelt, reagiert und auftritt (vgl. Abels 2010, S. 255). Dies ist gerade in Bezug auf den studierenden Soldaten der deutschen Bundeswehr besonders relevant und interessant. Der junge Offizier oder Offizieranwärter, meist im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, findet sich insbesondere im Zeitraum seines Studiums in diversen, teilweise scheinbar nicht zusammenpassenden Gruppen wieder. Resultierend daraus entsteht in einigen Fällen eine „Unsicherheit“ über die tatsächliche Zugehörigkeit und die damit verbundene (soziale) Identität.
Angelehnt an das Seminar „Subjektwerdung und Vergesellschaftung im historischen Prozess. Sozialisation, Identität und gesellschaftliche Modernisierung“ soll sich diese Arbeit nicht mit den häufig in der Wissenschaft betrachteten Instanzen für die Bildung und Prägung der Identität, beispielsweise der Familie, der Schule oder dem Beruf beschäftigen, sondern hauptsächlich den sozialen Aspekt, also die Identität in Bezug auf Gruppen fokussieren. Grundlage und gleichzeitig Ziel ist es nicht, das im Seminar vorgetragene Referat zum Text „Alltägliche Identitätsarbeit und Kollektivbezug“ von Wolfgang Kraus zu replizieren, sondern den darin angesprochenen Aspekt der sozialen Identität in dieser Hausarbeit aufzugreifen und die bekannteste Theorie „die soziale Identitätstheorie“ mit Bezugnahme auf die Teilnehmer des Seminars, also die studierenden Offiziere, zu erläutern um dadurch das Phänomen der angesprochenen unsicheren oder undifferenzierten Empfindung der eigenen (sozialen) Identität zu veranschaulichen und zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Identität
- Soziale Identität
- Definition
- Die Theorie der sozialen Identität
- Kategorisierung
- Identifikation
- Sozialer Vergleich
- Soziale Distinktheit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Onlinequellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Einfluss der sozialen Identität auf die Erfahrung studierender Soldaten der deutschen Bundeswehr. Sie konzentriert sich auf die soziale Identitätstheorie, um die „Unsicherheit“ und „Undifferenziertheit“ der eigenen Identität zu erklären, die bei jungen Offizieren im Studium auftreten kann.
- Definition und Entwicklung der sozialen Identität
- Die zentrale Rolle der sozialen Identitätstheorie
- Die Anwendung der Theorie auf studierende Soldaten
- Die Herausforderungen und Besonderheiten der sozialen Identität in diesem Kontext
- Die Bedeutung der Interaktion und des sozialen Umfelds für die Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „soziale Identität“ im Kontext studierender Soldaten der Bundeswehr dar. Sie betont die Komplexität des Identitätsbegriffs und die Bedeutung von Gruppengehörigkeit für die individuelle Entwicklung.
Identität
Dieses Kapitel untersucht den Identitätsbegriff aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven. Es beleuchtet die Ansätze von George Herbert Mead, Erik Homburger Erikson und Erving Goffman, um die Bedeutung von Interaktion und dem sozialen Umfeld für die Identitätsbildung zu verdeutlichen. Das Kapitel schließt mit einer Definition des Identitätsbegriffs von Heinz Abels.
Soziale Identität
Das Kapitel beginnt mit einer kurzen Begriffsklärung der sozialen Identität und skizziert die Entstehungsgeschichte der sozialen Identitätstheorie. Die nächsten Abschnitte beleuchten die Kernpunkte der Theorie: die Kategorisierung, Identifikation, den sozialen Vergleich und die soziale Distinktheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der sozialen Identität und der sozialen Identitätstheorie, insbesondere mit der Anwendung dieser Konzepte auf die Erfahrung studierender Soldaten der Bundeswehr. Schlüsselbegriffe sind: soziale Identität, soziale Identitätstheorie, Kategorisierung, Identifikation, sozialer Vergleich, soziale Distinktheit, Gruppenzugehörigkeit, Identitätsentwicklung, studierende Soldaten, deutsche Bundeswehr.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theorie der sozialen Identität?
Diese Theorie besagt, dass ein Teil des Selbstkonzepts eines Individuums aus der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen resultiert.
Warum erleben studierende Soldaten oft Identitätsunsicherheit?
Sie befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen der militärischen Gruppe (Offizier) und der zivilen Gruppe (Student), was zu undifferenzierten Identitätsempfindungen führen kann.
Was bedeutet "Sozialer Vergleich" in der Identitätstheorie?
Individuen bewerten ihre eigene Gruppe im Vergleich zu anderen Gruppen, um ein positives Selbstbild und soziale Distinktheit zu erreichen.
Welche Rolle spielt die Kategorisierung für die Identität?
Menschen ordnen sich und andere in soziale Kategorien ein (z.B. "Soldat" vs. "Zivilist"), um die soziale Umwelt zu strukturieren und sich selbst zu verorten.
Wie beeinflusst das soziale Umfeld die Subjektwerdung?
Identität entsteht nicht isoliert, sondern durch Interaktion und die Spiegelung in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen.
- Quote paper
- Vanessa Falkenstein (Author), 2011, „Ich bin viele“. Soziale Identität und soziale Identitätstheorie am Beispiel studierender Soldaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180577