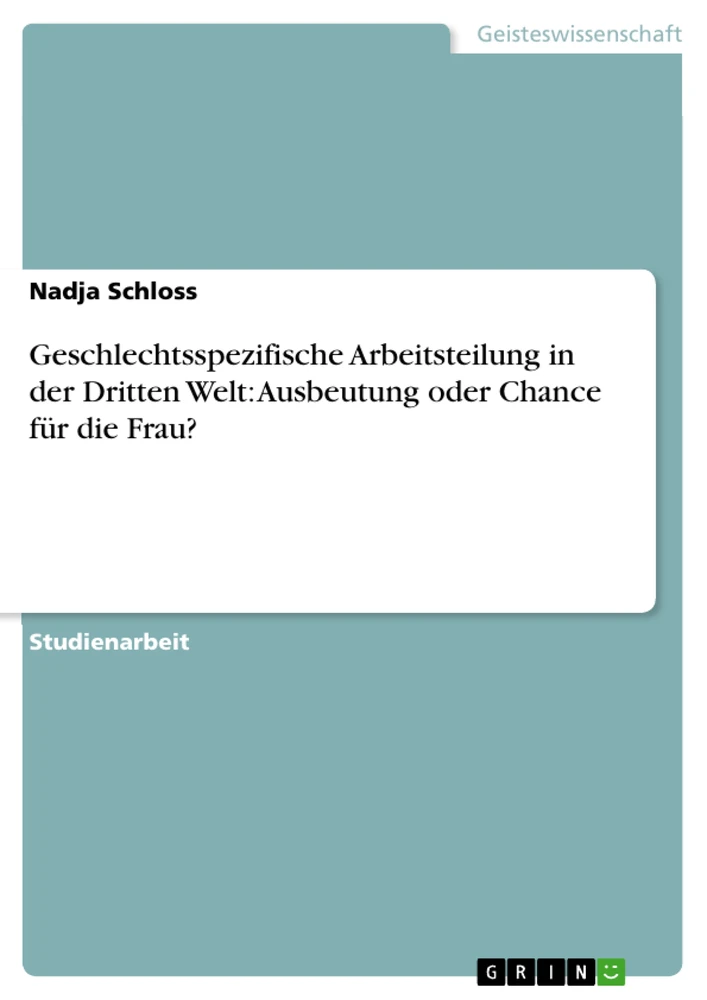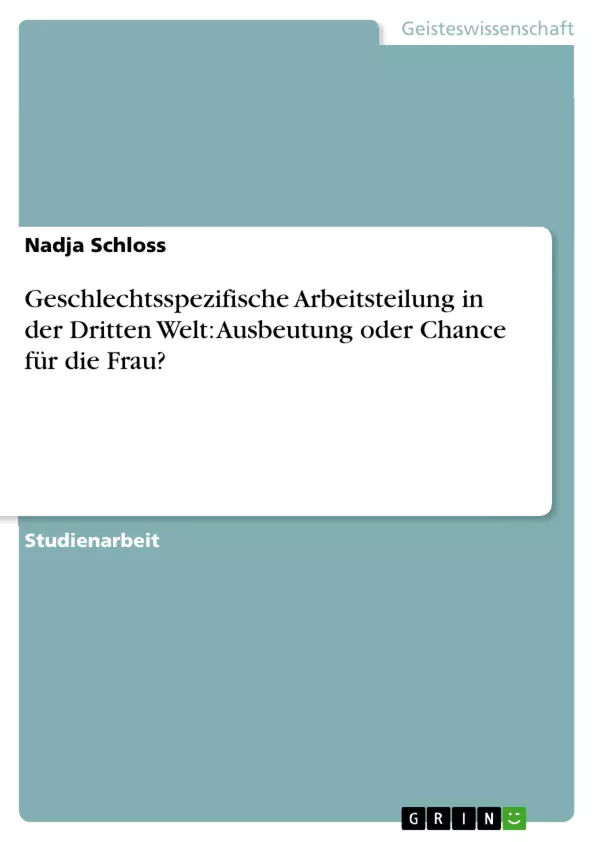Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ist ein aktuelles Thema, welches auch in Europa häufig angesprochen wird und immer wieder zur Diskussion steht. In meiner Arbeit möchte ich jedoch exportorientierte Dritte Weltländer in den Vordergrund stellen, wo oftmals geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen zu beobachten sind und vorwiegend Frauen die Mehrzahl der Arbeitenden in Fabriken ausmachen, wohingegen die leitenden Positionen fast ausschliesslich von Männern eingenommen werden (Dannecker 2001: 231). Diese Länder haben durch die Industrialisierung, Modernisierung und den damit verbundenen, aufkommenden Industriesektor, Zugang zum globalen Markt gefunden (Dannecker 2001: 229).
Die Argumentation meiner Arbeit wird zu einem grossen Teil auf dem Bielefelder Subsistenzansatz aufbauen, welcher die Einbettung der Wirtschaft in Kultur und Gesellschaft nicht als geschlechtsneutral betrachtet. So weist diese Einbettung meist einen klaren geschlechtsspezifischen Charakter auf und wird oft über Geschlechterbeziehungen konstituiert (Lachenmann 2001: 23). Die ökonomischen Transformationsprozesse, welche durch die weltweite Globalisierung stattgefunden haben, basieren in hohem Masse auf dem Einsatz von weiblichen Arbeitskräften. Durch die niedrigen Löhne, welche den Frauen bezahlt werden, bleiben die Produktionskosten tief, und die Produkte finden weltweit Anklang (Lim 1983: 72). Obwohl sich durch die Modernisierung und Industrialisierung neue Arbeitsfelder für die Frauen eröffnet haben, werden diese meist als unqualifiziert angeschaut und besitzen sehr geringe Aufstiegschancen. Trotzdem haben in diesem Zusammenhang viele Frauen Arbeit und den Zugang zum formellen Sektor gefunden. In meiner Arbeit möchte ich deshalb folgende Fragestellung genauer untersuchen und beantworten: ist der Zugang zum formellen Sektor eine Chance für die Frau oder eine Ausbeutung, welche die geschlechtspezifischen Differenzen noch weiter ausdehnt? Um diese Frage zu beantworten, werde ich in einem ersten Teil Begriffe erläutern, welche in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und des Weiteren auf gesellschaftliche Ursprünge eingehen, die dazu geführt haben könnten, dass eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung entstanden ist. Anhand von verschiedenen Beispielen von Fabriken in Bangladesch, Korea und Brasilien werde ich aufzeigen, wie die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen der zwei Geschlechter sind und welche Möglichkeiten den Frauen offen stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Historische Gründe für die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
- Die Aneignung der Natur durch die Menschen
- Kapitalistische Einflüsse
- Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Fabrikarbeiterinnen im Globalisierungsprozess
- Frauen als billige Arbeitskraft
- Veränderungen traditioneller Wertvorstellungen
- Aufstiegschancen
- Weibliche Handlungslogiken
- Ungenutzte Aufstiegschancen
- Entlassungen
- Frauen als billige Arbeitskraft
- Konklusion
- Der Bielefelder Verflechtungsansatz
- Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung: Chance oder Ausnutzung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in exportorientierten Ländern der Dritten Welt, insbesondere im Kontext der Fabrikarbeit. Sie analysiert die Ursachen und Folgen dieser Arbeitsteilung und untersucht, ob sie Frauen eine Chance oder eine Ausbeutung darstellt.
- Die Rolle der Globalisierung und der Industrialisierung bei der Entstehung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung
- Die Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung auf die Lebensbedingungen von Frauen in Fabriken
- Die Bedeutung des Bielefelder Verflechtungsansatzes für die Analyse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
- Die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen von Frauen und Männern in Fabriken
- Die Frage, ob der Zugang zum formellen Sektor eine Chance oder eine Ausbeutung für Frauen darstellt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Kontext der Dritten Welt dar und führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein. Kapitel 2 beleuchtet die unterschiedlichen Bedeutungen von Sex und Gender und zeigt auf, wie diese Begriffe die Analyse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung beeinflussen. Kapitel 3 erörtert die historischen Gründe für die Entstehung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, indem es die Rolle der Aneignung der Natur durch die Menschen sowie der kapitalistischen Einflüsse beleuchtet. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Arbeitsbedingungen von Fabrikarbeiterinnen im Globalisierungsprozess. Es analysiert die Ursachen für die Benachteiligung von Frauen und die Unterschiede in ihren Aufstiegschancen im Vergleich zu Männern. Der Bielefelder Verflechtungsansatz wird in Kapitel 5 als theoretisches Framework vorgestellt und in Bezug zu anderen Theorien gesetzt.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, Dritte Welt, Fabrikarbeit, Globalisierung, Industrialisierung, Bielefelder Verflechtungsansatz, Modernisierungstheorie, Dependenztheorie, Sex, Gender, Frauenrechte, Ausbeutung, Chance, Arbeitsbedingungen, Aufstiegschancen, Produktionskosten, traditionelle Wertvorstellungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum arbeiten in Dritte-Welt-Ländern vorwiegend Frauen in Fabriken?
Frauen werden oft als billige und "fügsame" Arbeitskräfte angesehen. Durch niedrige Löhne für Frauen können Unternehmen die Produktionskosten gering halten und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben.
Was besagt der Bielefelder Subsistenzansatz?
Dieser Ansatz analysiert, dass die Wirtschaft nicht geschlechtsneutral ist, sondern tief in soziokulturelle Geschlechterbeziehungen eingebettet ist, die oft zur Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft führen.
Ist die Fabrikarbeit für Frauen eine Chance oder Ausbeutung?
Die Arbeit untersucht dieses Spannungsfeld: Einerseits bietet sie Zugang zum formellen Sektor und eigenes Einkommen, andererseits sind die Aufstiegschancen minimal und die Bedingungen oft prekär.
Wie unterscheiden sich die Rollen von Männern und Frauen in diesen Fabriken?
Während Frauen die Mehrheit der ausführenden Tätigkeiten übernehmen, sind leitende Positionen fast ausschließlich mit Männern besetzt, was geschlechtsspezifische Hierarchien zementiert.
Welche Länder dienen als Fallbeispiele in der Arbeit?
Die Untersuchung zieht Beispiele aus Fabriken in Bangladesch, Korea und Brasilien heran, um die Auswirkungen der Globalisierung auf Frauen zu verdeutlichen.
- Citation du texte
- Nadja Schloss (Auteur), 2009, Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Dritten Welt: Ausbeutung oder Chance für die Frau?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181093