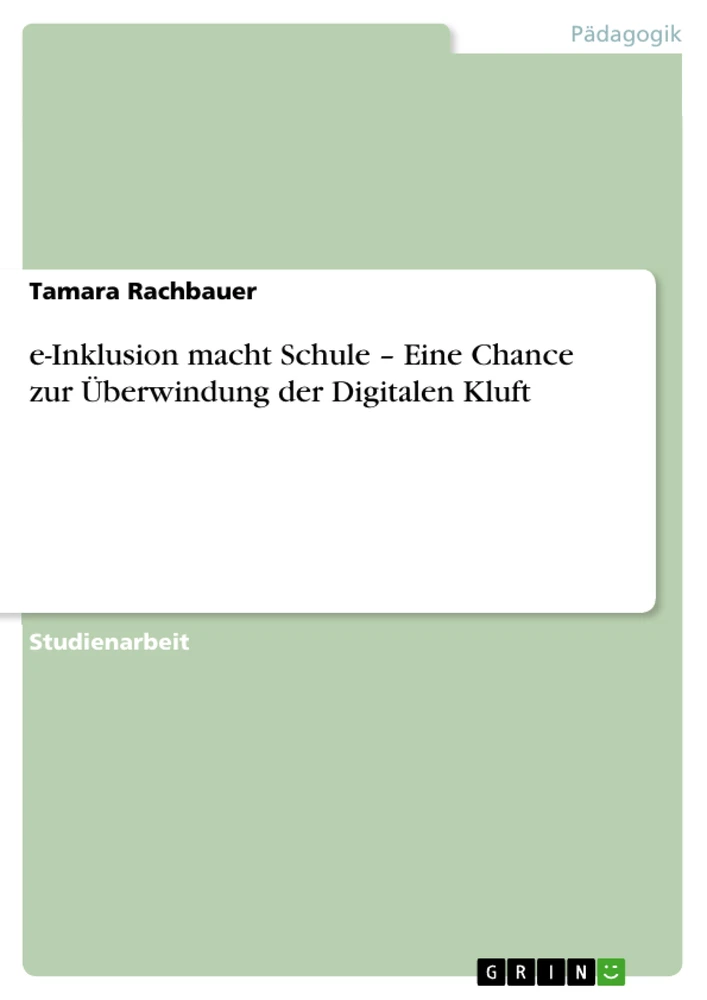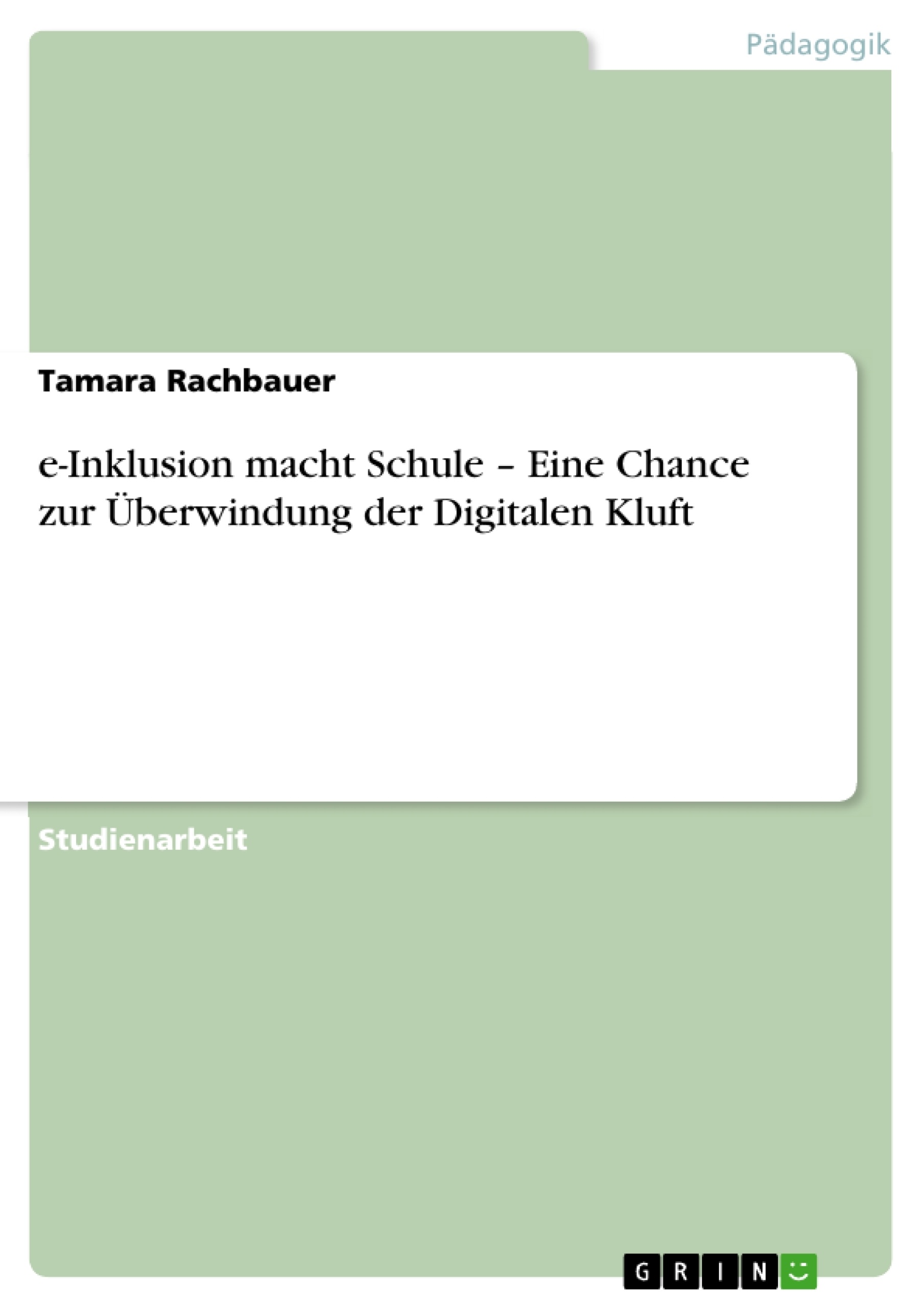In dieser Arbeit wird am Beispiel der Menschen mit Migrationshintergrund aufgezeigt, wie das Konzept der e-Inklusion eingesetzt werden kann, um dieser von der digitalen Ausgrenzung betroffenen Bevölkerungsgruppe die Möglichkeit zu eröffnen, sich aktiv an der Informationsgesellschaft zu beteiligen und so die bereits bestehende Digitale Kluft überwinden zu können. Dazu werden zum einen die soziodemographischen und sozioökonomischen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Behinderung, Migrationshintergrund, Stadt-Land-Zugehörigkeit, Beschäftigung, Einkommen und Bildungsgrad, die zur Entstehung der Digitalen Kluft führen bzw. diese begünstigen können, anhand empirischer Studien zur Internetnutzung genauer betrachtet. Zum anderen wird mit Hilfe der Kapitaltheorie des französischen Kultursoziologen Pierre Bourdieu versucht zu erklären, warum gerade diese Faktoren entscheidenden Einfluss auf die Internetnutzung bzw. Internetnichtnutzung ausüben. Anschließend wird auf den Status Quo der Digitalen Kluft in Deutschland wie auch auf das umfassende Konzept der e-Inklusion und die damit verbundenen, integrationsfördernden Maßnahmen eingegangen. Zum Abschluss werden einige ausgewählte Best-Practice-Beispiele vorgestellt, die diese Maßnahmen bereits erfolgreich umgesetzt haben.
This paper shows how the concept of e-inclusion can be used to help people with an immigrant background get the chance to actively participate in the modern and knowledgebased information society and so to successfully overcome the existing digital divide. For this purpose a closer look is taken on the sociodemographic and socioeconomic variables like urban or rural affiliation, migration background, age, gender, physical or psychical handicaps, employment and income and education levels using empirical studies because these variables have a strong influence not only on the formation but also on the intensification of the digital divide. In order to explain this strong influence the capital theory of French sociologist Pierre Bourdieu is used. Another part of this paper deals with the status quo of the digital divide in Germany as well as with the concept of e-inclusion and the associated target-group-oriented measures and initiatives supporting integration. The last part presents some best practice examples that aim to prevent isolation and social exclusion by not only providing access to modern communi-cation technologies but also by enabling people to use these technologies to their personal benefit.
Inhaltsverzeichnis
- e-Inklusion macht Schule – Eine Chance zur Überwindung der Digitalen Kluft
- Einführung, Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Die „Digitale Kluft“ als gesellschaftliches Phänomen unserer Zeit
- Digitale Kluft - Begriffserklärung und Einführung
- Ursachen bzw. Faktoren für die Entstehung der Digitalen Kluft und deren Auswirkungen
- Die Kapitaltheorie des französischen Kultursoziologen Pierre Bourdieu und das Phänomen der Digitalen Kluft
- Die Kapitaltheorie Bourdieus als Modell zur Erklärung sozialer Ungleichheiten in unserer Gesellschaft
- Zusammenhänge zwischen ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital, sozialen und digitalen Ungleichheiten und der Digitalen Kluft
- Digitale Kluft und Migrationshintergrund Der Status Quo in Deutschland
- Internetnutzung nach Migrationshintergrund und den weiteren die Digitale Kluft beeinflussenden Faktoren
- Fazit aus den Studienergebnissen
- Das umfassende Konzept der e-Inklusion als Chance zur Überwindung der Digitalen Kluft
- e-Inklusion - Begriffserklärung und Einführung
- Überwindung der Digitalen Kluft durch integrationsfördernde Maßnahmen und die dabei zu berücksichtigenden Anforderungen
- Schritt 1 - Schaffen der erforderlichen Rahmenbedingungen
- Schritt 2 Anbieten von Möglichkeiten zum Erwerb der notwendigen Kompetenzen
- Schritt 3 - Bereitstellen zielgruppenrelevanter Inhalte
- Best-Practice-Beispiele - Projekte zur Förderung der digitalen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
- Das Projekt ,,Refugees Emancipation“
- Das Projekt ,,Integration@Partizipation“
- Das Projekt „,buerger-gehen-online“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Auswirkungen der Digitalen Kluft auf Menschen mit Migrationshintergrund und erörtert, wie das Konzept der e-Inklusion zur Überwindung dieser Kluft beitragen kann. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen der digitalen Integration zu entwickeln und konkrete Maßnahmen zur Förderung der digitalen Teilhabe zu identifizieren.
- Die Entstehung und Auswirkungen der Digitalen Kluft
- Die Rolle von sozio-demographischen und sozio-ökonomischen Faktoren
- Die Kapitaltheorie Bourdieus als Erklärungsmodell für soziale Ungleichheiten
- Der Status Quo der Digitalen Kluft in Deutschland
- Das Konzept der e-Inklusion und seine integrationsfördernden Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Thematik der Digitalen Kluft und ihren Einfluss auf Menschen mit Migrationshintergrund vor. Dabei wird die Problematik der digitalen Ausgrenzung in den Fokus gerückt und die Bedeutung von e-Inklusion als Lösungsansatz beleuchtet. Kapitel zwei beleuchtet die Ursachen der Digitalen Kluft und analysiert die Rolle verschiedener Faktoren, die zur Entstehung und Perpetuierung der Kluft beitragen. Kapitel drei untersucht die Kapitaltheorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu und ihre Relevanz für die Erklärung sozialer Ungleichheiten und der Digitalen Kluft. Im vierten Kapitel wird der Status Quo der Digitalen Kluft in Deutschland mit einem besonderen Fokus auf Menschen mit Migrationshintergrund untersucht. Kapitel fünf befasst sich mit dem Konzept der e-Inklusion und seinen vielversprechenden Möglichkeiten zur Überwindung der Digitalen Kluft. Das Kapitel erläutert verschiedene integrationsfördernde Maßnahmen und präsentiert Best-Practice-Beispiele für erfolgreiche Projekte zur Förderung der digitalen Integration.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind e-Inklusion, Digitale Kluft, digitale Integration, Menschen mit Migrationshintergrund, Kapitaltheorie, Pierre Bourdieu, sozio-demographische Faktoren, sozio-ökonomische Faktoren, Best-Practice-Beispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „Digitalen Kluft“?
Die digitale Kluft beschreibt die soziale Ungleichheit beim Zugang zu und der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, oft beeinflusst durch Bildung, Einkommen und Herkunft.
Wie hilft das Konzept der e-Inklusion Menschen mit Migrationshintergrund?
e-Inklusion zielt darauf ab, digitale Barrieren abzubauen, Kompetenzen zu vermitteln und zielgruppenrelevante Inhalte bereitzustellen, um die aktive Teilhabe an der Informationsgesellschaft zu fördern.
Welche Rolle spielt Bourdieus Kapitaltheorie für die digitale Integration?
Bourdieu erklärt, dass ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital bestimmen, wie effektiv Individuen das Internet nutzen können. Fehlendes Kapital führt oft zu digitaler Ausgrenzung.
Was sind Best-Practice-Beispiele für digitale Inklusion?
Projekte wie „Refugees Emancipation“ oder „Integration@Partizipation“ zeigen, wie durch gezielten Zugang und Schulungen die digitale Teilhabe von Migranten erfolgreich umgesetzt werden kann.
Welche Faktoren begünstigen die digitale Ausgrenzung in Deutschland?
Wesentliche Faktoren sind ein niedriger Bildungsgrad, geringes Einkommen, höheres Alter sowie sprachliche Barrieren bei Menschen mit Migrationshintergrund.
- Citation du texte
- BSc Tamara Rachbauer (Auteur), 2011, e-Inklusion macht Schule – Eine Chance zur Überwindung der Digitalen Kluft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182545