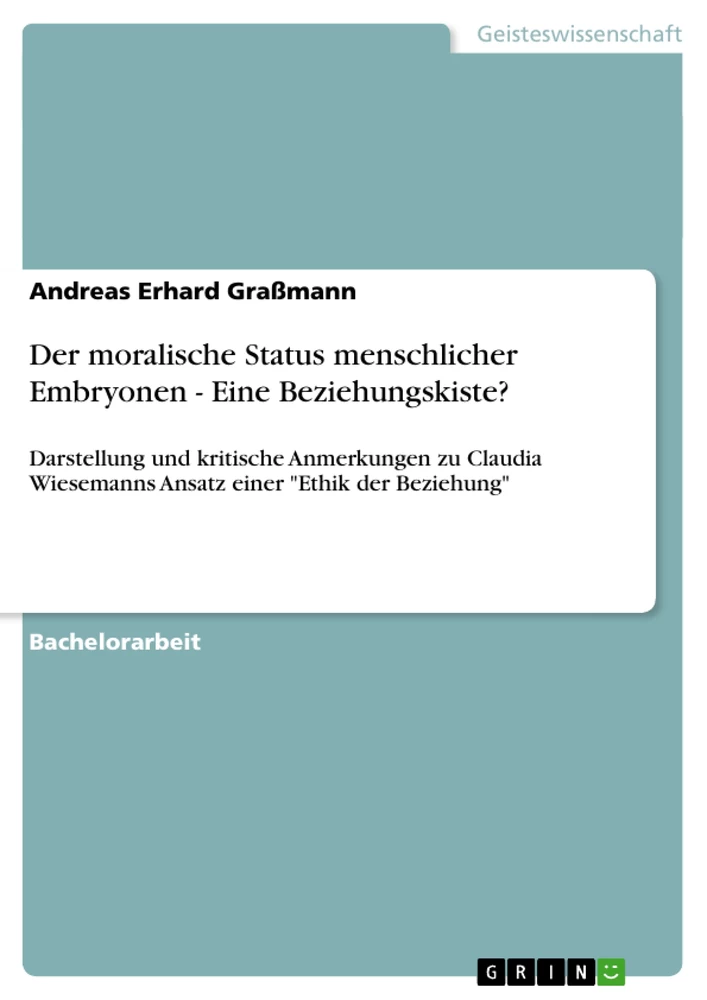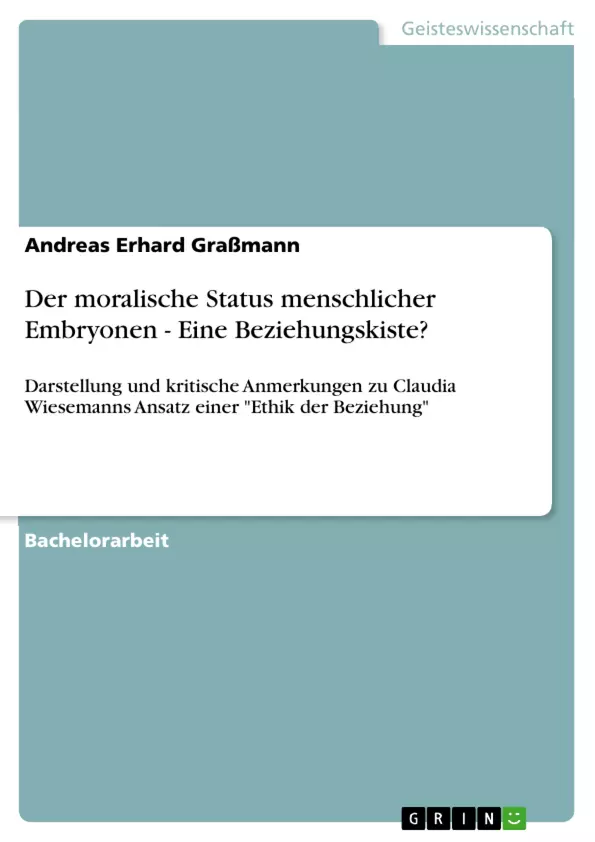Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll gezielt auf einen Ansatz in der Diskussion um die embryonale Statusfrage eingegangen werden. CLAUDIA WIESEMANN legte mit ihrem 2006 publizierten Werk VON DER VERANTWORTUNG EIN KIND ZU BEKOMMEN. EINE ETHIK DER ELTERNSCHAFT eine Arbeit vor, die „sich mit ethischen Konflikten in der Schwangerschaft und bei der künstlichen Befruchtung [befasst]. Diese heiß diskutierten und höchst umstrittenen Themen, so Wiesemann, reichen in gewisser Weise in das Leben von uns allen herein. Niemand kann sagen, diese Themen würden im luftleeren Raum verortet sein. Es stellt sich die Frage, ob „wir den menschlichen Embryo wie jeden anderen Bürger unseres Gemeinwesens behandeln sollen. Stehen ihm von der Befruchtung an die gleichen Rechte zu wie geborenen Menschen? Ist der Begriff der Menschenwürde unserer Verfassung auf den Embryo anwendbar?“
Wiesemann möchte sich mit ihrem Ansatz von den großen moralphilosophischen Denktraditionen der Aufklärung lösen und verlangt eine „leibliche Wende in der Medizinethik“ .
So beschreibt Wiesemann die Intention ihrer Veröffentlichung mit den Worten:
„In diesem Buch geht es um das ursprünglichste der fundamentalen Lebensverhältnisse, die Elternschaft, sowie insbesondere um die Beziehung zwischen Mutter und Kind und ihre moralische Dimension aus der Perspektive einer Ethik der Beziehung und Verantwortung.“
Diese Ethik der Beziehung und Verantwortung und der damit verbundene Versuch, einen Lösungsansatz für die Statusdebatte in Bezug auf ungeborenes menschliches Leben vorzulegen, soll in dieser Arbeit analysiert und kommentiert werden.
Zu diesem Zweck wird in einem ersten Hauptteil zuerst die Grundfrage definiert, auf die der Wiesemannsche Ansatz eine Lösungsoption zu sein versucht. Die beiden klassischen Argumentationslinien des absoluten und des abgestuften Lebensschutzes sollen kurz erläutert werden, um die Basis für die Überlegungen von Claudia Wiesemann zu schaffen. Im zweiten Hauptteil soll die Argumentationslinie des Diskussionsbeitrags von Wiesemann herausgearbeitet werden. Abschließend möchte ich versuchen, in einem dritten und letzten Hauptteil der Arbeit noch einige kritische Überlegungen zu den Schlussfolgerungen und Forderungen anzustellen. So soll auf Stärken und Schwächen des behandelten Lösungsansatzes aufmerksam gemacht und dabei seine Relevanz für die aktuelle medizinethische Debatte aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Grundfrage: der moralische Status des menschlichen Embryos
- 1.1. Lösungsansätze
- 1.2. Nicht gradualistische Position/„absoluter“ Lebensschutz
- 1.3. Gradualistische Position/“abgestufter“ Lebensschutz
- 2. Claudia Wiesemanns Beitrag zur Diskussion um den moralischen Status menschlicher Embryonen
- 2.1. Der moralische Status des Embryos und die Eltern-Kind-Beziehung
- 2.1.1. Position des absoluten Lebensschutzes
- 2.1.2. Position des abgestuften Lebensschutzes
- 2.2. Der leibliche und soziale Kontext des Embryos
- 2.3. Die Ethik des Fremden
- 2.4. Der Begriff des menschlichen Individuums
- 2.5. Die Geburt als leiblicher und sozialer Einschnitt
- 2.6. Elternschaft
- 2.6.1. Verantwortung
- 2.6.2. Das Modell des antizipierten Konsenses
- 2.7. Aufgegebene und nicht gelebte Beziehungen
- 2.7.1. In-vitro-Fertilisation
- 2.7.2. Selektiver Fetozid
- 2.7.3. Embryonenspende
- 2.7.4. Schwangerschaftsabbruch
- 2.1. Der moralische Status des Embryos und die Eltern-Kind-Beziehung
- 3. Kritische Anmerkungen zu Claudia Wiesemanns Entwurf einer „Ethik der Beziehung“
- 3.1. Terminologie
- 3.2. Verborgene Wertungen - fehlende Argumentation
- 3.3. Konsequenzen des „beziehungsethischen Ansatzes“
- 3.4. Sein-Sollen-Problem
- 3.5. Elternschaft, Beziehung und Verantwortung
- 4. Abschlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert Claudia Wiesemanns Ansatz einer „Ethik der Beziehung“ im Kontext der Debatte um den moralischen Status menschlicher Embryonen. Ziel ist die kritische Auseinandersetzung mit Wiesemanns Argumentation und die Bewertung ihrer Relevanz für die aktuelle medizinethische Diskussion.
- Der moralische Status des menschlichen Embryos
- Absolute und abgestufte Lebensschutzpositionen
- Wiesemanns „Ethik der Beziehung“ und die Eltern-Kind-Beziehung
- Der leibliche und soziale Kontext des Embryos
- Kritische Bewertung von Wiesemanns Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Debatte um den moralischen Status des Embryos ein und skizziert die verschiedenen Positionen. Kapitel 1 definiert die Grundfrage und erläutert die Positionen des absoluten und abgestuften Lebensschutzes. Kapitel 2 stellt Wiesemanns „Ethik der Beziehung“ vor, die den moralischen Status des Embryos im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung und des leiblichen und sozialen Kontextes diskutiert. Die Kapitel 2.6 und 2.7 beleuchten Aspekte der Elternschaft und verschiedene ethische Konflikte (In-vitro-Fertilisation, Embryonenspende etc.) im Kontext von Wiesemanns Ansatz. Kapitel 3 beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit Wiesemanns Argumentation.
Schlüsselwörter
Moralischer Status, menschlicher Embryo, Ethik der Beziehung, Elternschaft, Lebensschutz, absoluter Lebensschutz, abgestufter Lebensschutz, In-vitro-Fertilisation, Embryonenspende, Schwangerschaftsabbruch, medizinethische Debatte, kritische Analyse.
- Arbeit zitieren
- Andreas Erhard Graßmann (Autor:in), 2011, Der moralische Status menschlicher Embryonen - Eine Beziehungskiste?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183051