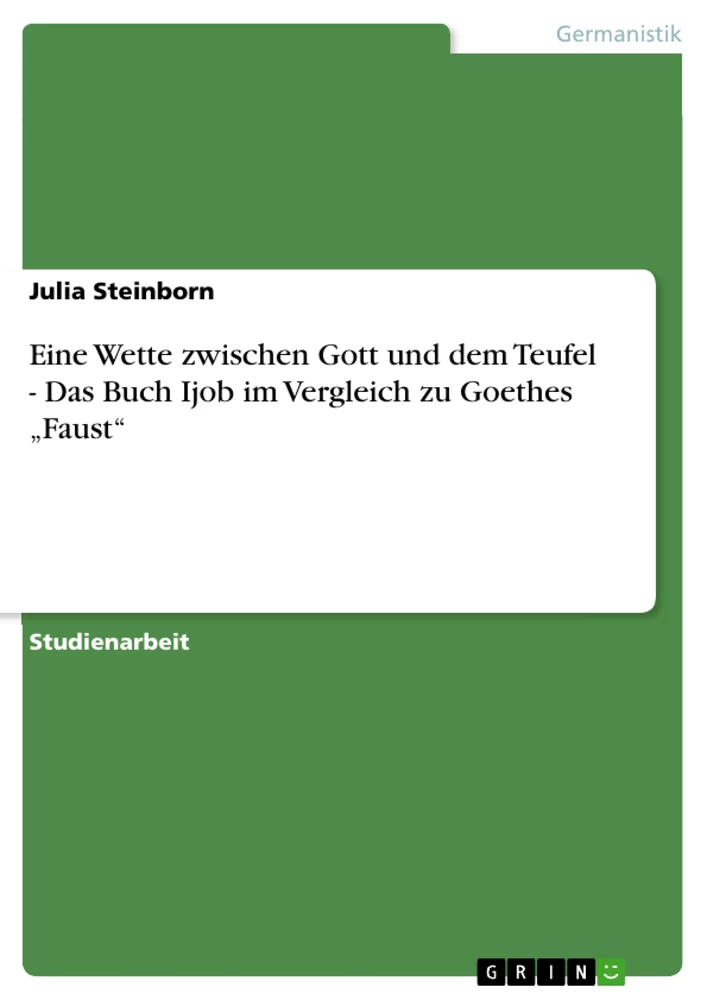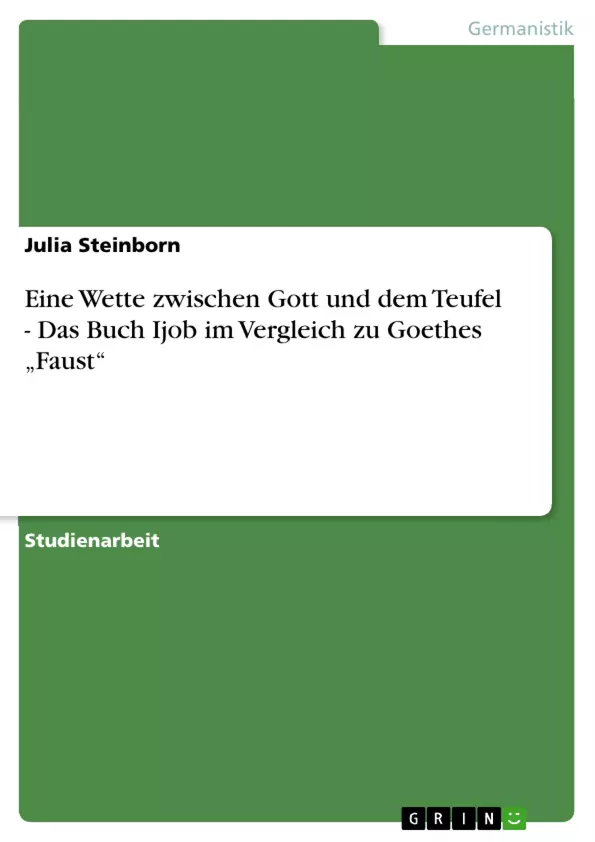Die Geschichte um Doktor Faust gehört zu den ältesten Erzählungen der deutschen Literatur und wurde im Gegensatz zu vielen anderen bekannten Sagen und Erzählun-gen in vielfältigster Weise abgedruckt und neu geschrieben.
Die „Historia des D. Johann Fausten“ von 1587 ist die älteste schriftliche Überliefe-rung des Faust-Kontextes, die uns heute vorliegt. Goethes „Faust. Eine Tragödie“ hingegen das bekannteste neuzeitliche Werk, das eine umfangreiche Neubearbeitung des Stoffes aufweist. Besonders auffällig, gerade bei Betrachtung des zweiten Teils, ist die beachtliche Menge an historischen-, mythologischen- und religiösen Motiven, die zu einigen Teilen aus der „Historia“ übernommen wurden. „Für den ‚Prolog im Himmel’ findet sich dagegen in früheren Faust-Texten kein Vorbild.“ Gerade in diesem Teil lässt sich eine große Anbindung an das „Buch Ijob“ des Alten Testamentes finden, das Bestandteil meiner Untersuchung sein soll. Goethe greift hierbei die ‚Wette’ zwischen dem Teufel (Satan) und Gott auf und überträgt sie als Rahmen-handlung seines Fausttextes in den „Prolog im Himmel“.
Diese Arbeit soll die Frage klären, was Goethe aus dem Buch Ijob übernommen hat, in welcher Form er das tat und welche Unterschiede es in der Verwendung des Grundgedankens der Wette gibt. Im Laufe meiner Arbeit werde ich demnach die beiden Texte (Goethes „Faust“ und das „Buch Ijob“) im Bezug auf Inhalt, Personen-konstellation und Übertragung von bestimmten Elementen vergleichen.
1 Einleitung ....................................... 2
2 Das „Buch Ijob“ und Goethes „Faust“ .............. 3
2.1 Personenvergleiche und Übertragungen ... 3
2.1.1 Mephistopheles/Satan ......... 3
2.1.2 Faust/Ijob ................... 6
2.1.3 Der Herr und die Engel ....... 9
2.2 Ablauf und Ausgang der Wetten .......... 10
3 Schlusswort ...................................... 15
4 Quellen .......................................... 17
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das „Buch Ijob“ und Goethes „Faust“
- Personenvergleiche und Übertragungen
- Mephistopheles/Satan
- Faust/Ijob
- Der Herr und die Engel
- Ablauf und Ausgang der Wetten
- Personenvergleiche und Übertragungen
- Schlusswort
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes „Faust“ im Kontext des „Buches Ijob“. Ziel ist es, Goethes Übernahme von Elementen aus dem „Buch Ijob“, deren Form und die Unterschiede in der Verwendung des Grundgedankens der Wette zu klären. Der Vergleich konzentriert sich auf Inhalt, Personenkonstellation und die Übertragung spezifischer Elemente beider Texte.
- Vergleich der Figuren Mephistopheles und Satan
- Analyse der Parallelen zwischen Faust und Ijob
- Untersuchung der Wette als zentrales Motiv in beiden Werken
- Vergleich der Darstellung Gottes in beiden Texten
- Analyse der Unterschiede in der Verwendung des Grundgedankens der Wette
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Bedeutung von Goethes „Faust“ und dem „Buch Ijob“. Kapitel 2 vergleicht beide Werke, insbesondere die Figuren Mephistopheles und Satan, Faust und Ijob, sowie die Darstellung des Herrn und seiner Engel. Es werden Parallelen und Unterschiede in der Personenkonstellation und der Übertragung von Elementen herausgearbeitet. Das Kapitel endet mit einer Betrachtung des Ablaufs und des Ausgangs der Wetten in beiden Texten.
Schlüsselwörter
Goethes Faust, Buch Ijob, Wette, Mephistopheles, Satan, Faust, Ijob, Gott, Teufel, Vergleichende Literaturwissenschaft, Religiöse Motive, Mythologische Motive.
- Quote paper
- Julia Steinborn (Author), 2010, Eine Wette zwischen Gott und dem Teufel - Das Buch Ijob im Vergleich zu Goethes „Faust“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183116