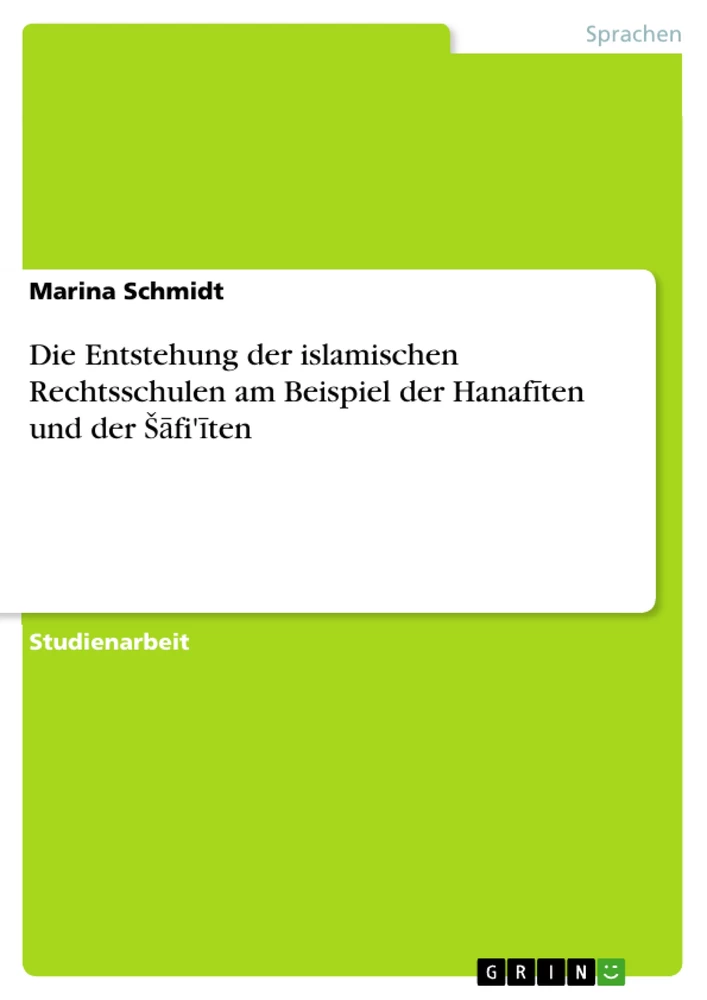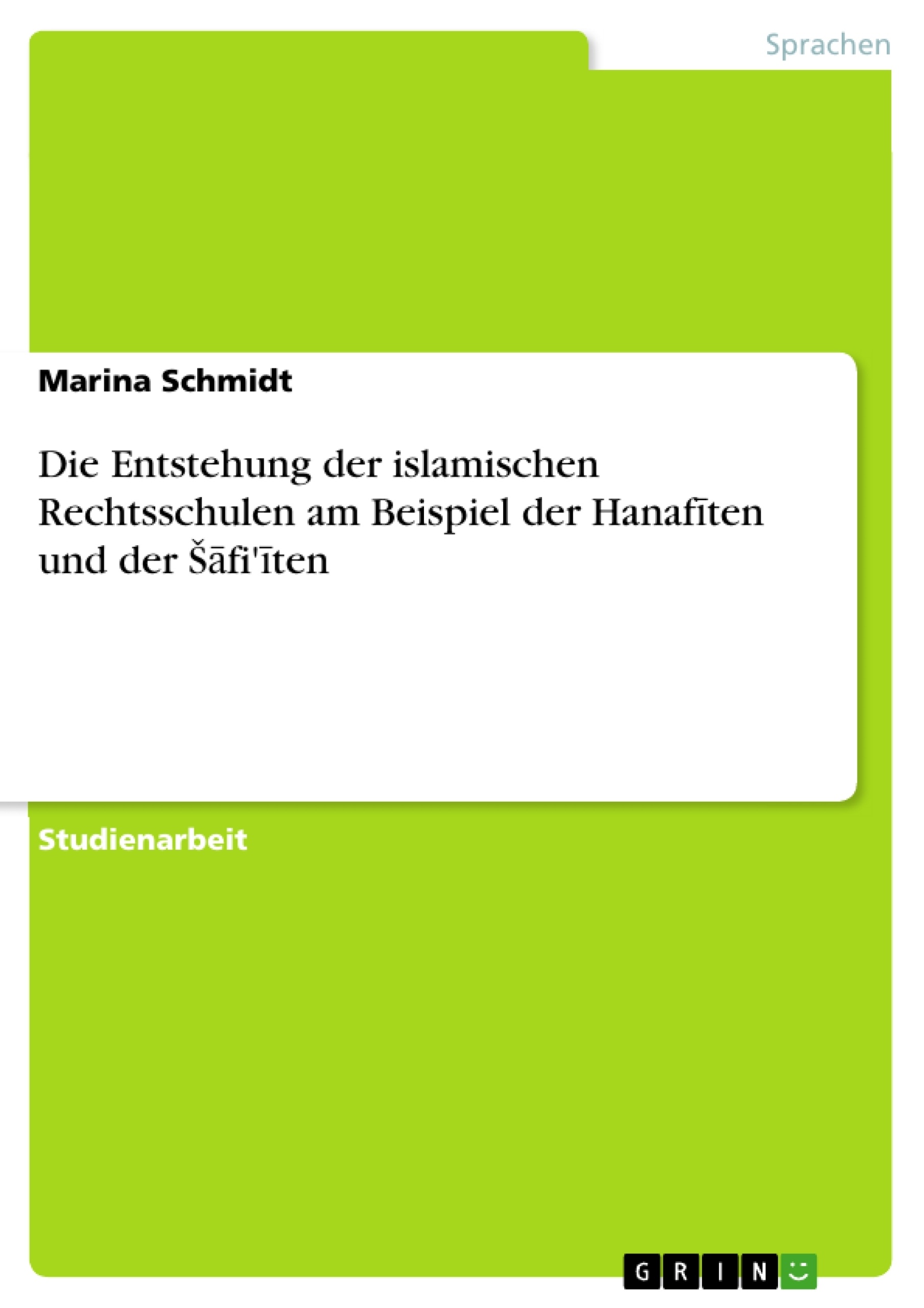Die Entstehung der vier anerkannten sunnitisch-islamischen Rechtsschulen, der
Hanafīten, Mālikīten, Hanbalīten und Šāfi'īten, ist in vielerlei Hinsicht bedeutend für
die Geschichte als auch die Gegenwart des Nahen Ostens. Daher soll sie in dieser
Arbeit nachgezeichnet werden, indem ich exemplarisch die Ausprägung der beiden
größten Rechtsschulen, der hanafītischen und der šafi‘ītischen, herausgreife und
chronologisch darstelle. Ich werde mich hierfür vor allem auf die Zeit zwischen dem
2./8. und dem 5./11. Jh. konzentrieren.
Die Darstellung, die in dieser Arbeit erfolgen wird, kann grob in zwei
Themengebiete unterteilt werden: Einerseits möchte ich mich mit den beiden oben
genannten Schulen im Speziellen befassen, andererseits möchte ich mich, basierend
auf der entstehenden Abhandlung, auch mit Fragen der Rechts- und der
Wissensüberlieferung allgemein auseinandersetzen. So soll die vorliegende Arbeit
auch eine Einführung in die Vielfalt der Publikationen leisten, die im Rahmen der
frühen islamischen Geschichtswissenschaft entstanden sind und die eine immense
Bedeutung und Nutzbarkeit bis zum heutigen Tage bieten. Auch die Biografien der
als Gründer bekannt gewordenen Rechtsgelehrten Abū Hanīfa und Imām aš-Šāfi'ī
werden Beachtung finden. Dabei möchte ich unter anderem der Frage
nachgehen, welchen Einfluss diese Persönlichkeiten sowohl auf die Entwicklung der
Rechtsschulen als auch auf die islamische Jurisprudenz allgemein hatten. Neben
einer Begriffs- und Namenserklärung sowie einer Gegenüberstellung beider Schulen
soll also dargelegt werden, welche Methoden der Überlieferung und Auslegung zur
Zeit der Entstehung der Rechtsschulen vorherrschten.
Letztendlich existieren zu diesem Themengebiet wissenschaftliche Quellen
unterschiedlichster Herangehensweisen, von denen ich hoffe, dass ich in meiner
Arbeit einige ihrer Facetten nutzen kann. Ich stütze mich zwar hauptsächlich auf
Werke, die aufgrund von Quellenlektüre die Ursprünge der islamischen Jurisprudenz
und ihrer Schulen ergründen wollen; zu beachten sind im allgemeinen
Zusammenhang aber ebenso Werke, deren Autoren sich kritisch mit den Quellen und Methoden islamischer Jurisprudenz auseinandersetzen. Zu nennen wäre hier allen
voran Joseph Schacht.
Als dritten Pfeiler der Quellenliteratur stütze ich mich auf arabische Texte, die von
Biografen bzw. Historiographen verfasst wurden und Aufschluss über die
Lebensumstände der frühislamischen Zeit und die Ausbreitung der Schulen geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung: Frühislamische Geschichtswerke als Quellen heutiger Erkenntnis
- Ṭabaqāt
- Kontroverse Herangehensweise der „westlichen“ Forschung
- Islamisches Recht im 2./8. und 3./9. Jahrhundert
- Kontroversen zwischen den Gelehrten
- Abū Hanifa
- Aš-Šāfiī
- Islamisches Recht ab dem 4./10. Jahrhundert
- Die Herausbildung der ḥanafītischen Schule
- Die Herausbildung der šāfi'ītischen Schule
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt die Zielsetzung, die Entstehung der sunnitisch-islamischen Rechtsschulen, exemplarisch anhand der Hanafiten und Šāfi'īten, chronologisch nachzuzeichnen und die Entwicklung zwischen dem 2./8. und dem 5./11. Jahrhundert zu beleuchten. Neben der spezifischen Betrachtung der beiden Rechtsschulen wird auch die allgemeine Rechts- und Wissensüberlieferung im frühen Islam thematisiert.
- Entstehung und Entwicklung der hanafiitischen und šāfi'ītischen Rechtsschulen
- Frühislamische Geschichtswerke als Quellen der Rechtsgeschichte
- Biografien der Rechtsgelehrten Abū Hanifa und aš-Šāfi'ī
- Methoden der Rechtsüberlieferung und -auslegung
- Einfluss bedeutender Persönlichkeiten auf die Entwicklung der Rechtsschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Bedeutung der vier sunnitischen Rechtsschulen und die Fokussierung der Arbeit auf die Hanafiten und Šāfi'īten. Die Einführung behandelt frühislamische Geschichtswerke, insbesondere Ṭabaqāt, und die unterschiedlichen Forschungsansätze. Kapitel 3 beleuchtet das islamische Recht im 2./8. und 3./9. Jahrhundert, inklusive der Kontroversen zwischen Gelehrten und biografischen Aspekten von Abū Hanifa und aš-Šāfi'ī. Kapitel 4 behandelt die Herausbildung der hanafiitischen und šāfi'ītischen Schulen ab dem 4./10. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Sunnitische Rechtsschulen, Hanafiten, Šāfi'īten, Frühislamisches Recht, Ṭabaqāt, Abū Hanifa, aš-Šāfi'ī, Rechtsüberlieferung, Jurisprudenz, Historiographie, Isnad, Hadīth.
- Citar trabajo
- Marina Schmidt (Autor), 2010, Die Entstehung der islamischen Rechtsschulen am Beispiel der Hanafīten und der Šāfi'īten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183256