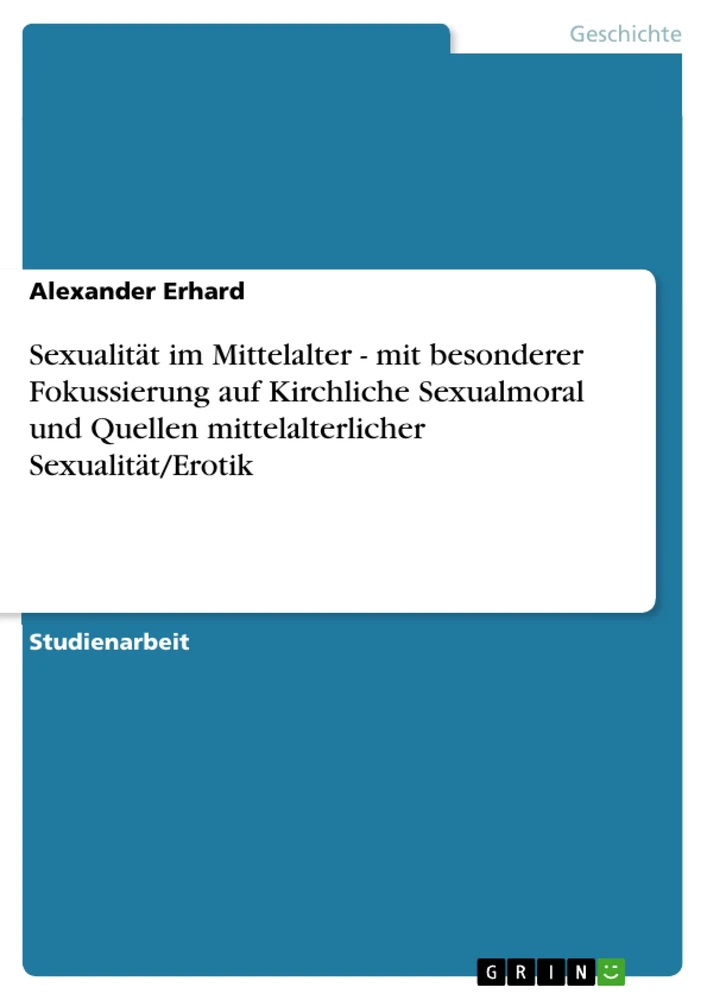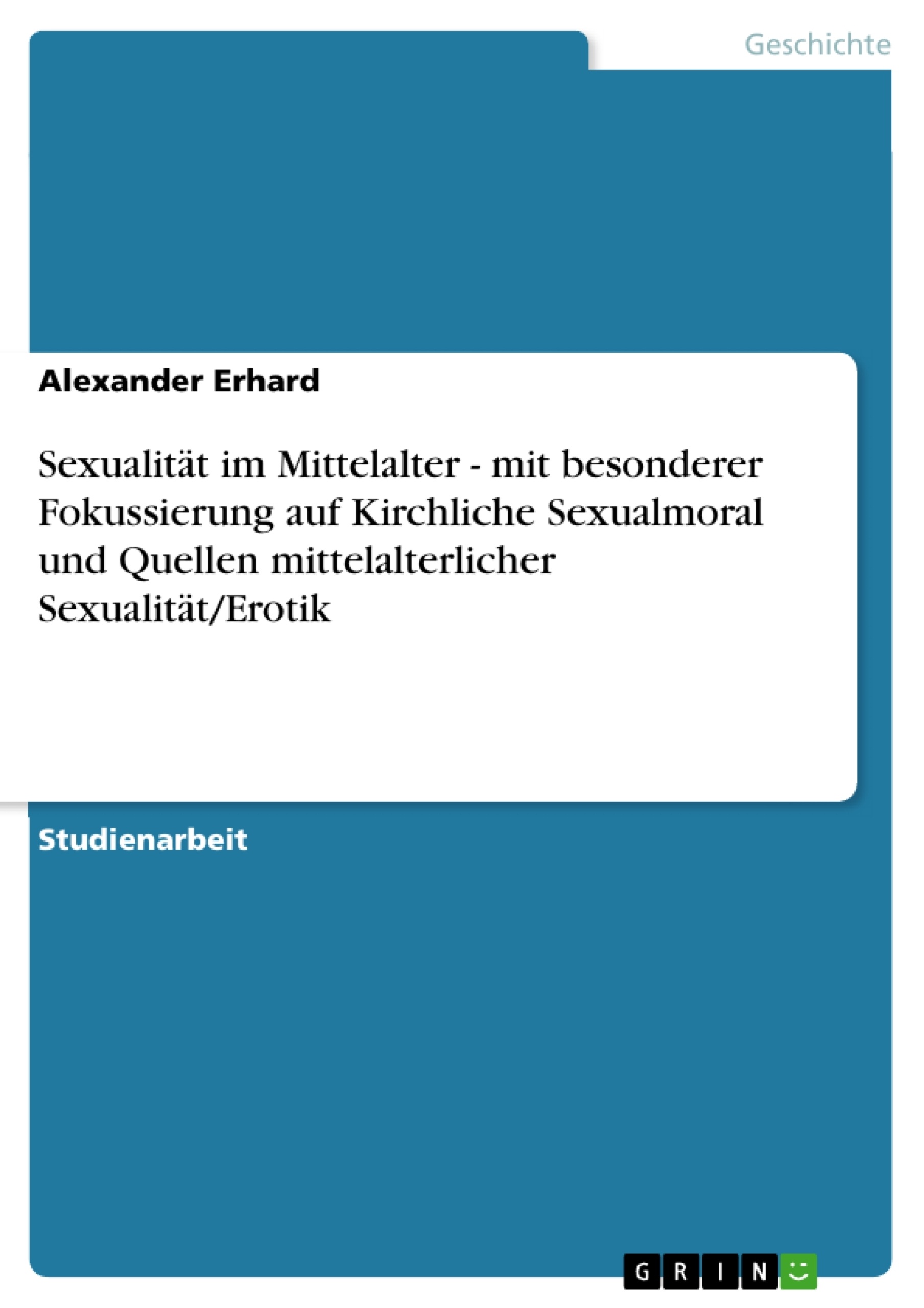In dieser Arbeit werde ich verstärkt auf die Sexualethik der
christlichen Kirche eingehen und mögliche Quellen dazu erörtern und interpretieren. Diese Arbeit
sollte einen kleinen Überblick über die damalige Einstellung zum Sexualtrieb des Menschen geben
und ihn in ein zeitliches Korsett schnüren. Ich hoffe, dass mir dies gelungen ist und auch die
zitierten Quellen einen besseren Gesamteindruck generieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sexualität im Mittelalter – eine kurze Zusammenfassung
- 2.1 Der Kirchlicher Grundstandpunkt zum Thema „Geschlechtsverkehr“ im Mittelalter
- 2.2 Kirchliche Sexualmoral
- 3 Quellen zu „Sex im Mittelalter“
- 3.1 Bußbücher
- 3.2 Briefe
- 3.3 Minnedichtung und Fabilaux
- 3.4 leges barboarorum und Lex Baiuvariorum
- 3.5 Gerichts- und Inquisitionsprotokolle
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Sexualität im Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung der kirchlichen Sexualmoral und der verfügbaren Quellen. Ziel ist es, einen Überblick über die damaligen Einstellungen zum Sexualtrieb zu geben und diesen in den historischen Kontext einzuordnen.
- Kirchliche Sexualmoral im Mittelalter
- Quellen zur mittelalterlichen Sexualität (Bußbücher, Briefe, Literatur)
- Ehe und Sexualität als gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren
- Das Spannungsfeld zwischen kirchlicher Lehre und gelebter Praxis
- Verhältnis von Sexualität und Macht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Sexualität im Mittelalter“ ein und skizziert den Fokus der Arbeit auf die kirchliche Sexualmoral und die Interpretation relevanter Quellen. Sie deutet die Herausforderungen an, die sich aus der stiefmütterlichen Behandlung des Themas in der Geschichtsschreibung ergeben und begründet die Auswahl eines mittelalterlichen Briefes als Ausgangspunkt der Untersuchung.
2 Sexualität im Mittelalter – eine kurze Zusammenfassung: Dieses Kapitel bietet einen ersten Überblick über die mittelalterliche Sexualität. Es wird der Gegensatz zwischen der modernen Auffassung von Ehe als Liebesbeziehung und der mittelalterlichen, pragmatischeren Sichtweise auf Ehe und Sexualität als Mittel zum Zweck (wirtschaftliche Versorgung, Fortpflanzung) herausgestellt. Die Dominanz der katholischen Kirche und deren Einfluss auf die Quellenlage wird hervorgehoben, wodurch ein verzerrtes Bild des gelebten Sexualalltags entsteht. Die Ehe wird als der einzige legitime Rahmen für Sexualität präsentiert, außereheliche Beziehungen hingegen als Tabu.
2.1 Der Kirchlicher Grundstandpunkt zum Thema „Geschlechtsverkehr“ im Mittelalter: Dieses Unterkapitel erläutert den christlichen Grundstandpunkt zum Thema Sexualität, welcher von einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber sinnlichen Freuden geprägt ist. Die Sexualität wird in erster Linie auf die Reproduktion reduziert, außerehelicher Geschlechtsverkehr als Sünde betrachtet. Auch innerhalb der Ehe wird Sex nur zur Fortpflanzung und zur Erfüllung ehelicher Pflichten toleriert. Das Konzept des „paulinischen Debitum“ wird eingeführt und mit Zitaten aus der Bibel und Kommentaren von Kirchenvertretern belegt. Die Unterdrückung des sexuellen Vergnügens wird als ein zentrales Element der christlichen Moral dargestellt.
2.2 Kirchliche Sexualmoral: Dieses Unterkapitel geht auf verschiedene Aspekte der kirchlichen Sexualmoral im Mittelalter ein und beleuchtet die strengen Regeln und Vorschriften für den ehelichen Geschlechtsverkehr, die durch die Kirche formuliert wurden, um illegitime sexuelle Aktivitäten zu unterbinden. Es wird deutlich gemacht, dass die Kirche durch genaue Anweisungen versuchte, den "legitimen" Sexualverkehr von Sünde zu trennen. Die ausführlichen Anweisungen zeigen die ambivalente Haltung der Kirche gegenüber Sexualität: Verurteilung und gleichzeitig Regulierung.
3 Quellen zu „Sex im Mittelalter“: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Quellenkategorien, die Informationen über die mittelalterliche Sexualität liefern. Es wird die Bedeutung von Bußbüchern, Briefen, Minnedichtung, Rechtstexten (leges barboarorum und Lex Baiuvariorum) und Gerichts- und Inquisitionsprotokollen erörtert, jeweils unter Bezugnahme auf deren spezifischen Beitrag zum Verständnis der damaligen Sexualität und deren Grenzen. Jede Quelle wird als ein Stück eines komplexen Puzzles vorgestellt, das das Bild der mittelalterlichen Sexualität vervollständigt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Sexualität im Mittelalter"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sexualität im Mittelalter. Der Fokus liegt auf der kirchlichen Sexualmoral und der Interpretation verschiedener historischer Quellen, um ein umfassenderes Bild der damaligen Einstellungen zum Sexualtrieb zu vermitteln und diesen in den historischen Kontext einzuordnen.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf eine Vielzahl von Quellen, um die mittelalterliche Sexualität zu beleuchten. Dazu gehören Bußbücher, Briefe, Minnedichtung und Fabilaux, leges barboarorum und Lex Baiuvariorum sowie Gerichts- und Inquisitionsprotokolle. Jede Quelle wird hinsichtlich ihres spezifischen Beitrags zum Verständnis der mittelalterlichen Sexualität und ihren Limitationen diskutiert.
Wie wird die kirchliche Sexualmoral dargestellt?
Die Arbeit analysiert die kirchliche Sexualmoral im Mittelalter ausführlich. Sie beschreibt den christlichen Grundstandpunkt, der von einem Misstrauen gegenüber sinnlichen Freuden geprägt ist und Sexualität primär auf die Reproduktion reduziert. Außerehelicher Geschlechtsverkehr wird als Sünde betrachtet, und auch innerhalb der Ehe ist Sex nur zur Fortpflanzung und Erfüllung ehelicher Pflichten toleriert. Das Konzept des "paulinischen Debitum" wird erläutert. Die strengen Regeln und Vorschriften der Kirche zur Regulierung des ehelichen Geschlechtsverkehrs werden ebenfalls behandelt, um illegitime sexuelle Aktivitäten zu unterbinden. Die ambivalente Haltung der Kirche – Verurteilung und gleichzeitige Regulierung – wird deutlich herausgestellt.
Wie wird die mittelalterliche Auffassung von Ehe und Sexualität beschrieben?
Die Arbeit hebt den Gegensatz zwischen der modernen Auffassung von Ehe als Liebesbeziehung und der mittelalterlichen, pragmatischeren Sichtweise hervor. Ehe und Sexualität werden im Mittelalter als Mittel zum Zweck (wirtschaftliche Versorgung, Fortpflanzung) betrachtet. Die Dominanz der katholischen Kirche und ihr Einfluss auf die Quellenlage wird betont, was ein möglicherweise verzerrtes Bild des gelebten Sexualalltags erzeugt. Die Ehe wird als der einzige legitime Rahmen für Sexualität dargestellt, außereheliche Beziehungen als Tabu.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Sexualität im Mittelalter mit Unterkapiteln zur kirchlichen Grundhaltung und Sexualmoral, ein Kapitel zu den verwendeten Quellen und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Fokus der Arbeit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die kirchliche Sexualmoral im Mittelalter, Quellen zur mittelalterlichen Sexualität (Bußbücher, Briefe, Literatur), Ehe und Sexualität als gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren, das Spannungsfeld zwischen kirchlicher Lehre und gelebter Praxis sowie das Verhältnis von Sexualität und Macht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die Einstellungen zum Sexualtrieb im Mittelalter zu geben und diese in den historischen Kontext einzuordnen. Sie untersucht die Sexualität im Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung der kirchlichen Sexualmoral und der verfügbaren Quellen.
- Quote paper
- Alexander Erhard (Author), 2011, Sexualität im Mittelalter - mit besonderer Fokussierung auf Kirchliche Sexualmoral und Quellen mittelalterlicher Sexualität/Erotik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183367