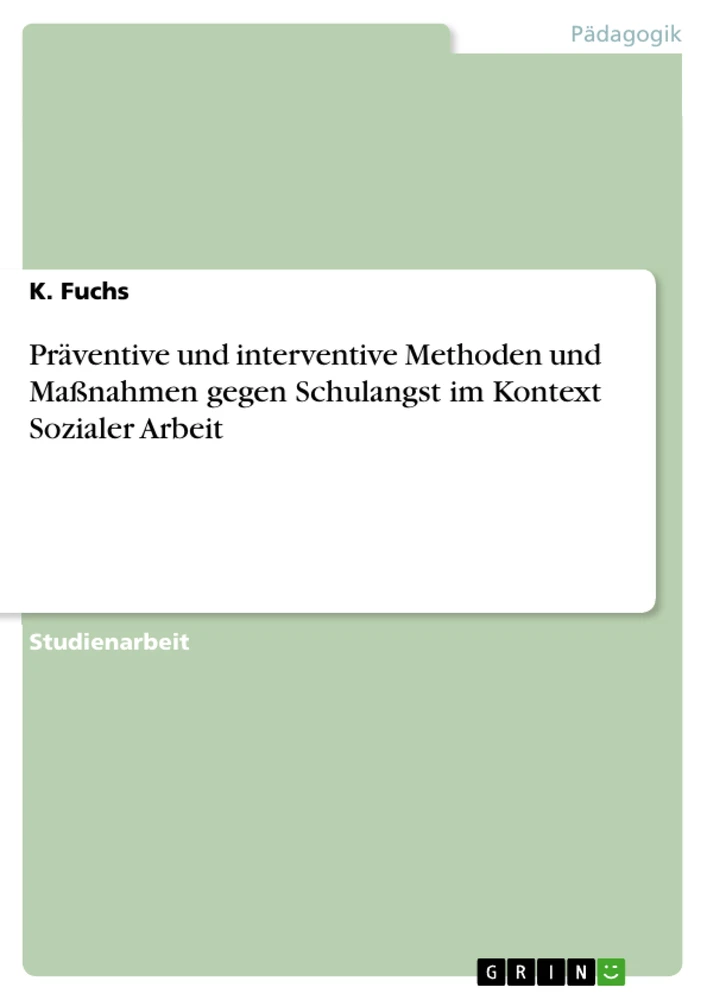„Ich will da nicht hin!“ Diese Aussage hören Eltern und Erziehungsberechtigte in der heutigen Zeit vermehrt von ihren Kindern. Sie fürchten sich vor MitschülerInnen, LehrerInnen oder verschiedenen Situationen im Unterricht. Magen‐, Bauch‐ und Kopfschmerzen werden dabei am häufigsten als Grund genannt, um die Schule nicht besuchen zu müssen. In dieser Seminararbeit möchte ich erörtern, weshalb die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unter Schulangst leiden, stetig wächst und wie man diesem Problem präventiv und interventiv entgegnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Angst
- Entstehung
- Schulangst
- Folgen und Probleme
- Prävention
- Sozialisation
- Standort Schule
- Modelle
- Intervention
- Möglichkeiten und Ansätze
- Bundesverband Aktion humane Schule e. V.
- Auftrag der Sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das wachsende Problem der Schulangst bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Ursachen von Schulangst zu beleuchten und präventive sowie interventive Maßnahmen im Kontext Sozialer Arbeit zu erörtern. Der Fokus liegt auf leistungs- und sozialbezogenen Ängsten im Schulkontext.
- Definition und Entstehung von Angst
- Folgen und Auswirkungen von Schulangst
- Präventionsmöglichkeiten und -methoden
- Interventionsmöglichkeiten und -ansätze
- Der Auftrag der Sozialen Arbeit im Umgang mit Schulangst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der zunehmenden Schulangst bei Kindern und Jugendlichen dar und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont den Fokus auf leistungs- und sozialbezogene Ängste und kündigt die Erörterung präventiver und interventiver Maßnahmen an, wobei sozialpädagogische, aber auch psychologische Aspekte berücksichtigt werden.
Angst: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Angst", differenziert zwischen Zustandsangst und Ängstlichkeit und stellt Riemanns vier Grundformen der Angst vor. Es beschreibt die körperlichen Reaktionen auf Angst, die durch die Ausschüttung von Stresshormonen ausgelöst werden und sich in verschiedenen physischen Symptomen manifestieren.
Angst - Entstehung: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung von Angst und ihre Signalfunktion als Warnmechanismus vor Gefahren. Es beleuchtet die Unterscheidung zwischen normaler und krankhafter Angst, wobei die Grenze durch die Intensität, Unangemessenheit und mangelnde Kontrollierbarkeit der Angst bestimmt wird. Der Text veranschaulicht dies anhand eines Beispiels mit der Angst vor Spinnen.
Angst - Schulangst: Dieses Kapitel definiert Schulangst als umschriebene Angst vor Personen oder Bedingungen, die mit dem Schulbesuch assoziiert sind. Es hebt hervor, dass Schulangst kein diagnostischer Begriff, sondern ein Syndrom ist, das durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden kann.
Prävention: Dieses Kapitel behandelt präventive Maßnahmen gegen Schulangst. Es werden verschiedene Ansätze und Modelle vorgestellt, die sich mit der Sozialisation, der Gestaltung des Schulstandorts und der Entwicklung von Schutzfaktoren befassen. Details zu den einzelnen Modellen und deren Anwendung bleiben im Rahmen dieser Kurzfassung jedoch aus.
Intervention: Dieses Kapitel widmet sich interventiven Maßnahmen zur Bewältigung von bereits bestehender Schulangst. Es werden Möglichkeiten und Ansätze der Intervention vorgestellt, und der Bundesverband Aktion humane Schule e.V. wird als Beispiel für eine Organisation genannt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
Auftrag der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel erörtert die Rolle der Sozialen Arbeit, insbesondere der Schulsozialarbeit, bei der Prävention und Intervention von Schulangst. Es beschreibt den wichtigen Beitrag der Sozialen Arbeit im Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen und ihren Familien.
Schlüsselwörter
Schulangst, Prävention, Intervention, Soziale Arbeit, Schulsozialarbeit, Angst, Ängstlichkeit, Leistungsangst, Soziale Ängste, Stress, Kinder- und Jugendpsychologie, Entwicklungspsychologie, Schulpsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Schulangst
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das wachsende Problem der Schulangst bei Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet die Ursachen von Schulangst und erörtert präventive sowie interventive Maßnahmen im Kontext Sozialer Arbeit, mit Fokus auf leistungs- und sozialbezogene Ängste im Schulkontext.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entstehung von Angst, die Folgen und Auswirkungen von Schulangst, Präventionsmöglichkeiten und -methoden, Interventionsmöglichkeiten und -ansätze sowie den Auftrag der Sozialen Arbeit im Umgang mit Schulangst.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Angst (inkl. Entstehung und Schulangst), Prävention, Intervention, dem Auftrag der Sozialen Arbeit und einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was versteht die Arbeit unter Angst und deren Entstehung?
Die Arbeit definiert den Begriff "Angst", differenziert zwischen Zustandsangst und Ängstlichkeit und stellt Riemanns vier Grundformen der Angst vor. Sie beschreibt die körperlichen Reaktionen auf Angst und untersucht die Entstehung von Angst als Warnmechanismus vor Gefahren. Die Unterscheidung zwischen normaler und krankhafter Angst wird anhand der Intensität, Unangemessenheit und Kontrollierbarkeit der Angst erläutert.
Wie wird Schulangst definiert und welche Faktoren spielen eine Rolle?
Schulangst wird als umschriebene Angst vor Personen oder Bedingungen definiert, die mit dem Schulbesuch assoziiert sind. Es wird betont, dass Schulangst kein diagnostischer Begriff, sondern ein Syndrom ist, das durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden kann.
Welche Präventionsmaßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene präventive Ansätze und Modelle vor, die sich mit der Sozialisation, der Gestaltung des Schulstandorts und der Entwicklung von Schutzfaktoren befassen. Details zu den einzelnen Modellen bleiben jedoch im Rahmen dieser Kurzfassung aus.
Welche Interventionsmaßnahmen werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Interventionsmöglichkeiten und -ansätze zur Bewältigung bestehender Schulangst. Der Bundesverband Aktion humane Schule e.V. wird als Beispiel für eine relevante Organisation genannt.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit im Kontext von Schulangst?
Die Arbeit erörtert die wichtige Rolle der Sozialen Arbeit, insbesondere der Schulsozialarbeit, bei der Prävention und Intervention von Schulangst und beschreibt deren Beitrag im Umgang mit betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulangst, Prävention, Intervention, Soziale Arbeit, Schulsozialarbeit, Angst, Ängstlichkeit, Leistungsangst, Soziale Ängste, Stress, Kinder- und Jugendpsychologie, Entwicklungspsychologie, Schulpsychologie.
- Quote paper
- K. Fuchs (Author), 2011, Präventive und interventive Methoden und Maßnahmen gegen Schulangst im Kontext Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183829